 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |

Photo: Privat |
 |
Grete Albrecht, geb. Hieber |
Neurologin, Präsidentin des Deutschen Arztinnenbundes
17.8.1893 Hamburg - 5.8.1987 Braunlage |
 |
| Elfriede Margarete "Grete" Albrecht war die Tochter von Charlotte Emilie Hieber, geb. Kammann und des Brauereidirektors Albert Friedrich Hieber. Wenn in ihrer Kindheit über die zukünftigen Berufe der Geschwister gesprochen wurde, hieß es vom Vater: "Mädchen heiraten oder werden Lehrerin." Grete wollte aber weder Lehrerin werden, noch hatte sie als Kind den Wunsch, später einmal zu heiraten. Als sie ungefähr zwölf Jahre alt war, verkündete sie ihren Eltern, später Medizin studieren zu wollen. Ihr Vater nannte dies einen "Spleen", denn: "Mädchen können gar nicht Arzt werden." Als Grete Hieber fünfzehn Jahre alt war, starb der Vater und Grete konnte ihre Mutter überreden, sie Abitur machen
|
| zu lassen. Da es damals noch keine Mädchengymnasien gab, besuchte sie eine Privatschule des Vereins für Mädchenbildung und Frauenstudium. 1913 legte sie als Externe das Abitur an einem Realgymnasium für Jungen ab. Um sie von ihrem Berufswunsch Ärztin abzubringen, schickte ihre Mutter sie zu ihrem alten Hausarzt, damit dieser ihr ins Gewissen rede. Doch auch ihm gegenüber äußerte Grete Hieber den Berufswunsch Ärztin, woraufhin sie eine kräftige Ohrfeige von ihm bekam mit der Bemerkung: "Dummes Gör…" Schließlich durfte Grete Medizin studieren, was sie bis 1918 in München, Freiburg i. Br., Kiel und Berlin tat. Als sie nach ihrem Medizinalpraktikum, das sie in einem Berliner Krankenhaus absolvierte, einen praktischen Arzt, der als Soldat eingezogen war, in dessen Praxis vertrat, wurde ihr klar, warum sie Medizin hatte studieren wollen. So schreibt sie in ihren privaten Aufzeichnungen: "Die Arbeit in der großen Kassenpraxis, die in einem Arbeiterviertel lag, mit fünfzig bis sechzig Patienten an einem Nachmittag, war neu und aufregend für mich. Zum ersten Mal war ich allein verantwortlich für alles was ich tat oder nicht tat." In dieser Zeit in Berlin wurde Grete Albrecht auch die "Rote Grete" genannt. Am Ende ihres praktischen Jahres heiratete sie im April 1919 den Juristen Siegfried Ludwig Hermann Albrecht (1890-1967). Im selben Jahr machte sie ihr Staatsexamen und erhielt ihre Approbation. 1920 wurde ihr erster Sohn geboren. Im selben Jahr promovierte sie. 1922 kam dann der zweite Sohn zur Welt. Zwei Jahre später übernahm sie zweimal wöchentlich Beratungsstunden in einer Beratungsstelle der Säuglings- und Kleinkinder-Fürsorge. Doch immer stärker wurde der Wunsch, sich mehr der Medizin widmen zu können. So fing sie in einem Hamburger Krankenhaus als Volontärärztin an und arbeitete auf der Inneren Abteilung und später auf der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Doch Ihr Interesse galt zunehmend den seelischen und neurologischen Erkrankungen. Deshalb absolvierte sie zwischen 1928 und 1929 eine Weiterbildung bei Ernst Kretschmer in Marburg. Ihre beiden Kleinkinder hatte sie nach Marburg mitnehmen müssen. Ende 1929 kehrte sie mit ihren Kindern nach Hamburg zurück und vervollständigte ihre Fachausbildung bei Prof. Nonne in der Neurologie der Universitätsklinik Hamburg Eppendorf. 1931 ließ sie sich dann als Neurologin nieder. Auch wurde sie Mitglied des Deutschen Ärztinnenbundes, dessen Geschäftsführerin sie 1935 wurde. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten trat der Erlass des Doppelverdiener-Gesetzes in Kraft, wonach u.a. Ärztinnen keine Kassenpraxis führen durften, wenn der Ehemann verdiente. Grete Albrecht verlor 1936 ihre Kassenzulassung, weil ihr Ehemann nach den Nürnberger Rassengesetzen als "Jüdischer Mischling ersten Grades" galt. Im selben Jahr verließ sie auch den Deutschen Ärztinnenbund. Noch 1934 hatte sie sich dort gegen die Diskriminierung verheirateter Ärztinnen eingesetzt. 1942 wurde ihr zweiter Sohn als Soldat getötet. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus nahm Grete Albrecht 1945 ihre Praxis in ihrer Privatwohnung wieder auf. Zwei Jahre später wurde die Ehe geschieden. Neben ihrer ärztlichen Tätigkeit baute sie nach dem Krieg die Hamburger Ärztekammer wieder mit auf. 1945 wurde sie in deren Vorstand gewählt und gehörte ihm bis 1962 an. Auch beteiligte sie sich an der Neugründung des Deutschen Ärztinnenbundes. Auch hier war sie ab 1945 im Vorstand tätig und von 1955 bis 1965 dessen Präsidentin sowie bis 1969 dessen Ehrenpräsidentin. Während dieser Zeit amtierte sie auch von 1958 bis 1962 als Vize-Präsidentin des Internationalen Ärztinnenbundes. Grete Albrecht wollte durch diese ehrenamtlichen Aktivitäten die Stellung der Frau als Ärztin in der Öffentlichkeit festigen und fördern. 1962 wurde sie mit der Paracelsus-Medaille der deutschen Ärzteschaft ausgezeichnet, weil sie auch in "schwerster Notzeit unbeirrt trotz ihr persönlich drohender Gefahren am Leitbild des Arztes als Helfer der sich ihm anvertrauenden Menschen festhielt".
|
|
 |
 |
 |
| Anne Banaschewski |
 |
 |
Direktorin des Instituts für Lehrerfortbildung
16.5.1901 Welschbillig - 4.5.1981 Hamburg |
 |
"Wer nicht an Entscheidungen mitwirkt, über den wird verfügt. Das gilt im kleinen Rahmen der Schule und des Verbandes, wie es im größeren der Gesellschaft und des Staates gilt", schrieb Anne Banaschewski in einem Aufsatz, um Frauen zu motivieren, sich als Schulleiterinnen zur Verfügung zu stellen.
Anne Banaschewski, seit 1945 schulreformerisch tätig, stritt u. a. für einen höheren Anteil von Frauen in den Schulleitungen und für eine Bildung, die Mädchen nicht nur auf die "kurze Übergangszeit zwischen Schulentlassung und Ehe" vorbereitet, sondern schulisch und beruflich ausbildet, so dass auch Frauen die Möglichkeit des lebenslangen Lernens erhalten.
|
Anne Banaschewski wuchs mit fünf Geschwistern in einem bürgerlichen Elternhaus auf. Nach dem Abitur studierte sie Kunstgeschichte, Literatur und mittelalterliche Geschichte und promovierte 1923. Danach arbeitete sie bei einem Verlag, später als Redakteurin bei einer Literaturzeitschrift in München. 1926 wurde sie Mutter eines Sohnes. Nach freier journalistischer Tätigkeit, seit 1927 in Hamburg, konnte sie 1929 durch ein Stipendium ein Studium an der Uni Hamburg beginnen. Nach dem 1. Staatsexamen trat sie in den Volksschuldienst ein, alleinerziehend, promoviert und mit Berufserfahrung, aber lediglich als Hilfslehrerin. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus wurde sie 1945 Mitglied des Gründungsvorstandes der "Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens" ("Gesellschaft"). Zur gleichen Zeit berief die Schulbehörde sie zur Schulleiterin der Volksschule Wellingsbu?ttel und 1952 zur Direktorin des Instituts für Lehrerfortbildung. In der Zeit ihrer Leitung (bis zur Pensionierung 1966) wurde das Seminarangebot erheblich ausgeweitet, die Beratungsstellen ausgebaut. Anne Banaschewski forderte die ‚education permanente' auch für Lehrkräfte. Besonders engagierte sie sich in der Gewerkschaftsarbeit. Sie war lange Jahre im Vorstand der "Gesellschaft", gehörte seinem pädagogischen Ausschuss von 1945 bis zu seiner Auflösung 1976 an. Auch arbeitete sie in der pädagogischen Hauptstelle beim Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), von 1957 bis 1963 aIs Vorsitzende. 1958 berief die GEW sie in eine Kommission zur Erarbeitung eines Plans zur Neugestaltung des deutschen Schulwesens. Dieser 1960 vorgestellte Bremer Plan war damals in der Öffentlichkeit und auch in Teilen der GEW umstritten. So sah er z. B. die Verlängerung der Volksschuldauer unter Einbeziehung von Elementen der Berufsvor- u. -grundbildung auf 10 Jahre, die Reformierung der gymnasialen Oberstufe und die Neueröffnung eines 2. Bildungsweges vor. Anne Banaschewski, enttäuscht, dass auch viele Hamburger GEW Vertreter den Plan ablehnten, legte daraufhin sowohl den Vorsitz in der pädagogischen Hauptstelle, als auch ihr Mandat im Hauptvorstand der GEW nieder. Anne Banaschewski hielt Friedenserziehung und antifaschistischen Unterricht für notwendig. Neben der Vermittlung historischer Zusammenhänge gehörten dazu u. a. Schülermitverantwortung, die Zusammenarbeit mit den Eltern und vorgelebtes demokratisches Verhalten.
Wesentliches aus: Hans-Peter de Lorent: "Wer nicht mitwirkt, über den wird verfügt". Anne Banaschewski, ihre pädagogische Arbeit und die GEW. In: Monika Lehmann/Hermann Schnorbach: Aufklärung als Prozess. Festschrift für Hildegard Feidel-Mertz. Frankfurt a. M. 1992.
|
|
 |
 |
 |

Photo: Staatsarchiv Hamburg |
 |
Emmy Beckmann |
Politikerin, Hamburgs erste Oberschulrätin
12.4.1880 Wandsbek - 24.12.1967 Hamburg |
 |
| Die Zwillingsschwestern Emmy und Hanna lebten zusammen in der Oberstraße 68.
Emmy wurde 1926 Schulleiterin der damaligen Helene-Lange Oberrealschule, ihre Schwester trat 1927 ihre Nachfolge an,
als Emmy zu Hamburgs ersten Oberschulrätin benannt wurde. Emmy war u.a. 1915 Gründungsmitglied des Stadtbundes hamburgischer Frauenvereine,
gab die Quellenhefte zum Frauenleben in der Geschichte heraus, gehörte 1946 zu den Mitbegründerinnen des Hamburger Frauenringes.
Von 1921-1933 war sie für die Deutsche Demokratische Partei Bürgerschaftsabgeordnete.
1933 von den Nazis ihrer Schulämter enthoben, zogen sich die Schwestern in die innere Emigration zurück.
Nach 1945-1949 wieder als Oberschulrätin eingesetzt, war Emmy von 1949-1957 FDP-Bürgerschaftsabgeordnete.
1953 erhielt sie das Große Bundesverdienstkreuz. 1957 verlieh ihr der Senat den Professorentitel.
|
|
 |
 |
 |
| Heinz Beckmann |
 |
 |
Hauptpastor, Protagonist für die Gleichberechtigung der Theologinnen in der Kirche
8.6.1877 Wandsbek - 12.8.1939 Sülzhayn/Südharz
|
 |
| Heinz Beckmann war der Bruder von Hamburgs erster Oberschulrätin, der Frauenrechtlerin und liberalen Politikerin Emmy Beckmann, und deren Zwillingsschwester Hanna. Der gemeinsame Grabstein der Schwestern steht im Garten der Frauen. In Fragen der Frauenemanzipation sicherlich durch seine Schwestern sensibilisiert, setzte sich Heinz Beckmann für die Gleichberechtigung der Theologinnen ein. Solcherart "Beeinflussung" durch seine Schwestern wurde ihm von einigen Kollegen angelastet. Darüber hinaus vertrat er - wie auch seine Schwester Emmy - liberal demokratische Überzeugungen. So war Heinz Beckmann Sprecher der liberalen Fraktion in der Synode.
|
Nachdem er 1899 das theologische Examen abgelegt und einige Zeit als Hilfsredakteur für die liberal protestantische Zeitschrift "Christliche Welt" und danach als Pastor an der Wiesbadener Marktkirche gearbeitet hatte, kam er 1920 nach Hamburg an die St. Nikolai-Kirche, wo er als Hauptpastor wirkte. Ethische und religionsphilosophische Fragestellungen waren seine Schwerpunkte. Das Alte Testament war das zentrale Thema, mit dem er sich beschäftigte. "In den zwanziger Jahren setzte Beckmann sich insbesondere dafür ein, dass auch Frauen nach dem Theologiestudium die beiden kirchlichen Examina ablegen und in den kirchlichen Dienst übernommen werden konnten"1). Dazu verfasste er auch Aufsätze in der Zeitschrift der bürgerlichen Frauenbewegung "Die Frau", für die auch seine Schwester Emmy Artikel schrieb. Dass die Theologinnen "(…) wie er es gefordert hatte - auch ordiniert und gleichberechtigt neben den Pastoren tätig werden sollten, war jedoch weder in Hamburg noch in einer andern deutschen Landeskirche zu diesem Zeitpunkt mehrheitsfähig"1). So hielt z. B. Pastor Heinrich Wilhelmi (1888-1968) den weiblichen seelsorgerlichen Einfluss für eine "gefällige sentimentale Modemeinung" und "argumentierte", die Frau sei zwar dem Manne religiös gleichwertig, aber "in der ersten Christengemeinde" sei sie von der öffentlichen Wortverkündigung ausgeschlossen worden. Und so solle es auch bleiben. Mit dieser Einstellung stand er nicht allein. Auch andere Theologen sahen in ihren Kolleginnen Konkurrentinnen nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene. Die Ablehnung der Theologinnen als gleichberechtigte Berufskolleginnen war auch Ausdruck tief verunsicherter Männer, die in Zeiten der Moderne und der aktiven bürgerlichen sowie proletarischen Frauenbewegung in einer Identitätskrise steckten und deshalb die alte, unhinterfragte dominante männliche Geschlechtsidentität aufrechterhalten wollten. Dennoch gelang es mit Heinz "Beckmanns Unterstützung, 1927 ein Pfarramtshelferinnen-Gesetz durchzusetzen, das den Theologinnen nach Ablegung beider Examina eine Tätigkeit mit eingeschränkten Rechten ermöglichte"1). Ein Jahr zuvor hatte Heinz Beckmann aus Wiesbaden die Theologin Margarete Braun an die St. Nikolai-Kirche geholt und für sie eine Pfarrstelle zur Verfügung gestellt. Er ermöglichte es ihr, das zweite theologische Staatsexamen abzulegen und bis 1934 als Pfarramtshelferin zu arbeiten. Für Margarete Braun befindet sich im Garten der Frauen ein Erinnerungsstein.
Dem Nationalsozialismus standen er und seine Schwestern ablehnend gegenüber. "Bei der Einführung des Bischofsamtes 1933 wurde er entgegen der Tradition der Anciennität wegen seiner liberalen Haltung übergangen und verlor fast alle öffentlichen Wirkungsmöglichkeiten" 1).
1) Rainer Hering: Heinz Beckmann, in: Hamburgische Biografie, Personenlexikon, Hrsg. von Wolfgang Kopitzsch und Dirk Brietzke, Bd.1. Hamburg 2001.
Der Grabstein von Heinz Beckmann befindet sich links vor dem Eingang zum Garten der Frauen
|
|
 |
 |
 |

Photo: privat |
 |
Hedwig Wanda Anna Berta Marie von Brandenstein |
Eine der ersten niedergelassenen Ärztinnen in Hamburg
13.06.1886 Harburg - 30.05.1974 Hamburg |
 |
Hedwig von Brandenstein war die Jüngste von zehn Geschwistern. Nur über den Beruf bzw. den sozialen Stand ihres Vaters erfahren wir etwas: er war Oberstleutnant gewesen.
Hedwig von Brandenstein besuchte in ihrer Jugend das Internat Stift Heiligengrabe in der Mark Brandenburg. 1905 machte sie an einem Erfurter Realgymnasium das Abitur. Danach absolvierte sie ein zehnsemestriges Medizinstudium in Straßburg, Freiburg, Heidelberg und Berlin. Während ihrer Straßburger Studienzeit musste sie die Erlaubnis jedes einzelnen Professors für den Besuch seiner Vorlesungen einholen. Oft wurde ihr dies abgelehnt.
|
Im Mai 1910 schloss sie in Heidelberg das Medizinstudium mit dem Staats-examen ab. Nach dem Studium war sie als Medizinalpraktikantin an der Heidel-berger Universitätspoliklinik und später an der Universitäts-Frauenklinik in Halle tätig.
1911 promovierte Hedwig von Branden-stein. Im selben Jahr erhielt sie ihre Approbation. 1913 wurde sie als Ärztin am Virchow-Krankenhaus Berlin und von September 1913 bis September 1914 als Hilfsärztin am Waisenhaus Berlin tätig. Danach war sie von 1914 bis 1918 Assistentin am Institut für Ge-burtshilfe Hamburg und von 1917 und 1961 niedergelassene Ärztin in Hamburg. Zwischen 1919 und 1951 fungierte sie auch als Postvertrauensärztin. Auch arbeitete sie nach dem Zweiten Welt-krieg in verschiedenen Ausschüssen der Ärztekammer und fungierte einige Zeit als Vorstandsmitglied im Deutschen Akademikerinnenbund.
Insgesamt 47 Jahre lang war Hedwig von Brandenstein als Hausärztin und 40 Jahre lang als Geburtshelferin tätig. Nebenamtlich arbeitete sie als Ver-trauensärztin. Hedwig von Brandenstein war wegen ihrer liebenswürdigen, menschlichen und geistigen Lebensart eine beliebte Nachbarin. Sie wohnte in der Fontenay 5.
|
|
 |
 |
 |
| Olga Brandt-Knack |
 |

Photo: privat |
Ballettmeisterin, Bürgerschaftsabgeordnete
29.6.1885 Hamburg - 1.8.1978 Hamburg |
 |
| Im Alter von 10 Jahren begann Olga Brandt-Knack in der Kindertanzschule des Hamburger Stadttheaters ihre tänzerische Laufbahn, avancierte 1907 zur Solotänzerin und 1922 zur Leiterin des Balletts. Olga Brandt-Knack, in den zwanziger Jahren einige Jahre verheiratet mit Prof. Dr. Andreas Knack, dem Leiter des Allgemeinen Krankenhauses Hamburg-Barmbek, versuchte eine Synthese von klassischem Ballett und Ausdruckstanz herzustellen. 1908 gründete sie den Deutschen Tänzerbund und setzte sich als seine
|
Sprecherin für die Belange ihrer BerufskollegInnen ein. 1918 trat sie der SPD bei. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gründete sie zusammen mit dem Schauspieler Adolf Johannsson den Arbeiter-Sprech- und Bewegungschor. 1932 initierte sie zusammen mit Lola Rogge und anderen die Vereinigung Tanz in Hamburg. Bereits 1932 verlor Olga Brandt-Knack wegen ihrer politischen Betätigung ihre Stellung als Ballettmeisterin. Später wurde sie unter Gestapo-Aufsicht gestellt und vorübergehend verhaftet.Während der Naziherrschaft verdiente sie ihren Lebensunterhalt als Sprechstundenhilfe. Gleich nach dem Krieg trat sie wieder der SPD bei,gründete die Jugendorganisation "Die Falken" mit, arbeitete seit 1948 als Frauenreferentin der Gewerkschaft Kunst und war von 1946 bis 1953 Bürgerschaftsabgeordnete (SPD).
Nach Olga Brandt-Knack wurde 2018 im Stadtteil Rothenburgsort die Olga-Brandt-Knack-Straße benannt. |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Dorothea Christiansen |
Hamburgs erste Schulrätin
22.8.1882 Hamburg - 11.5.1967 Hamburg |
 |
Die in der Curschmannstraße 27 wohnende Dorothea Christiansen schlug eine typische Lehrerinnenlaufbahn ein. Ausgebildet wurde sie am Hamburger Lehrerinnen-Seminar und unterrichtete von 1901 bis 1923 an der Volksschule für Mädchen in der Methfesselstraße 28.
Als es ab 1919 den Lehrern und Lehrerinnen durch die Schulreform möglich wurde, eine Selbstverwaltung einzurichten, (d. h. gemeinsam mit dem Elternrat konnte das Kollegium aus seinen Reihen eine Schulleitung wählen), fiel die Wahl in der Schule Methfesselstraße auf eine Frau, was ein Novum darstellte. Dorothea Christiansen wurde 1919 die neue Schulleiterin. |
Sie engagierte sich in den folgen-den Jahren besonders in der Schulreform und zwar so erfolgreich, dass die Schulbehörde sie 1923 zur Schulrätin ernannte. 10 Jahre - von 1923 bis 1933 - war Dorothea Christiansen als Schulrätin tätig. Die Autorin vieler Hamburgensien, Henny Wiepking, schrieb in einer kurzen Abhandlung über Dorothea Christiansen: "Nach außen wurde ihr Name wenig genannt, als sie diese gehobene Stellung innehatte. So bewährte sich für ihre Freunde die Lebenserfahrung: Das sind die besten Frauen, über die nicht viel geredet wird. Im Verkehr mit ihr, spürte man ihre innige Anteilnahme an alle an sie herangetragenen Nöte. In keinem Fall, wo sie um Rat und Hilfe angerufen wurde, versagte sie. In allen ihren Handlungen lebte der soziale Geist, der Geist der Menschenliebe, der Geist der Menschenwürde. So genoss sie bei ihren Kollegen und Kolleginnen ein hohes Vertrauen."
Während ihrer Tätigkeit als Schulrätin gab es viele Neuerungen in Hamburgs Schulwesen: So wurde z. B. die vierjährige Grundschule für alle Kinder eingerichtet, das Gesetz über die Einheitsschule erlassen, in 50 Volksschulen der Fremdsprachenunterricht eingeführt und die Abschaffung des Schulgeldes und der Lehrmittelbeiträge beschlossen.
Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, wurde Dorothea Christiansen wegen "politischer Unzuverlässigkeit" zwangspensioniert.
Dorothea Christiansen kümmerte sich um einsame Menschen, kinderreiche Familien. Ihre Devise lautete: "Sparen, für wen? Mit warmer Hand weggeben, ist mein Grundsatz."
Quelle:
Henny Wiepking: Frau Dorothea Christiansen. (Staatsarchiv Hamburg. Zeitungsausschnittsammlung)
|
|
 |
 |
 |
| Helga Diercks-Norden (geb. Kehrein) |
 |

Photo: privat |
Journalistin, Frauenrechtlerin, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (CDU:4.1.1977-1978)
6.4.1924 Berlin-12.7.2011 Hamburg |
 |
Helga Diercks-Norden war die Tochter von Margarete Kehrein, geb. Nordloh und Hugo Kehrein. 1942 machte Helga Kehrein Abitur an der Chamisso-Oberschule für Mädchen. Danach besuchte sie von April 1942 bis Oktober 1942 die Haushaltsschule "Lette-Schule" und belegte einen Haushaltungskursus und von Oktober 1942 bis April 1943 einen Zeichenkursus.
In dieser Zeit soll die 18-Jährige am 7.7.1942 die Mitgliedschaft in der NSDAP beantragt haben. So steht es auf ihrer NSDAP-Mitgliederkarteikarte. Die Aufnahme erfolgte im September 1942. (BArch (Bundesarchiv) R 9361-IX Kartei 19610566).
|
Zur Beitrittsmöglichkeit in die NSDAP scheibt Juliane Wetzel allerdings: "Alle ‚Volksgenossen', die deutsche Staatsangehörige waren, einen guten Leumund und das 21. Lebensjahr vollendet hatten, konnten der Partei nur vom 1. Mai 1939 bis 2. Februar 1942 beitreten, dann erfolgte erneut eine Aufnahmesperre. ‚Im Einvernehmen mit der Parteikanzlei hat der Reichsschatzmeister am 2. Februar 1942 für die Dauer des Krieges eine totale Mitgliedersperre verfügt, sodaß Aufnahmeanträge in dieser Zeit nicht entgegengenommen werden können. Ausgenommen hiervon sind nur HJ-Überweisungen in die NSDAP'."
Und weiter schreibt Juliane Wetzel über die Motivation bzw. den Druck auf die Hitler-Jugend in die NSDAP einzutreten: "Die politischen Ereignisse des Jahres 1938, die Erfolge Hitlers auf internationalem Boden, der ‚Anschluss' Österreichs, ließen die Vorstellung, die Partei verkörpere eine ‚Bewegung', der anzugehören ein besonderes Privileg sei, immer mehr in den Hintergrund treten. Die Reglementierungen nahmen zu und die Freiwilligkeit trug nur noch den äußeren Schein. Die einen fühlten sich gedrängt, der Partei beizutreten, weil sie ihren Besitzstand sichern wollten, die anderen, die parteinahen Organisationen angehörten und noch nicht Mitglieder der Partei waren, bekamen den äußeren Druck zu spüren. Dies galt insbesondere für die Angehörigen der Hitler-Jugend und des BDM, die von den Mitgliedersperren der vergangenen Jahre ausgespart blieben und auch 1942, nach einer erneuten Aufnahmesperre für die Dauer des Krieges, nahezu die Einzigen waren, deren letzte Jahrgänge Parteimitglieder wurden und deren Eintritte ‚vollkommen gesteuert' waren, wie Gerhard Botz schreibt." (Juliane Wetzel: Die NSDAP zwischen Öffnung und Mitgliedersperre, im: Wolfgang Benz (Hrsg.): wie wurde man Parteigenosse. Die NSDAP und ihre Mitglieder. Frankfurt a. M. 2009, S. 82.und S. 85f.)
Im Sommersemester 1943 begann Helga Kehrein an der Universität Jena Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften zu studieren und absolvierte Praktika an verschiedenen Bühnen. Als im Sommer 1944 die Universität schloss, war sie wegen eines Herzleidens und einer Lungenentzündung von August 1944 bis April 1945 zu Hause. Von September 1945 bis November 1945 arbeitete sie dann als Bürokraft in einem technischen Büro. Danach war sie zwischen November 1945 und September 1946 bei P. H. Welcke Pressdienste Berlin als Reporterin beschäftigt. Im September 1946 erhielt sie schließlich als Reporterin eine Anstellung beim Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) in Hamburg. In diese Zeit fällt auch ihr Entnazifizierungsverfahren. In ihrem Entnazifizierungsfragebogen kreuzte sie die Mitgliedschaft in der NSDAP nicht an. Aus diesem Grunde wurde sie dazu von der Militärregierung befragt. Daraufhin gab sie folgende Erklärung ab: "Mir ist die Fotokopie einer Karteikarte der NSDAP vorgelegt, aus der hervorgeht, dass ich am 7.7.42 in Berlin W 30, Münchenerstr. 47 gewohnt habe und Aufnahme in die Partei beantragt habe. Meine Aufnahme erfolgte am 7.9.42 unter Nr. 9 125 138. Ich habe diese Karteikarte geprüft. Sie betrifft mich zweifellos. Lediglich die Angaben, die sich auf Parteiantrag, - Aufnahme und - Nummer beziehen erkenne ich nicht an. Diese Daten habe ich erstmalig anlässlich meiner Vernehmung vor dem Aufsichtsoffizier vom NWDR erfahren.
Die Wahrheit ist, dass ich zu keiner Zeit einen Parteiantrag gestellt habe und niemals Mitglied der NSDAP oder einer ihrer angeschlossenen Organisationen oder ihrer Gliederungen war. Ich habe daher auch niemals Beiträge für die NSDAP oder ihrer Organisationen bezahlt. Auch habe ich keine Erklärung, wie die NSDAP in den Besitz meiner Personalien zwecks Aufnahme als Parteimitglied gekommen ist. Die Möglichkeit besteht, dass mein Vater in seiner Eigenschaft als Kreisleiter seines Wohnbezirkes mich ohne mein Wissen der NSDAP als Parteimitglied gemeldet hat, da die Partei grossen Wert darauf legte, dass die Familienangehörigen der führenden Parteimitglieder gleichfalls Mitglied von Parteiorganisationen wurden. Da mein Vater zu dieser Zeit nicht Münchenerstr. 47, sondern seit 1940 im Kreishaus der NSDAP wohnhaft war, und ich kein herzliches Verhältnis zu meinem Vater hatte, habe ich von diesen Vorgängen nichts erfahren. Die Wohngemeinschaft habe ich mit meinem Vater nicht wieder aufgenommen und die Ehe wurde 1944 geschieden.
Ich verschwieg bei Ausfüllung meines Fragebogens die Frage 101, dass mein Vater in Berlin Kreisleiter der NSDAP war, weil er 1945 gefallen ist und ich als alleiniger Ernährer meiner Mutter und meines Bruders Angst hatte, bei wahrheitsgemässer Beantwortung dieser Frage die angestrebte Stellung beim NWDR nicht zu erhalten." (Hamburg 30. Juni 1948)
Der Pol.-Inspektor I (K) Müller, der mit Ermittlungen von Fragebogenfälschungen beauftragt war und Helga Kehrein vernommen hatte, kam zu folgendem Schluss: "Die Eröffnung eines Verfahrens vor dem Gericht der Kontroll-Kommission erscheint wegen der Geringfügigkeit der Fragebogenfälschung nicht geboten." (30. Juni 1948). Helga Kehrein wurde in Kategorie V - entlastet - eingestuft. (Staatsarchiv Hamburg, 221-11, FC (P) 3661)
Helga Kehrein wurde 1946 der erste weibliche Reporter für die NDR-Hörfunksendung "Hafenkonzert" und wurde unter ihrem Künstlerinnennamen Helga Norden landesweit bekannt. (NWDR bis Jahreswechsel 1955/56, dann NDR). Ab 1950 war sie dann ständige Mitarbeiterin in den neuen NDR-Sendereihen "Umschau am Mittag", "Umschau am Abend", "Von Land und Meer", "Kulturumschau", "Zwischen Hamburg und Haiti" und "Funkbilder aus Niedersachsen". 1953 begründete sie mit weiteren NDR-Kollegen den "Sonntagsfamilientisch für Flüchtlinge aus der DDR". Von Ende 1954 bis Mai 1955 übernahm sie die Redaktion und Moderation der "Umschau am Abend"; konzipierte viele eigene Sendungen und übernahm ab 1955 das UKW-Programm, die "Welle der Freude!" zu popularisieren, sprich in der Bevölkerung bekannt zu machen. Hierzu fuhr sie jeden Samstag mit dem Ü-Wagen auf den Marktplatz eines Ortes im NDR-Sendegebiet und präsentierte vor Ort eine Direktsendung, die vom Ü-Wagen übertragen direkt ausgestrahlt wurde.
1955 wurde auch ihr einziges Kind, ihr Sohn, geboren. Einige Jahre zuvor hatte sie Carsten Diercks geheiratet, der 1. Kameramann beim NDR war.
Ab 1956 bekam Helga Diercks-Norden zusätzliche redaktionelle Aufgaben in der Feature-Abteilung zugeteilt, hatte häufig die Leitung der Norddeutschen Redaktion inne, moderierte regelmäßig die Weihnachts-Grußsendung von Seemannsfrauen an ihre Männer über Norddeich-Radio und führte regelmäßige life-Moderationen der Samstag-Nachmittagssendung "Im Funkhaus wird getanzt" durch. Ihre Reportagen und Sendungen waren so gefragt, dass sie über den Programmaustausch in allen Sendern zu hören waren: Helga Norden war bundesweit ein Begriff!
Im Herbst 1957 wurde Helga Diercks-Norden zum Aufbau der Sendung "Zeitgeschehen" und eines Regionalprogramms in das Fernsehen des NDR nach Hamburg Lokstedt versetzt. Helga Diercks-Norden war die erste Fernseh-Reporterin, die direkt von allen größeren Ereignissen im Sendegebiet berichtete. Außerdem koordinierte sie die Programme, legte Abläufe fest, arbeitete im Studio 4 vor laufender Kamera, moderierte, diskutierte, stellte vor etc. Helga Diercks-Norden begann mit eigenen Filmproduktionen für das regionale Vorabendprogramm (so z. B. mit dem Film "Spiel mit dem Zeichenstift"). Zeitgleich vertrat sie mit dem Intendanten den NDR auf allen FS-Programm-Konferenzen und übernahm die Redaktionsleitung der politischen Sendereihe "Themen der Woche".
In der Zweiten Hälfte der 1950-er Jahre gab es Planungen für ein zweites Fernsehprogramm (ZDF). Da das ZDF jedoch nicht so schnell auf Sendung gehen konnte, beschloss die ARD, bis zum Sendestart des ZDF ein zweites Programm zu gestalten. Dazu beauftragte 1959 die ARD den NDR - und Helga Diercks-Norden hatte diesen Part zu übernehmen. Um den Anspruch auf die Sendelizenz des ZDF zu erhalten, musste sie ein tägliches sechsstündiges Programm liefern.
1963 folgte sie mit ihrem Sohn ihrem Mann nach Indien, wo Carsten Diercks in New Delhi ein Fernsehstudio und das Indische Fernsehen mit aufbaute. In Indien wurde Helga Diercks-Norden die offiziell akkreditierte Korrespondentin für die Schweiz, für Radio Bern, FS-Zürich, die "Weltwoche" und andere Zeitungen. Der Auslandspresseclub in Neu Delhi musste seine Statuten ändern, weil Helga Diercks-Norden die erste weibliche Korrespondentin in diesem Teil der Welt war.
Nach der Rückkehr nach Deutschland im Jahre 1973 war Helga Diercks-Norden fortan freiberuflich als Journalistin tätig.
Helga Diercks-Norden engagierte sich sowohl parteipolitisch als auch frauenpolitisch.
Helga Dirks-Norden; Foto: privatSie war seit 1960 Mitglied der CDU. Vom 1.4.1977 bis zur Neuwahl des Parlaments im Jahre 1978 war sie als CDU-Bürgerschaftsabgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft tätig. Später wurde sie in den Vorstand der "Vereinigung ehemaliger Hamburgischer Bürgerschaftsabgeordneter" gewählt. Auch war sie eine Zeitlang stellvertretende Landesvorsitzende der Mittelstandsvereinigung der Hamburger CDU sowie Deputierte der Behörde für Inneres und auch Deputierte der Kulturbehörde.
Helga Diercks-Norden war Mitglied in der Geschäftsführung der "Arbeitsgemeinschaft Hamburger Frauenorganisationen" (später umbenannt in "Landesfrauenrat Hamburg"). Von 1986 bis 1990 fungierte sie als Vorsitzende des "Landesfrauenrates Hamburg e.V.". Später wurde sie gewählte "Ehrenvorsitzende des Landesfrauenrats". Von 1992 bis 1997 hatte sie als Vertreterin des Landesfrauenrates einen Sitz im NDR-Rundfunkrat. Darüber hinaus war Helga Diercks-Norden lange Jahre Vorsitzende des "Deutschen Staatsbürgerinnen-Verbandes/Landesgruppe Hamburg". Sie war auch Delegierte der "International Alliance of Women" (IAW), arbeitete in der UNESCO und deren Unterorganisationen mit und war von 2000 bis 2010 Mitglied im Vorstand des Vereins Garten der Frauen e.V..
Darüber hinaus amtierte sie lange Zeit als Aufsichtsratsmitglied bei den Hamburger Wasserwerken und beim Völkerkundemuseum.
2007 erhielt sie vom Landesfrauenrat die "Zitronenjette" verliehen. Außerdem war Helga Diercks-Norden Trägerin des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse und Inhaberin der Silbermedaille des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg für treue Arbeit im Dienste des Volkes.
Text: Rita Bake
Helga Diercks-Norden ist nicht im Garten der Frauen selbst, sondern in der Nähe, bei Ihrem Mann Carsten Diercks, bestattet.
|
|
 |
 |
 |

Bild aus: Gisela Jaacks: gesichter und persönlichkeiten. bestandskatalog der Portraitsammlung im Museum für hamburgische Geschichte. hamburg 1992. (Gemälde von O. Herrfurth 1916) |
 |
Minna Froböse (geb. Schierloh) |
Stifterin: Ernst und Minna Froböse Stiftung
22.2.1848 Hamburg - 8.7.1917 Hamburg |
 |
| Minna Froböse, Tochter des Weinhändlers Claus Schierloh erlernte den Beruf einer Schirmmacherin und heiratete den Schirmfabrikanten Ernst August Froböse. Das kinderlose Ehepaar widmete sich wohltätigen Aufgaben. Ernst Froböse spendete große Summen seines Vermögens der Arbeitslosenfürsorge. Minna Froböse, die ihren Mann um drei Jahre überlebte, gab einen großen Teil ihres Erbes an bedürftige Kriegsversehrte aus dem Ersten Weltkrieg und deren Familien. Der Gedanke zu der 1917 gegründeten Ernst und Minna Froböse Stiftung kam Minna Froböse, weil sie sich um Soldatenkinder gekümmert und später auch Kriegsverletzte im Marinelazarett besucht hatte. Heute unterstützt die Stiftung Menschen, die durch Krankheit in eine finanzielle Notlage geraten sind.
|
|
 |
 |
 |
| Maria Wilhelmine Gleiss |
 |
 |
Hamburgs erster praktische Ärztin und eine der ersten deutschen Ärztinnen
19.9.1865 Hamburg -5.2.1940 Hamburg |
 |
Holzdamm 19 (erste Praxis 1904)
Papenhuderstraße 42 (Praxis ab 1907 bis 1940)
Maria Wilhelmine Gleiss war Hamburgs erste Ärztin und hatte ihre erste Praxis als niedergelassene praktische Ärztin ab 1904 am Holzdamm 19. Ab 1907 praktizierte sie bis zu ihrem Tod 1940 in der Papenhuderstraße 42.
Geboren wurde sie als Tochter des Pastors Karl Wilhelm Gleiss (1818-1889), der Stiftsprediger der Kapellengemeinde in St. Georg war und Oberlehrer an der Sonntagsschule St. Georg und somit mit Elise Averdieck zusammenarbeitete. Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters starb auch Maria Gleiss' Mutter. Damals war Maria Wilhelmine Gleiss 24 und 25 Jahre alt.
|
Maria Gleiss, die noch einen Bruder hatte, begann nach dem Besuch der höheren Töchterschule in Hamburg und des Lehrerinnenseminars in Callenburg/Sachsen, welches sie 1886 mit dem Lehrerinnenexamen abschloss, als Lehrerin und Erzieherin sowie 1892 während der Choleraepidemie in Hamburg als Krankenpflegerin zu arbeiten. Letztere Tätigkeit, die sie bei ihrer Großtante Elise Averdieck in deren Diakonissenhaus Bethesda durchführte, führte bei Maria Wilhelmine Gleiss zu dem Entschluss, Ärztin zu werden. Dazu musste sie zunächst einmal Abitur machen. Deshalb besuchte sie zwischen 1994 und 1896 die Gymnasialkurse bei Helene Lange in Berlin. In Februar 1897 machte sie ihr Abitur. Zwischen 1896 und 1897 studierte sie Medizin in Zürich, ab 1897 dann in Halle und absolvierte 1901 ihr Staatsexamen in Freiburg. Im selben Jahr promovierte sie in Straßburg.
Maria Wilhelmine Gleiss gehörte "zu den ersten sechs Frauen, die1901 die deutsche Approbation erlangt hatten".1). Von November 1901 bis Ende September 1902 war sie als Assistenzärztin am Hilda-Kinderspital in Freiburg i. Br. tätig und dann in selber Funktion an den Frauenkliniken in Straßburg und Wien bis sie sich 1903 als praktische Ärztin in Hamburg niederließ.2) "Bis 1908 blieb Maria Wilhelmine Gleiss die einzige Ärztin Hamburgs. 1910 hatte sie drei Kolleginnen und 1914 standen 15 Ärztinnen in Hamburg 1862 Ärzten gegenüber" 3), schreiben Andrea Brinckmann und Eva Brinkschulte in ihrem Aufsatz über die ersten Ärztinnen in Hamburg und am UKE. Und beide verdeutlichen, dass die Etablierung und Anerkennung der Frau als Ärztin nicht ohne Schwierigkeiten vonstattenging. "Ab 1903 musste sie mehrmals gerichtlich gegen die Ehemänner ihrer Patientinnen vorgehen, weil sie eigenmächtig Honorare gekürzt hatten. Maria Gleiss betreute komplizierte Schwangerschaften, führte Entbindungen und ärztliche Nachbetreuungen durch. Eine angemessene Bezahlung der von ihr in Rechnung gestellten Leistungen stimmten die Teils wohlhabenden Männer mit verschiedenen Ausflüchten jedoch nicht zu. Konsequent erstritt Maria Gleiss sich vor dem Amtsgericht auch kleine Beträge." 4)
Maria Wilhelmine Gleiss' Spezialgebiet war die Frauen- und Kinderheilkunde. In ihrer Promotion hatte sie sich mit der "Verhütung fieberhafter Infektionen im Kindbett durch hygienische Maßnahmen" beschäftigt.
Ein Jahr vor ihrem Tod wurde sie 1939 Besitzerin des Kinderheims Heidenheim in Hausbruch. 5)
Maria Wilhelmine Gleiss war in den 1920er Jahren Vorsitzende der Ortsgruppe Hamburg des "Bundes deutscher Ärztinnen", außerdem war sie Mitglied des 1914 gegründeten "Verein Krankenhaus weiblicher Ärzte".
Maria Wilhelmine Gleiss war 1902 dem Hamburger Senat vom Verein "Frauenwohl" als Gefängnisärztin für die weiblichen Gefangenen der Strafanstalt Fuhlsbüttel vorgeschlagen worden. Und Maria Wilhelmine Gleiss wollte diese Aufgabe auch gerne übernehmen. Doch der Verein scheiterte beim Senat mit seinem Gesuch. Der Senat bestätigte (zwar], dass der Antrag wohlwollend geprüft werden solle, ohne dass je Taten folgten, somit Zwangsuntersuchungen weiblicher Strafgefangener weiterhin von männlichen Ärzten durchgeführt wurden." 6)
Bereits zwei Jahre zuvor war der Verein "Frauenwohl" aktiv geworden und hatte an die Gefängnis-Deputation "konkrete Forderungen nach einer Gefängnisärztin für alle Frauen (gestellt], an denen Zwangsuntersuchungen vorgenommen wurden. Der Senat befand, dass der Antrag einer Begründung entbehrte und ‚dass auf das Gesuch um Anstellung eines weiblichen Arztes nicht einzugehen sei.'" 7) (siehe dazu auch unter: Luise Zietz).
Quellen:
1) Andrea Brinckmann, Eva Brinkschulte: Die ersten Ärztinnen in Hamburg und am UKE, in: Spurensuche - erste Ärztinnen in Hamburg und am UKE. Hrsg. Von Eva Brinkschulte. Hamburg 2014, S. 20.
2) Vgl.: https://geschichte.charite.de/aeik/biografie.php?ID=AEIK00385
3) Andrea Brinckmann, Eva Brinkschule, a. a. O., S. 20.
4) Ebenda.
5) Vgl. https://geschichte.charite.de/aeik/biografie.php?ID=AEIK00385
6) Andrea Brinckmann, Eva Brinkschule, a. a. O., S.19f.
7) Ebenda.
|
|
 |
 |
 |

Photo: privat |
 |
Hanna Glinzer |
Direktorin der Schule des Paulsenstiftes
23.2.1874 Hamburg - 1.4.1961 Hamburg |
 |
| Ihre Pflegegroßmutter war Emilie Wüstenfeld, ihre Mutter Marie Glinzer geb. Hartner, Leiterin (1868-1878) der von Emilie Wüstenfeld gegründeten Gewerbeschule für Mädchen. Hanna Glinzer, ebenfalls Lehrerin, übernahm mit 37 Jahren von ihrer Vorgängerin Anna Wohlwill die Leitung der Schule des Paulsenstiftes, eine staatlich anerkannte halböffentliche höhere Mädchenschule, gegründet vom HH Frauenverein zur Unterstützung der Armenpflege, der nur Frauen in seiner Schule beschäftigen wollte. Hanna Glinzer setzte sich für die Durchsetzung dieser Forderung ein. 1908 wurde das Gesetz erlassen, LehrerInnenstellen geschlechtsparitätisch zu besetzen. Vier Jahre später erhielt auch die Paulsenstiftschule die Vorgabe, ein drittel männlicher Lehrkräfte zu beschäftigen. Der Schulvorstand kam der Forderung zwar nach: doch er stellte die Lehrer nur nebenamtlich ein, was bedeutete: Nebenamtliche durften nicht mehr als ein Drittel der Gesamtstunden unterrichten. Hanna Glinzer war führend in der Hamburger Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins. Sie gehörte zu denen, die die restriktive Politik der Nationalsozialisten voraussahen. Als ihre Befürchtungen eintrafen, sah sie in der völligen Verstaatlichung ihrer Schule die einzige Möglichkeit, ihre Schule zu retten. Als dies 1937 geschah, musste Hanna Glinzer aus dem Schuldienst ausscheiden. Sie hatte sich geweigert, den Treueeid auf Hitler zu schwören.
|
|
 |
 |
 |
| Marie Glinzer |

Photo: privat |
 |
Lehrerin, Leiterin der von Emilie Wüstenfeld gegründeten Gewerbeschule für Mädchen
3.12.1843 Hamburg - 6.12.1921 Hamburg |
 |
| Nach dem frühen Tod ihres Vaters wurde die 12jährige Marie Hartner als Pflegetochter in den Haushalt Emilie Wüstenfelds aufgenommen, um ihrer einzigen Tochter Marie Gesellschaft zu leisten. Sie besuchte die Schule des von Charlotte Paulsen und Emilie Wüstenfeld gegründeten "Frauenvereins zur Unterstützung der Armenpflege". 1860 begann ihre Ausbildung zur Erzieherin. Im Alter von 16 Jahren kam Marie Hartner zu Bertha Ronge gesch. Traun, geb. Meyer (siehe Grabsteine: Antonie Traun und Margarethe Meyer Schurz) nach London, bei der sie die Arbeit in einem Fröbelschen Kindergarten kennen lernen sollte.
|
| 1861 engagierte Emilie Wüstenfelds Freundin Malwida von Meysenbug Marie Hartner als Gehilfin für die Erziehung der neunjährigen Olga Herzen, Tochter des im Londoner Exil lebenden russischen Revolutionärs Alexander Herzen. Nach vier Jahren Aufenthalt im Ausland kehrte Marie Hartner 1864 nach Hamburg zurück, wo sie zunächst bei der Familie Kortmann (siehe Grabstein: Marie Kortmann), dann wieder bei Emilie Wüstenfeld wohnte. Marie Hartner begann ihre Ausbildung zur gewerblichen Lehrerin. Am 3. November 1866 weihte sie die vom Hamburger Verein zur Unterstützung der Armenpflege gegründete Schule des Paulsenstifts mit ein (siehe: Grabstein Anna Wohlwill) und unterrichtete an der neuen "Industrieklasse". Marie Hartner wurde 1867 mit der Leitung der Klasse betraut, die sich im dritten Stock des Hauses Großer Burstah 12/16 zu Hamburgs ersten Gewerbeschule für Mädchen entwickelte. Schneidertische und Nähmaschinen waren die erste Ausrüstung. Hand- und Maschinennäherei, Wäsche und Kleiderzuschneiden und -anfertigen waren die ersten Arbeiten, Musterentwerfen und Zierhandarbeiten, alle Ausbesserungen, Waschen und Plätten traten hinzu. Zeichnen, Körperzeichnen, Zeichnen nach Pflanzenmodellen und nach der Natur, Malen, Porzellan- und Holzmalerei, Lithographie wurden eingeführt. Die Anfangsgründe der Physik und Chemie, Deutsch, Rechnen und Elementargeometrie, Buchführung und Schreiben traten hinzu. Man arbeitete für Kunden. Im Herbst 1867 kam Dr. Ernst Glinzer aus Kassel als Lehrer an die Baugewerkschule nach Hamburg und unterrichtete auch an der Gewerbeschule für Mädchen. Marie Hartner und Ernst Glinzer wurden am 2.6.1870 standesamtlich getraut. Marie Glinzer wurde Mutter von 3 Kindern, Otto (Arzt, geb. 1871), Hanna (siehe Grabstein: Hanna Glinzer) und Dora (geb. 1878). Sie setzte ihre Arbeit als Lehrerin fort. Nach dem Tod von Emilie Wüstenfeld kollidierten die Pläne des Vorstandes des Frauenvereins mit Marie Glinzers Auffassungen. Um seiner Frau weiteren Ärger zu ersparen, kündigte Ernst Glinzer die Stelle seiner Frau, was seine Frau sehr kränkte. Die Arbeit der Schulleitung hatte Marie Glinzer besser vertragen als die der Hausfrau und Mutter. Der Abschied von der Erwerbsarbeit war Marie Glinzer zeitlebens nahegegangen.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Christel Grimme, geb. Hartner |
Stifterin
8.9.1899 Hamburg -19.7.1984 Großhansdorf |
 |
Christel Grimme stammte aus einer kinderreichen Familie. Sie war die jüngste Tochter und wuchs zwischen zwei älteren Brüdern und den drei älteren Schwestern, in einer lebensfrohen, von harmonischem Geist geprägten Familie auf, in der man fest zusammenhielt und bereit war, sich gegenseitig zu helfen. Die Eltern waren Toni Hartner und der Maschinenfacharbeiter Wilhelm Hartner, ein Bruder von Marie Glinzer, deren historischer Grabstein ebenfalls im Garten der Frauen steht und die die Pflegetochter der Frauenrechtlerin Emilie Wüstenfeld gewesen war.
Christel Grimmes Brüder wurden Ingenieure und heirateten, zwei ihrer Schwestern blieben ledig.
|
| Eine von ihnen wurde Hausdame, die andere Erzieherin. Niemand von den Kindern der Eheleute Toni und Wilhelm Hartner bekam später Kinder. Eine Cousine von Christel Grimme war die im Garten der Frauen bestattete Elisabeth Glinzer, die einen kurzen Lebensabriss von Christel Grimme verfasste. Darin heißt es: "Frau Grimme heiratete einen, von Jugend auf, hochgradig zuckerkranken Mann [Ernst August Grimme 1901-1973], einen Lehrer und später Schulleiter in Northeim. Trotz aller Warnungen hielt sie an ihrem Entschluss fest. Sie ist ihrem Mann durch die Jahrzehnte hindurch eine gewissenhafte, zuverlässige und fürsorgliche Hilfe gewesen. Durch strikte Einhaltung der Zuckerdiät hat sie sich und ihrem Mann ein erfülltes Berufs- und Freizeitleben ermöglicht. Nach ihrem Tod hinterließ Frau Grimme ein beträchtliches Vermögen. Sie stiftete ihr ‚Erbe' für die Unterstützung und Pflege zuckerkranker Kinder. Ich betone ‚Erbe', denn das Vermögen stammte aus den Hinterlassenschaften der vor ihr verstorbenen Geschwister, vor allem aus der Hinterlassenschaft des Bruders John Hartner (1883-1965). Ein Zeichen für den festen Zusammenhalt der Familienmitglieder bis zum Tode." Die Christel- Grimme-Stiftung gibt es noch heute. Sie dient der Unterstützung zur Heilung, Pflege und Betreuung von Kindern, vorzugsweise solcher, die in Heimen leben und die durch ihre Erkrankung an Diabetes mellitus eine geistige und/oder körperliche Behinderung erfahren haben.
|
|
 |
 |
 |
| Erna Hammond-Norden |
 |

Photo: privat |
Kriegerwitwe, die Frau an seiner Seite
24.5.1906 Hamburg-6.1.1979 Hamburg |
 |
Im Jahre 2005 erinnerte Deutschland mit Feierlichkeiten an das Kriegsende vor 60 Jahren. Der Verein Garten der Frauen gedenkt mit dem Grabstein von Erna Hammond-Norden den vielen tausend Kriegerwitwen des Zweiten Weltkriegs. Sie und die vielen anderen Frauen waren es, die nach den oft unerträglichen Belastungen, Ängsten und Entbehrungen während des Zweiten Weltkriegs einen wesentlichen Anteil am Aufbau des neuen demokratischen Deutschlands hatten. Bei Kriegsende lebten in Deutschland rund 65 Millionen Menschen - mehr Frauen als Männer. Das neue Deutschland brauchte die Frauen als Überlebensarbeiterinnen.
Erna Hammond-Norden, geb. Michel, aus einer Arbeiterfamilie stammend, musste nach
|
| ihrer Ausbildung zur Dekorateurin schon früh zum Lebensunterhalt ihrer Familie beitragen. So blieb denn auch ihr Wunsch, einen künstlerischen Beruf zu ergreifen, unerfüllt. Auf einem "Künstlerfest" im Hamburger Curiohaus lernte sie ihren späteren Mann Wilhelm Hammond-Norden kennen. Er, von Beruf Steinmetzmeister, war gleichzeitig Schriftsteller und Theaterkritiker. 1932 heiratete das Paar. Und obwohl bald darauf die Nazis die Macht ergriffen, begann für Erna die wohl schönste Zeit ihres Lebens. Man lebte sparsam und gesund, war ständiger Gast im Reformhaus, ebenso in den Hamburger Theatern und im legendären Bronzekeller. Das Paar war Mitglied der SPD. Zu seinen Freunden gehörten Hans Leip, Eugen Roth, Helmut Gmelin, Hans Harbek u.a. 1934 wurden die Tochter Renate und 1938 der Sohn Henning geboren. 1939 mit Kriegsbeginn erhielt Wilhelm Hammond-Norden den Einberufungsbefehl. Für seine Frau begann nun die schwere Zeit: Zwei Kleinkinder im Haus und der Mann im Krieg. Der Familienbetrieb lag durch verfehlte Betriebspolitik des Schwiegervaters darnieder und wurde zum Schleuderpreis von einem Wettbewerber übernommen. Und dann kam die schreckliche Nachricht: Ihr Mann wurde nach den Kämpfen um Stalingrad vermisst. Lange Jahre forschte Erna nach seinem Verbleib. Zahllose Gespräche mit heimkehrenden Soldaten wurden geführt, Briefe geschrieben - und immer wieder Hoffnung. Von ihrer kleinen Rente konnte sie sich und ihre beiden Kinder nicht ernähren. So übernahm sie neben der Erziehung ihrer Kinder die Büroarbeit in der nicht mehr der Familie gehörenden Steinmetzfirma. 1955 ließ der neue Firmenbesitzer ihren Mann für tot erklären, um den Namen Wilhelm Hammond-Norden aus dem Handelsregister löschen zu können. Für Erna Hammond-Norden ein Schock. Doch sie konnte nach zähen Verhandlungen erreichen, dass ihr Sohn als Partner in die Firma aufgenommen wurde.
Im Alter erkrankte Erna Hammond-Norden an Hautkrebs. Kurz vor ihrem Tod am 6. Januar 1979 wünschte sie sich von ihrem Sohn sein Steinmetzmeisterstück als Grabstein.
|
|
 |
 |
 |

Photo: privat |
 |
Julie Hansen |
Bibliothekarin
30.6.1883 Hamburg - 5.2.1959 Hamburg |
 |
| Wenige Monate vor ihrer Geburt starb ihr Vater, Kapitän Hansen, beim Untergang der „Cimbria“. Auch ohne den Ernährer gelang es der Witwe, dass ihre drei Kinder Privatschulen besuchen konnten, indem diese z. B. Stipendien erhielten. Julia Hansen erfuhr die Erziehung einer „höheren Tochter“. Doch mit ihrem Wunsch, auf eigenen Füßen zu stehen und einem Beruf nachzugehen, ging sie in Opposition zum Leben einer „höheren Tochter“.
1918 wurde Julia Hansen Leiterin der Barmbeker Bücherhalle - Hamburgs vierten Bücherhalle. Das Verhältnis der Leserschaft zu ihrer Bücherhalle und ihrer Bibliothekarin war sehr vertraut. Besonders zur Jugend hatte Julia Hansen ein besonders gutes Verhältnis. Sie konnte die Jugendlichen fürs Lesen begeistern. Ab 1914 widmete sich Julia Hansen auch der Bibliothekarinnenausbildung. Bereits 1910 hatte sie öffentlich die Gründung einer Bibliotheksschule angeregt, was jedoch am Mangel an geeigneten Dozenten scheiterte. 1940 erhielt Julia Hansen neben Marie Friedrichs die Leitung des gesamten Praktikantinnenunterrichts.
Julia Hansen lebte in der Burgstraße, wo sie mit ihrer Freundin Anni Eschrich zusammen wohnte.
|
|
 |
 |
 |
| Franziska Jahns |
 |
 |
Kindermädchen der Familie Warburg
8.7.1850 Hamburg - 24.2.1907 Hamburg |
 |
| Franziska Jahns, die in einem Waisenhaus aufgewachsen war, kam 1869 im Alter von 19 Jahren als Kindermädchen in das Haus des Ehepaares Moritz und Charlotte Warburg am Mittelweg 17. Damals waren bereits Aby (1866), Max (1867) und Paul (1868) Warburg geboren. Später folgten dann noch: Felix (1871), Olga (1873) und die Zwillinge Fritz und Louise (1879). Die rothaarige junge Frau schenkte den Warburgkindern ihre ganze
|
Zuneigung. Sie war der Gegenpol zu Charlotte Warburg, die ein strenges, aus Leistungsdruck bestehendes mütterliches Regiment führte. Franziska Jahns zeigte sich den Kindern gegenüber warmherzig und gefühlvoll, schenkte ihnen ihre volle Zuwendung - räumte sogar das von den Kindern liegen gelassene Spielzeug weg - und war die einzige in der Familie, die mit den Wutausbrüchen und Augenblickslaunen des jungen Aby Warburg fertig wurde.
Franziska Jahns, die nicht dem jüdischen Glauben angehörte, lernte sogar Hebräisch, um mit den Kindern die Gebete sprechen zu können.
Im Winter 1906/07 erkrankte Franziska Jahns an Influenza. Diese Krankheit schwächte sie so sehr, dass sie am 24. Februar 1907 an einem Schlaganfall verstarb.
38 Jahre war sie - wie es in der von dem Bankier Moritz Warburg aufgesetzten Anzeige zu Franziska Jahns Tod heißt: "die treue Freundin unseres Hauses, die wir schmerzlich vermissen werden". In seinen privaten Unterlagen ist nachzulesen, dass Franziska Jahns: "38 Jahre mit uns Freud und Leid geteilt hatte und durch ihr feines, taktvolles Wesen die Vertraute aller geworden war".
|
| Das Grabmal schuf 1908 Richard Luksch, Bildhauer und Professor an der Kunstgewerbeschule in Hamburg. Zwei kniende Frauenskulpturen: die "Trauer" und die "Hoffnung" sitzen sich in etwa 1 ½ Meter Abstand gegenüber. Zwischen ihnen befindet sich ein in der Mitte geöffneter Steinrahmen. Franziska Jahns wurde damals zwischen den Figuren beigesetzt, so dass die nach unten blickende "Trauer" und die ihr Gesicht nach
|
 |

|
| oben wendende "Hoffnung" an Franziska Jahns Kopfende saßen.
In dem Steinrahmen sind glasierte Keramik-Sterne eingelassen. Zwischen den mit den Handflächen auf dem Steinrahmen ruhenden Händen der "Trauernden" liegt ein einziger Stern. Zwischen den ebenfalls auf dem Steinrahmen liegenden Händen der "Hoffenden", deren Handflächen geöffnet sind, sind drei Sterne zu finden. Die "Trauernde" bewahrt den einen und einzigen Stern, während die "Hoffende" weitere Sterne zu erwarten scheint.
|
|
 |
 |
 |

Photo aus: Barbara Lüders: Mutter der Heimatlosen. Hamburg,.o.J. |
 |
Bertha Keyser |
Schwester der Straßenmission
24.6.1868 Maroldsweisach - 21.12.1964 Hamburg |
 |
Als Kind einfacher gläubiger Eltern wurde Bertha Keyser am 24. Juli 1868 in Maroldsweisach in Bayern geboren. Sie verstand sich als eine Person, die die Menschen auf Jesus Christus hinweisen wollte.
Bertha Keyser hatte vier Geschwister. Ihr Vater, ein Schmiedemeister, starb, als sie noch sehr jung war. Da er Geld aufgenommen hatte, um sich Maschinen zu kaufen, kam die Familie nach seinem Tod in finanzielle Nöte. Haus und Werkstatt mussten verkauft werden, Bertha und ihre Schwester wurden zu Verwandten nach Nürnberg geschickt, wo Bertha in der Bäckerei des Onkels mit anpacken musste.
|
Als 1885 ihre Mutter mit den anderen Kindern nach Nürnberg nachzog, fing Bertha an, in einer Spielzeugfabrik zu arbeiten, um etwas zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Einige Zeit später ging sie nach Wien und im Alter von 34 Jahren (1902) nach England, wo sie als Hausangestellte tätig war. Dort lernte sie die Arbeit der Heilsarmee kennen und wusste von nun an, wozu sie berufen war. Entsprechend interpretiert sie in ihren Lebenserinnerungen auch einen verpassten Rendezvoustermin: Gerade im Begriff, sich zu ihrem Rendezvous aufzumachen, verspürte sie beim Treppenhinabsteigen heftige Schmerzen im Knie. Sie war nicht mehr in der Lage weiterzugehen und konnte somit auch nicht am Treffpunkt erscheinen. Dies deutete sie als Fingerzeig Gottes. Denn um für "den Heiland zu sein - musste ich frei sein von menschlichen Liebesbanden" (Bertha Keyser: Mutter der Heimatlosen. Nach der Lebensbeschreibung von Schwester Bertha Keyser, bearb. von Barbara Lüders. Hamburg o.J.) schreibt sie in ihren Lebenserinnerungen. Wegen des Beinleidens wurde ihr die Stelle im Haushalt gekündigt - und nun wieder ein Fingerzeig: Wie durch ein Wunder wurde nicht nur das Knie geheilt, in einer Zeitungsannonce las sie: Reisebegleiterin nach Berlin gesucht. Sie nahm die Stelle an. Durch diese Tätigkeit sah sie viel von der Welt, so war sie z.B. in Amerika, in der Schweiz und in Frankreich.
Als die Mutter starb, gab Bertha diese Tätigkeit auf, denn nun brauchte sie nicht mehr für ihre Mutter zu sorgen, war, wie sie schreibt, "frei, ohne Rücksicht auf Geld meine ganze Kraft in den Dienst des Herrn zu stellen" (ebenda.). Sie arbeitete in verschiedenen Einrichtungen wie z.B. in einem Diakonissenhaus, später auch als Aufseherin in einem Frauengefängnis. In dem Diakonissenkrankenhaus blieb sie ein Jahr, "trat aber doch wieder aus, weil ich hier nicht fand, wonach sich mein Herz sehnte. Ich hatte mich ohne Entgelt zur Verfügung gestellt, und es war mir nicht schwer gefallen, in dieser Zeit den Kranken mit Rat und Tat zu helfen. Aber dass ich die kleinen materiellen Wünsche meiner Patienten nicht erfüllen konnte und durfte, bedrückte mich sehr. Es war mir einfach ein Bedürfnis, meine Kranken gelegentlich durch Früchte oder kleine Erfrischungen zu erfreuen", schrieb sie in ihren Lebenserinnerungen (ebenda.). So nahm Bertha Keyser wieder eine bezahlte Stelle an, diesmal als Kammerzofe bei einer französischen Gräfin. Aber bald zog es sie wieder zu einer sozialen Tätigkeit, und so kündigte sie und ging in die Wohnviertel den Armen von Paris. Dort lebte sie in einer Kürschnerwerkstatt, half beim Fellespannen und Pelznähen, malte Bilder und verkaufte sie für fünf Francs das Stück. Als das Angebot kam, als Aufseherin in einem Frauengefängnis zu arbeiten, griff sie zu. Sie führte einige Neuerungen ein, sang mit den Mädchen, betete und hielt mit ihnen Andacht. Als einige Mädchen sich nicht den Hausgesetzen entsprechend verhielten, hatte die Gefängnisleitung eine Handhabe, Bertha Keysers Neuerungen zu verbieten. "Alle Freiheiten, die man ihnen gewährt hatte, wurden wieder abgeschafft. Mir wurde untersagt, die Gefangenen in mein Zimmer zu lassen oder mit ihnen Andacht zu halten. Das schien mir ebenso schlimm, wie lebendig begraben zu sein." (ebenda.) Bertha Keyser kündigte und wurde nun Erzieherin in einem Mädchenheim im Elsass. Sie hatte eine ähnliche Arbeit zu verrichten wie im Frauengefängnis, denn in diesem Heim lebten die "tief Gefallenen". Aber auch hier blieb sie nicht lange: "Wir hatten eines Tages eine Unmenge Wäsche, die die Mädchen kaum bewältigen konnten. Ich sah die Erschöpfung der Mädchen und ließ deshalb die Wäsche einmal weniger spülen als sonst. Sie war trotzdem weiß und schön geworden. Ein Mädchen hatte es jedoch der Leiterin hinterbracht. Es kam zu einer scharfen Auseinandersetzung und ich verließ das Heim." (ebenda.)
Bertha Keyser ging zur Heilsarmee zurück. Als sie jedoch zur Kadettenschule nach Berlin geschickt werden sollte und all die Verordnungen las, die sie von nun an einzuhalten hatte, distanzierte sie sich von der Heilsarmee.
Sie zog nach Nürnberg und baute dort im Armenviertel eine eigene Missionsarbeit auf. Als Motor für diese aufopfernde Tätigkeit nannte sie ihren starken Glauben an Gott.
Nach 3 1/2Jahren übergab sie ihre Arbeit der Landeskirche und ging 1913, im Alter von 45 Jahren, nach Hamburg. Der damalige Leiter der Strandmission hatte sie mehrmals darum gebeten. "Spät nachts kam ich im September 1913 nach Hamburg und in dem Missionsheim Richardstraße an. Nach kurzer Rast ging ich schon morgens um 5 Uhr mit in die üblen Kneipen und Keller der Niedernstraße, wo sich die Elendesten und Verkommensten einfanden. Welche Schreckensszenen erlebte ich in dieser gefährlichsten Gegend von Hamburg. Doppelposten von Schutzleuten waren im Abruzzenviertel, wie man diese Gegend nannte, aufgestellt. Ein einzelner Beamter hätte sich der Übergriffe des lichtscheuen Gesindels nicht erwehren können. Ich ließ mich aber nicht abschrecken und ging ganz allein durch die Straßen. Über den Arm hatte ich mir ein paar Würste gehängt und nahm einige Brote mit. So bewaffnet ging ich in die Spelunken und Kellerwirtschaften. Nach meinem Gefühl muss der Hungrige zuerst gesättigt werden, ehe man ihm das Wort Gottes bringen kann. Ich setzte mich daher auf irgendeine Kiste und verteilte meine Gaben. Die Hungrigen hockten sich um mich herum, und während sie aßen, erzählte ich ihnen von meiner Heimat und von meiner Mutter. So schloss ich ihre Herzen auf. Sie fingen nun an zu klagen, dass sie nur zerrissene Schuhe und Lumpen hätten und nicht wüssten, wie sie aus diesem Jammer herauskommen sollten, denn in diesem Zustand könnten sie sich wirklich nicht auf die Straße wagen. So blieben sie in den Kellern hocken und waren dem Laster und der Verzweiflung preisgegeben. Nachdem diese Armen Vertrauen zu mir gefasst hatten, konnte ich sie darauf hinweisen, dass die Sünde der Menschen Verderben ist, und Jesus Christus auch ihr Heiland sein will. Manchem dieser Verlorenen habe ich das Rettungsseil zuwerfen dürfen und sie mit Gottes Hilfe aus leiblichem und seelischem Elend herausgeführt." (ebenda.)
Bertha Keyser arbeitete ehrenamtlich im Missionshaus in der Richardstraße. Ihre Arbeit wurde jedoch neidisch und missgünstig beäugt. Sie schreibt dazu: "Leider hat meine Anteilnahme für die Insassen bei einigen christlichen Geschwistern Anstoß erregt. Aber ich konnte nicht anders. Daher fasste ich den Entschluss, ein eigenes Missionswerk zu beginnen." (ebenda) Bertha Keyser lag es sehr am Herzen, ihre Schützlinge alle gleich zu behandeln, was in den Missionshäusern, in denen sie gearbeitet hatte, nicht die übliche Praxis gewesen war.
Die ersten Räume für ihre Mission fand sie am Alten Steinweg 25. Hier gründete sie die Mission unter der Straßenjugend: "Zuerst wusch ich den Kindern Gesicht und Hände, denn niemand kümmerte sich um sie."(ebenda) Außerdem betreute sie Obdachlose. Im Laufe der Jahre kamen Armenspeisungen, Straßengottesdienste, Gefängnis- und Krankenbesuche sowie die Betreuung von Prostituierten hinzu.
Finanziert wurde ihre Arbeit ausschließlich durch Spenden reicher Kaufleute, Firmen oder Privatpersonen, die sie persönlich aufsuchte.
Im letzten Kriegsjahr zog sie mit ihrer Mission in ein größeres Haus an den Neuen Steinweg. Hier gab es einen großen Saal für Versammlungen, und es konnten ca. 60 Menschen über Nacht untergebracht werden. Aber obwohl Bertha Keyser ihre Obdachlosen angewiesen hatte, beim Verlassen des Hauses barfuß die Treppe hinunterzugehen, beschwerten sich nach einiger Zeit die Hausbewohner über den starken Betrieb. Bertha Keyser wurde daraufhin verboten, Obdachlosen Übernachtungsmöglichkeiten zu bieten. Sie musste ausziehen und fand in der Jugendherberge in der Böhmkenstraße ein neues Zuhause mit 80 Betten.
In den Jahren der Wirtschaftskrise bekamen Bertha Keysers Feldküchenspeisungen großen Zulauf. 1924 schaffte sie deshalb drei Feldküchen an. Damit fuhren sie und ihre Mitarbeiter täglich zum Großneumarkt, zur Reeperbahn und zum Rathausmarkt. 600 Portionen warmer Mittagskost wurden zeitweilig täglich verteilt. 1925 musste Bertha Keyser auf Drängen des Hauswirtes auch die Räume in der Böhmkenstraße verlassen. Sie fand eine neue Bleibe in der Winkelstraße, nahe der Musikhalle, wo die Mission nun ein ganzes Haus für sich besaß.
Wer bei ihr wohnte, musste arbeiten, Sachspenden abholen oder Gelegenheitsarbeiten auf dem von der Mission gepachteten Holzhof ausführen.
1927 konnte Bertha Keyser endlich auch ein Frauenobdachlosenheim einrichten und zwar in der Winkelstraße 7, in einem Haus neben dem Missionsheim. Das Heim erhielt den Namen "Fels des Heils". Für die obdachlosen Männer fand Bertha Keyser in der Stiftstraße, in der Nähe des Hauptbahnhofes, ein neues Domizil.
Bei vielen Anwohnern und Behörden stieß Bertha Keysers Tätigkeit auf keine freundliche Zustimmung. Aber sie ließ sich nicht beirren. Sie verstand sich als Mutter der Heimatlosen. 1929 gründete sie im Alter von 61 Jahren einen "Evangelisch-Sozialen Hilfsverein e. V.". Die Beiträge der Mitglieder dienten zur Unterstützung der Mission.
Über Bertha Keysers politische Einstellung während der Zeit des Nationalsozialismus und ihre Arbeit in dieser Zeit schreibt Claudia Tietz in ihrem Aufsatz über Bertha Keyser: "Bertha Keyser, die von sich sagte, sich nie um Politik gekümmert zu haben, galt dem Hamburger Bischof Franz Tügel (1888-1946), einem profilierten Deutschen Christen, als politisch zuverlässig und der gleichgeschalteten Landeskirche treu ergeben. Auskunft über ihre politische Einstellung geben auch die erhaltenen Exemplare der 'Posaune des St. Michael'. Während die Beiträge des nationalsozialistisch geschulten Parteimitglieds Adolph Bohlen von Propaganda geprägt sind, äußert sich Bertha Keyser weit zurückhaltender: Blind für die deutsche Kriegspolitik, die Verfolgung von ethnischen Gruppen und den Rassenwahn befürwortet sie die von den Nationalsozialisten angeblich betriebene Stärkung der Familie, der öffentlichen Moral und des Christentums. Dabei könnte Bertha Keysers Zurückhaltung sowohl politisch durch ihre öffentlich bekannte, langjährige Sympathie für die evangelikalen Bewegungen am Rand beziehungsweise außerhalb der Landeskirche begründet gewesen sein, welche im 'Dritten Reich' zum Teil verboten waren, als auch theologisch durch ihr Verständnis Jesu Christi. Der Glaube an ihn als den alleinigen Schöpfer, Herrscher und Erlöser schloss für sie andere totalitäre Herrschaftsansprüche aus: Während der nationalsozialistischen Diktatur konnte Bertha Keyser ihre Missionsarbeit nur unter Schwierigkeiten fortsetzen: 1933 musste das Männerheim in der Stiftstraße aus ungenannten Gründen geräumt werden. Als die Winckelstraße im gleichen Jahr in eine geschlossene Bordellstraße umgewandelt wurde, musste auch das Mädchenheim 'Fels des Heils' ausziehen. Eine neue Unterkunft fand die 'Volks- und Straßenmission' im ehemaligen Quartier des zerschlagenen kommunistischen 'Internationalen Seemannsklubs' in der Rothesoodstraße 8. Das Haus wurde am Reformationstag 1934 mit einer Festansprache von Pfarrer Albrecht Jobst (1902-1945) von St. Michaelis über die sieben Bitten des Vaterunsers eingeweiht. Wie in den bisherigen Heimen, befanden sich auch in der Rothesoodstraße die Schlafsäle der Obdachlosen, die Versammlungs- und Arbeitsräume, die Kantine, das Büro und Bertha Keysers Privatwohnung unter einem Dach. Um Arbeitsplätze für die Heimbewohner zu schaffen, wurde in der Nicolaistraße 4 ein Holzhof für 20 Beschäftigte eingerichtet. Wegen Problemen mit dem Heimleiter bestand das neue Missionshaus nur kurze Zeit. Bertha Keyser zog in eine gegenüberliegende Ladenwohnung und führte während des Krieges mit einem kleinen Mitarbeiterkreis in Kellern und Bunkern Armenspeisungen durch." (Claudia Tietz: Die Straßenmissionarin Bertha Keyser (1868-1964), in: Das 19. Jahrhundert. Hamburgische Kirchengeschichte in Aufsätzen, Teil 4. Herausgegeben von Inge Mager. Hamburg: Hamburg University Press, 2013, S. 434f. (Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs, Band 27).
Als 1943 ihr dreistöckiges Heim "Fels des Heils" den Bomben zum Opfer fiel, suchte sie, nun bereits 75 Jahre alt, sofort wieder nach einem geeigneten Haus. 1945 konnte sie schließlich ein kleines Zimmer in der Langen Reihe Nr. 93 mieten. Dort wohnte sie mit Schwester Anna Bandow, die Bertha Keyser unterstützte und die zahlreichen "Essensgäste" beköstigte. Außerdem erklärten sich mehrere Großküchen bereit, für Bertha Keysers Missionswerk mitzukochen. In verschiedenen Schulen konnte die Mission Feierstunden mit anschließender Speisung abhalten. Bei Hamburger Firmen und Kaufleuten erwarb sich Bertha Keyser viele Freunde, Gönner und Spender, die sie regelmäßig mit Sach und Geldspenden unterstützten. Eine große Hamburger Kaffeefirma zahlte die Miete ihrer kleinen Ladenwohnung im Bäckerbreitergang Nr. 7, die sie bewohnte, seit sich die Nachbarschaft aus der Langen Reihe über sie beschwert hatte.
Aber sie wurde vom manchem auch argwöhnisch beäugt. Pastor Lüders schrieb in einem Nachwort zu Bertha Keysers Lebenserinnerungen: "Mag sein, dass die Sozialbehörde, das Arbeitsamt oder auch die Kriminalpolizei zürnend auf dies Sammelbecken Obdachloser sehen. Asoziale Elemente würden durch ihre Speisungen nach Hamburg gezogen oder in Hamburg gehalten, Arbeitsscheue in ihrer Faulheit bestärkt, weil sie bei ihr unentgeltliche Hilfe und Beköstigung finden. Gewiss, sie will das Gute, aber ihre Gutmütigkeit wirkt sich zuweilen als Schade aus. So wird von manchen geurteilt." (ebenda.) Aber: "Schwester Bertha ist für viele Heruntergekommene die letzte Chance zu einem neuen Lebensanfang.(...) Diese für manche letzte Auffangstation hat aber doch Ungezählten im Laufe der Jahre einen neuen und guten Lebensanfang gegeben. Dass die Arbeit eben nicht nur Menschlichkeit zum Motiv hat, sondern die Liebe Christi, die Menschen mit Christus verbinden und dadurch retten möchte, gibt ihr den besonderen Charakter. Welche Behörde kann sich so seelsorgerlich um die Bedürftigen kümmern?" (ebenda.)
Zu ihrer Beerdigung am 29. Dezember 1964 fanden sich über 500 Trauergäste aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten ein. Mit Hilfe der Hamburger Verkehrsbetriebe, die kostenlose Busse vom Bäckerbreitergang zum Friedhof Ohlsdorf einsetzten, war es auch vielen ihrer "Sperlinge Gottes" möglich, am langen Trauerzug teilzunehmen. Bertha Keyser blieb vielen Hamburgerinnen und Hamburgern in Erinnerung. 1983, 18 Jahre nach ihrem Tod, wurde nach ihr der "Bertha-Keyser-Weg" im Hamburger Stadtteil St. Pauli benannt. Ein Jahr später initiierte die Patriotische Gesellschaft die Enthüllung einer Gedenktafel im Bäckerbreitergang. Anlässlich ihres 25. Todestages wurde ein von Hans Petersen geschaffenes Gemälde von ihr in die Krypta des Michels gehängt. Dort verblieb es lange Zeit.
Text: Dr. Rita Bake
|
|
 |
 |
 |
| Annie Kienast |
 |

Photo: Staatsarchiv Hamburg
 |
Betriebsrätin, Mitbegründerin der DAG, Mitglied (SPD) der Hamburgischen Bürgerschaft
15.9.1897 in Hamburg - 3.9.1984 in Hamburg |
 |
Annie Kienast wuchs mit fünf Geschwistern im Arbeitermilieu auf - der Vater war Kesselschmied, die Mutter ein ehemaliges Dienstmädchen, beide SPD-Mitglieder. Annie Kienasts Bildungslaufbahn entsprach dem eines Mädchen aus der Arbeiterschicht: Volksschule, danach Lehre als Textil-Verkäuferin.
Geprägt durch ihre Eltern wurde auch Annie Kienast Mitglied der SPD und der Gewerkschaft. Da war sie 21 Jahre alt. Ihr Hauptinteresse galt der Gewerkschaftsarbeit. Ihr widmete sie ihre ganze Aufmerksamkeit und Kraft - und blieb unverheiratet.
Aktiv war sie im Zentralverband der Handlungsgehilfen (ZdH) bzw. dessen Nachfolgeorganisation, dem Zentralverband der Angestellten (ZdA).
1918 war Annie Kienast eine der Organisatorinnen des ersten Streiks der Hamburger Warenhausangestellten. Darüber erzählte sie: "Es war einige Tage nach dem 9. November 1918. In Schlagzeilen zeigte das Flugblatt eine öffentliche Versammlung für die Waren- und Kaufhausangestellten an:
Wir fordern bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen!
Wir fordern gleiche Bezahlung für Frauen und Männer!
Wir fordern 7-Uhr Ladenschluß am Sonnabend!
Referent: Kollege John Ehrenteit
Die Versammlung fand im großen Saal des Gewerkschaftshauses in Hamburg statt.
|
Tausende von Einzelhandelsangestellten sind damals diesem Ruf gefolgt. Natürlich, ich war auch dabei (...) Eine Tarifkommission wurde gewählt. Die Versammlung zog sich bis nach Mitternacht hin, vor Begeisterung hatte ich es nicht gemerkt (...).
Es ging ans Werk. Der Tarifvertragsentwurf wurde ausgearbeitet und beraten. Wir zogen in die Verhandlung mit den Arbeitgebern; aber kein Baum fällt auf den ersten Hieb. Darum wurde verhandelt, vertagt und berichtet. Kurzfristig wurde die Kollegenschaft abermals zur Versammlung eingeladen; einmütig wie in der ersten stand sie zur Sache! Die Arbeitgeber erklärten, wenn unsere Forderungen Wirklichkeit würden, müßten sie ihre Geschäfte schließen. Im Februar 1919 wurden die Verhandlungen abgebrochen. Als letztes gewerkschaftliches Kampfmittel wurde der Streik beschlossen und angewandt, er dauerte sechs Tage.
Die Einmütigkeit und Entschlossenheit führten zum Erfolg: bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen, gleiche Bezahlung für Frauen und Männer, 7-Uhr-Ladenschluß am Sonnabend. Das war mein erstes gewerkschaftliches Erlebnis (...)." (Anni Kienast: Wie ich Gewerkschafterin wurde. In: Frauenstimme der DAG, Nr. 9, September 1955.)
Die Quittung für ihr Engagement war: Annie Kienast wurde entlassen, konnte aber gleich darauf bei der ZdA-Hamburg anfangen zu arbeiten, wo sie von 1919 bis 1921 tätig war. Zwischen 1921 und 1933 arbeitete sie dann als Warenhausverkäuferin im Konsum-, Bau- und Sparverein "Produktion" und war gleichzeitig Mitglied des Gesamtbetriebsrates der "Produktion" und damit eine der wenigen Frauen, die in einem Hamburger Betriebsrat saßen. Als Gewerkschafterin kümmerte sie sich sehr um die Probleme der erwerbstätigen Frauen.
Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen: "verlor [ich] 1933 meine Stellung und war dann bis 1935 arbeitslos. Dann bekam ich eine Anstellung bei der Defaka. 1943 mußte ich zum Chef kommen. Der Chef hat gesagt: 'Frau Kienast, zum zweiten Mal wird mir mitgeteilt, sie halten in der Kantine kommunistische Reden!' Ich sag: 'Nein' und daß das eine Verleumdung ist. Aber das war außerordentlich gefährlich! Ein Jahr später mußte ich wieder zum Chef. Da war die Vertreterin von der NS-Frauenschaft gestorben, und da sagt der Chef zu mir: 'Wir möchten gerne, daß Sie die Stellung von Valeska übernehmen'. Das müßt Ihr Euch mal vorstellen, wie schwer das ist, sich da rauszuwinden! Da hab ich gesagt: 'Das tut mir furchtbar leid, das kann ich nicht. Ich muß meine armen, alten Eltern betreuen. Ich muß abends immer sofort nach Hause.' 'Nein, das brauchen sie nicht, wir stellen ihnen 'ne Frau, die immer bei ihren Eltern ist'. Und da sage ich: 'Nein, das tut mir furchtbar leid, aber das würden meine Eltern nicht durchhalten.' Und da bin ich so davon gekommen." (Frauen im Faschismus. Frauen im Widerstand, Hamburger Sozialdemokratinnen berichten. Hrsg. von der AsF Hamburg o.J.
Vgl.: Anni Kienast: Die Frau und die Gewerkschaft. In: Gewerkschaftliche Frauenzeitung vom 19.7.1921.)
Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Annie Kienast im Oktober 1946 in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt, der sie bis Oktober 1949 angehörte. In der Nachkriegszeit war sie Mitbegründerin der DAG und gehörte bis 1957 dem Hauptvorstand an.
|
|
 |
 |
 |

Photo: Staatsarchiv Hamburg |
 |
Clara Klabunde, geb. Genter |
Erste Gerichtspräsidentin der Bundesrepublik Deutschland
30.12.1906 Hamburg - 7.7.1994 Hamburg |
 |
Geboren, als Tochter von Bertha Genter, Lehrerin in Hamburger Strafanstalten und des Kaufmanns Hermann Genter gehörte Clara Klabunde zu den wenigen Frauen, die in einem seit Jahrhunderten den Männern vorbehaltenen Beruf tätig wurden: der Juristerei. In diesem Metier brachte sie es zur ersten Gerichtspräsidenten der Bundesrepublik Deutschland.
Im Alter von 20 Jahren schrieb sich Clara Klabunde an der juristischen Fakultät der Universität Hamburg ein, studierte bis 1929 Jura und wurde dann Referendarin in der Hamburger Justizverwaltung. Im März 1933 bestand sie die juristische Staatsprüfung und beantragte die Zulassung als Anwältin. Seitdem arbeitete sie 19 Jahre als Rechtsanwältin in Hamburg. Durch die Reichsrechtsanwaltsordnung von 1935 wurde
|
Clara Klabunde als Frau, die als Anwältin arbeitete, beruflich eingeschränkt. Sie ging eine gemeinsame Sozietät mit dem Rechtsanwalt Wilhelm Drexelius ein und vertrat in der NS-Zeit politisch Verfolgte des NS-Regimes.
1934 heiratete sie den Journalisten Erich Klabunde, den sie während des Studiums an der Universität im Sozialistischen Studentenbund kennengelernt hatte. Erich Klabunde musste nach 1933 seine Arbeit aus politischen Gründen aufgeben. Nach dem Ende des Nationalsozialismus wurde er Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion und später Bundestagsabgeordneter.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Clara Klabunde ehrenamtliches Mitglied einer Reihe von Gremien. Im Rahmen der Entnazifizierungsverfahren war sie als Spruchkammervorsitzende, außerdem im beratenden Ausschuss für das Pressewesen, im Vorstand des Hamburgischen Anwaltsvereins und der Vereinigung weiblicher Juristen und Volkswirte tätig.
1950 starb Erich Klabunde. Clara Klabunde ging in den Staatsdienst und wurde Richterin. Neben dieser Tätigkeit fungierte sie 25 Jahre als Verfassungsrichterin am Hamburgischen Verfassungsgericht und gehörte außerdem lange dem Vorstand des Hamburgischen Richtervereins an.
1952 wurde Clara Klabunde zur Vorsitzenden am Landesarbeitsgericht Hamburg und zur Landesarbeitsgerichtsdirektorin berufen und war entscheidend bei der Entwicklung des damals nur teilweise kodifizierten Arbeitsrechts beteiligt, welches den sozialen Gegebenheiten der Nachkriegszeit angepasst werden musste.
Am 1. September 1966 wurde Clara Klabunde als erste Frau in der Bundesrepublik Deutschland zur Präsidentin des Landesarbeitsgerichtes ernannt - unter der Dienststellenbezeichnung "Der Präsident". Mit dieser Ernennung würdigte der Senat ihre Kenntnisse auf dem Gebiet des Arbeitsrechts. Fünf Jahre wirkte sie als Gerichtspräsidentin und trat 1971 in den Ruhestand.
Für ihre Verdienste um das Rechtswesen erhielt Clara Klabunde die Medaille für Treue Arbeit im Dienste des Volkes in Silber.
|
|
 |
 |
 |
| Marie Kortmann |
 |

Photo: Staatsarchiv Hamburg |
Lehrerin, Leiterin des Vereins zur Förderung von Frauenbildung und Frauenstudium
20.5.1851 -16.10.1937 Hamburg |
 |
Marie Kortmann, Tochter von Pauline Kortmann und Nichte Emilie Wüstenfelds unterrichtete bereits als 17-Jährige an der von ihrer Tante 1867 gegründeten Mädchen-Gewerbeschule und nutzte ihr Zeichentalent und ihre musikalische Begabung, um dort und später auch an privaten Mädchenschulen Kunstunterricht zu geben.
Wie ihre Mutter, die für den "Frauenverein zur Unterstützung der Armenpflege" tätig gewesen war, widmete sich auch Marie Kortmann diesem Verein und wurde 1914 dessen Vorsitzende. Außerdem war sie von 1898 bis 1907 Leiterin der 1895 von der "Ortsgruppe Hamburg des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins" gegründeten "Abteilung für Frauenbildung",
|
deren Ziel die Erweiterung des Mädchenbildungswesens war. Weil die Schulbehörde sowohl die Einrichtung von Latein- und Mathematikkursen zur ersten Vorbereitung auf die Oberlehrerinnenprüfung als auch die Einführung von Haushaltungsschulen mit Tages- und Abendkursen für Volksschülerinnen ablehnte, richtete die "Abteilung für Frauenbildung" selbst Latein- und Mathekurse ein und eröffnete 1898 die erste Haushaltungsschule. Marie Kortmann als Vorsitzende des "Hamburgischen Vereins zur Förderung von Frauenbildung und Frauenstudium" wirkte auch entscheidend bei der Gründung eines Realgymnasiums für Mädchen mit. Ostern 1901 wurde die erste Obertertia mit 22 Schülerinnen eröffnet. 1917 wurde das Realgymnasium in ein humanistisches Gymnasium umgewandelt. Marie Kortmann war maßgeblich bei der Beschaffung der Gelder für dieses Unternehmen beteiligt.
Marie Kortmann blieb unverheiratet und lebte mit Hanna und Dora Glinzer, die ebenfalls unverheiratet blieben, zusammen im Juratenweg 4. Dora Glinzer führte für ihre Schwester Hanna und für Marie Kortmann den gemeinsamen Haushalt.
|
|
 |
 |
 |

Photo aus: Ursel Hochmuth, Hans-Peter de Lorent (Hrsg.): Hamburg: Schule unterm Hakenkreuz. Hamburg 1985, S. 261. |
 |
Yvonne Mewes |
Lehrerin, leistete Widerstand gegen das NS-Regime
22.12.1900 - 6.1.1945 Frauenkonzentrationslager Ravensbrück |
 |
| Yvonne Mewes, Lehrerin an der Hamburger Schule Curschmannstraße, weigerte sich 1942, in der Kinderlandverschickung als Lehrerin zu arbeiten, weil sie befürchtete, dort nationalsozialistische Propaganda in ihren Unterricht einbringen zu müssen. Es folgten mehrere Versetzungen. Ihre Kündigung wurde nicht angenommen. An ihr sollte ein Exempel statuiert werden. Der Fall ging an die Gestapo, die sie in die Haftanstalt Fuhlsbüttel brachte. Dort kam sie für längere Zeit in Dunkelhaft und erhielt keine Nahrung. Einen Tag vor Weihnachten 1944 wurde sie ins KZ-Ravensbrück gebracht. Wenige Wochen später starb sie an Hungertyphus. Die Beamten der Hamburger Schulbehörde Hasso von Wedel und Ernst Schrewe, die Yvonne Mewes denunziert hatten, wurde nach der Befreiung vom Nationalsozialismus der Prozess gemacht. Hasso von Wedel wurde 1953 in 2. Instanz zu 8 Monaten Gefängnis wegen Freiheitsberaubung im Amte mit Todesfolge verurteilt. Nach dem Straffreiheitsgesetz war ihm die Strafe allerdings erlassen worden. Ernst Schrewe erhielt in einem Disziplinarverfahren wegen "Dienstvergehens" einen Gehaltsabzug.
|
|
 |
 |
 |
| Dagmar Bettina Meyer |
 |

Photo: privat |
Erste Fahrradbeauftragte der Freien und Hansestadt Hamburg
17.08.1955 Karlsruhe - 24.03.2011 Hamburg
bestattet im Garten der Frauen |
 |
| In schwierigen Verhältnissen in Karlsruhe aufgewachsen, konnte Dagmar Bettina Meyer dank der Förderung durch ihre Lehrerin das Gymnasium besuchen und ihr Abitur machen. An das Studium der deutschen und englischen Literaturwissenschaft in Konstanz und Bristol sowie der Soziologie und der Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Bonn und Hagen schloss sich ein ungewöhnlich breit gefächerter beruflicher Werdegang an. Zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Erlangen und an der Fernuniversität Hagen, kam sie letztlich über
|
die gewerkschaftliche Bildungsarbeit zur Verkehrsplanung. In der Zwischenzeit hatte sie in Planungswerkstätten mit schleswig-holsteinischen Landfrauen ebenso wie in Seminaren mit Hamburger Hafenarbeitern gearbeitet, sie war Weinhändlerin am Bodensee und nach der Wende Gewerkschaftssekretärin in Thüringen. Nach Hamburg kam sie zum ersten Mal bei der Materialsuche für ihre Dissertation; später arbeitete sie hier in einem Planungsbüro und engagierte sich kommunalpolitisch in der Bezirksversammlung Hamburg-Nord.
Eine Bewerbung bei der damaligen Hamburger Baubehörde führte 1993 schließlich zum Einstieg in die Verwaltung. Im August 1995 wurde Dagmar Bettina Meyer die erste mit politischem Einfluss ausgestattete Fahrradbeauftragte in Deutschlands zweitgrößter Stadt. Schnell wurde sie zur Pionierin im Kampf für die gleichberechtigte Anerkennung des Radverkehrs in der Stadtplanung - damals noch als einzige Frau unter lauter altgedienten Behörden-Ingenieuren. Ihre bald bundesweite fachliche Wertschätzung führte sie im Februar 2004 dann nach Berlin ins Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Hier arbeitete sie an der Entwicklung des Nationalen Radverkehrsplans mit und betreute später dessen Umsetzung. Berlin sollte ihre letzte berufliche Station bleiben. Im Jahr 2009 wurde bei ihr eine fortgeschrittene Krebserkrankung diagnostiziert. Dagmar Bettina Meyer starb im Alter von 55 Jahren in einem Hamburger Hospiz. Der Tenor der Bekundungen aus der Fachwelt war einhellig: "In ihr verlieren wir eine Persönlichkeit, die sich in besonderer Weise um die Förderung des Radverkehrs in Deutschland verdient gemacht hat."
|
|
 |
 |
 |

Photo: Staatsarchiv Hamburg |
 |
Antonie (Toni) Milberg |
Gründerin und Leiterin einer höheren Mädchenschule, der Milberg Kursusschule
13.11.1854 Hamburg - 1.9.1908 Wildungen |
 |
| Schon als Kind hatte Toni Milberg, aus einer Kaufmannsfamilie stammend, den Wunsch, Lehrerin zu werden. Nach dem Lehrerinnenexamen, 1876 am Königlichen Lehrerinnen-Seminar zu Callenberg, leitete sie im Hause des Hamburger Hauptpastors Calinich den damals für höhere Töchter üblichen Privatunterricht im kleinen Kreis - Kurse genannt - die er für seine Töchter eingerichtet hatte. Gleichzeitig machte sie ihr Vorsteherinnen-Examen und baute nach dem Tod Calinichs aus diesen und weiteren von ihr entwickelten Kursen die Milbergsche Kursusschule auf, die sich später auf einem von Toni Milberg erworbenen Grundstück in der Klopstockstr. 17 befand. Toni Milberg leitete die Schule über 25 Jahre lang zusammen mit ihrer Freundin Martha Krecke.
|
|
 |
 |
 |
| Mathilde Möller |
 |

Photo: privat |
Urheberin der Bewegungsspiele für Mädchen
20.1.1867Altona - 9.2.1925 Hamburg |
 |
| Mathilde Möller arbeitete in Hamburg als Lehrerin. In ihrer Zeit als Lehrkraft an der Mädchenvolksschule Lutterothstraße im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel hatte sie eine bahnbrechende Idee. Sie initiierte als erste Lehrkraft die Bewegungsspiele für Mädchen. So zog sie Anfang der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts mit ihren Schülerinnen in den Sternschanzenpark, um sie im Schlag- und Wurfball zu unterrichten. Das war damals ein sehr gewagtes Unterfangen. Mathilde Möller hatte schwere Kämpfe gegen die Gleichgültigkeit der Eltern wie der Kollegen und Kolleginnen aus der Lehrerschaft zu bestehen. Man hielt diese Sportübung zwar für Jungen, aber nicht für Mädchen geeignet. Doch Mathilde Möller ließ sich nicht beirren und vertrat öffentlich die Meinung, dass Mädchen diese Übungen zu ihrer Ertüchtigung viel nötiger hätten als Jungen. Der Protest gegen diese angeblich unweiblichen Sportübungen ging sogar so weit, dass Schuljungen diese Sportstunden störten, weshalb sie längere Zeit unter polizeilichem Schutz durchgeführt werden mussten. Doch im Laufe der Jahre gelang es dem von Mathilde Möller gegründeten "Verein für Jugendspiele für Mädchen" dem neuen Gedanken Verbreitung zu verschaffen. Heute sind solche sportlichen Spiele eine Selbstverständlichkeit für Mädchen und Frauen.
|
|
 |
 |
 |

Photo: privat
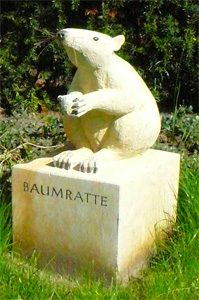
Erna Mohr beobachtete und untersuchte das Verhalten von Baumratten. |
 |
Dr. h.c. Erna Mohr |
Zoologin von internationalem Rang
11.7.1894 Hamburg - 10.9.1968 Hamburg |
 |
Im Alter von 18 Jahren nahm die Lehrerstocher am Zoologischen Museum am Steintorplatz in Hamburg eine Tätigkeit als
Spinnenzeichnerin an. Auch während ihrer späteren Arbeit als Lehrerin war Erna Mohr am Zoologischen Museum tätig.
1934 wurde Erna Mohr aus dem Schuldienst beurlaubt und übernahm die Museumsabteilung für niedere Wirbeltiere.
Sie bewies enormes didaktisches Talent bei der Neugestaltung der öffentlichen Schausammlung. 1936 übernahm Erna Mohr
auch die Leitung der Abteilung für höhere Wirbeltiere. Noch heute besteht der von ihr zusammengetragene Grundstock
der wissenschaftlichen Sammlung. Über 400 Veröffentlichungen gibt es von ihr. Ihre Manuskripte trug sie, gekleidet in
einem Lodenmantel und Wanderschuhen, in einer Plastik-Einkaufstasche zu ihren Verlegern. Erna Mohr erhielt hohe
Auszeichnungen. Sie befasste sich mit dem "Knacken" der Rentiere beim Laufen, schrieb über Ohrtaschen am Säugetierohr,
setzte sich für das vom Aussterben bedrohte europäische Wisent ein , wurde "Wisent-Mama" genannt und war die erste
Zuchtbuchführerin aller in Zoos lebenden Wisente. Sie war der erste Mensch, der Fledermausbabys mit einer Puppennuckelflasche
großzog, hielt im Zoologischen Museum Baumratten und erforschte deren Verhalten. Erna Mohr war eine der PionierInnen auf dem
Gebiet der Verhaltensforschung von Säugetieren.
|
|
 |
 |
 |
| Domenica Anita Niehoff |
 |

Photo: Günter Zint

Grabstein für Domenica Niehoff |
Kämpferin für die Rechte der Huren, Streetworkerin, St.Paulis großes Herz
3.08.1945 Köln - 12.02. 2009 Hamburg-Altona |
 |
Domenica Niehoff, Tochter einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters, wuchs bis zu ihrem 14. Lebensjahr zusammen mit ihrem Bruder in einem katholischen Waisenhaus auf. Nach einer Ausbildung als Buchhalterin heiratete sie 1962 einen Bordellbesitzer. 1972 begann sie, in der Herbertstraße auf St. Pauli als Prostituierte zu arbeiten. Sie war Inspiration und Muse für viele Künstler.
Anfang der 80er Jahre erlangte Domenica bundesweit Berühmtheit, weil sie sich öffentlich als Hure bekannte und sich als eine der Ersten für die Legalisierung der Prostitution engagierte. Ihre Berühmtheit nutzten viele so genannte Prominente zur eigenen Selbstdarstellung.
1990 stieg sie endgültig aus der Prostitution aus. Obwohl sie sich für die Akzeptanz der Huren stark machte, sah sie klarsichtig die menschenverachtenden Arbeitsbedingungen und Ausbeutungsverhältnisse in der Prostitution. "Sie war wütend auf diejenigen, die die Prostitution glorifizierten", so der Photograph Günter Zint, mit dem Domenica eng befreundet war.
1991 begann Domenica, als Streetworkerin in Hamburg-St.Georg zu arbeiten. Sie war Mitinitiatorin des Hilfsprojektes "Ragazza e.V." und betreute bis 1997 drogenabhängige Mädchen auf dem Straßenstrich.
1998 eröffnete Domenica eine Kneipe am Hamburger Fischmarkt, die sie bis zum Jahr 2000 betrieb.
Nach dem Tod ihres Bruders 2001 lebte sie in dessen Haus in Boos in der Eifel, bevor es sie 2008 wieder auf den Hamburger Kiez zurückzog. Dort wohnte sie in der Talstraße und war bis zu ihrem Tod immer wieder Anlaufstelle für Bedürftige. Sie starb an einem Lungenleiden.
Information zum Grabstein
|
|
 |
 |
 |

Bild aus einem Wahlaufruf o. J.
 |
 |
Hilge Nordmeier, geb. Stuhr |
Mitglied (SPD) der Hamburgischen Bürgerschaft
5.7.1896 Hamburg - 9.9.1975 Hamburg |
 |
Hilge Stuhr heiratete 1920 den kaufmännischen Angestellten Carl Otto Nordmeier (1890-1954). 1922 zog sie mit ihm in den Rüsternkamp 12, 1) eine Straße in der Steenkampsiedlung. "Die Steenkampsiedlung in Hamburg-Bahrenfeld ist eine als Gartenstadt nach dem Ersten Weltkrieg angelegte Siedlung, die der Versorgung von Familien mit geringem Einkommen und Kriegsheimkehrern mit Wohnraum dienen sollte." 2) Carl Nordmeier gehörte zu den Gründungsmitgliedern dieser Heimstättenvereinigung und war viele Jahre im Vorstand. 3)
Nach ihrer Heirat wurde Hilge Nordmeier Hausfrau. Das Paar blieb kinderlos.
Hilge Nordmeier und ihr Mann gehörten der SPD an. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus gehörte Hilge Nordmeier als SPD-Abgeordnete der ersten frei gewählten Hamburgischen Bürgerschaft nach dem zweiten Weltkrieg an (Oktober 1946 bis August 1949).
Gewählt wurden 17 Frauen und 93 Männer. 15 Frauen gehörten der SPD, eine der KPD und eine der FDP an. Zehn der Frauen bezeichneten sich als "Hausfrau". Diese Einstufung entsprach dem als "natürlich" geltenden traditionellen Rollenverständnis, das die Frauen zu diesem Zeitpunkt nicht hinterfragten, war doch die Funktion der Hausfrau entscheidend für das Überleben und dadurch im öffentlichen Bewusstsein auch als gesellschaftlich wichtig anerkannt.
Nach dem Ende der ersten Wahlperiode |
wurde Hilge Nordmeier in die Bezirksversammlung Altona gewählt, der sie von 1949 bis 1961 angehörte.
Quellen:
1) Vgl.: Bettina Herrmann: Hilge Nordmeier, in: Die Steenkamper vom 21.6.2020, unter: https://www.steenkamper.de/
2) Wikipedia: Steenkampsiedlung, abgerufen: 25.6.2020 unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Steenkampsiedlung
3) Vgl.: Bettina Herrmann, a. a. O.
|
|
 |
 |
 |
| Hermine Peine, geb. Kreet |
 |

Photo: privat |
Bürgerschaftsabgeordnete, Mitbegründerin der AWO Hamburg
19.9.1881 Hamburg - 19.8.1973 Hamburg |
 |
| Schon vom Elternhaus her war Hermine Peine seit Kindertagen vertraut mit gewerkschaftlichen und politischen Fragen. Ihr Vater, der Schneider Heinrich Kreet, geboren 1837 in Adensen bei Hannover, hatte sich Ende der 1850er Jahre in Hamburg niedergelassen und sich politisch im Allgemeinen deutschen Arbeiterverein engagiert. Bereits 1865 wählten ihn die Kollegen in die Verwaltung der Kranken- und Unterstützungskasse der Schneider, und er wurde 1887 Bevollmächtigter des Krankenunterstützungsbundes. 1902 wurde er zum Vorsitzenden des Verbandes der Schneider gewählt. Am 26. Januar 1897 leistete Heinrich Kreet den Hamburger Bürgereid.
|
Wahrscheinlich in zweiter Ehe heiratete er Luise, geb. Wellhöfer (1852-1928) aus Großrudestadt (Sachsen-Weimar), die Mutter von Hermine. 1895 lebte die Familie in der Wexstraße 13, danach bis 1900 in der Fuhlentwiete 13, ab 1902 in der Düsternstr. 53, wo Heinrich Kreet am 14.2.1916 verstarb.
Hermine Peine lernte nach Beendigung der Volksschule (1888-1896) in Oldenburg ein Jahr Haushalt und arbeitete bis zur Eheschließung als Hausangestellte. Am 11. April 1902 heiratete sie den Schneidermeister Andreas Friedrich [K]Carl Peine (1871-1939) aus Erxleben. Sie lebten zuerst in der Neuen ABC-Straße, dann in der Kleinen Rosenstraße und ab ca. 1933 in der St. Georgstraße 6. Das Paar hatte zwei Kinder: Hertha (1906-1982) und Kurt (1908-1991).
Am 20.10. 1905 leistete Andreas Peine den Hamburger Bürgereid und am 16.10.1907 erhielt er seine Gewerbeanmeldung als selbstständiger Schneider. Er starb am 27.1.1939.
Hermine Peine war seit 1908 Mitglied der SPD. Von 1922 bis 1929/30 saß sie als Beisitzerin im Vorstand der SPD (Vorsitz: Leuteritz). 1924 wurde sie für die SPD Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft und gehörte ihr bis 1933 an.
Hermine Peine engagierte sich ehrenamtlich in der Sozialfürsorge. Sie war in den Notjahren nach dem Ersten Weltkrieg als Sozialfürsorgerin tätig und gehörte seit 1919 der Deputation der Wohlfahrtsbehörde und dem Ausschuss für die staatlichen Heimeinrichtungen an. 1920 war sie Mitbegründerin des "Hamburger Ausschusses für soziale Fürsorge" (Arbeiterwohlfahrt/AWO). Durch ihre Arbeit in sozialen Ausschüssen kannte sie die Situation der Armen und Alten in den Heimen und Stiften und setzte sich intensiv für eine würdige Unterbringung alter Menschen ein, von denen viele durch die Wirtschaftskrise und deren Folgen veramt waren. (vgl.: StA.351-101-Signatur StW 26. 10 und 26.13).
Im Juli 1929 übernahm sie die Leitung des staatlichen Altersheims in Groß Borstel. Es war das erste staatliche Altersheim, das von der Stadt Hamburg errichtet wurde. Es bot den Bewohnerinnen und Bewohnern abgeschlossene Ein- und Zweizimmerwohnungen mit Kochgelegenheit, eine Neuerung für damalige Zeiten.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde Hermine Peine politisch verfolgt. 1934 durchsuchte die Gestapo ihre Wohnung. Ein Jahr zuvor war sie am 28. Juni 1933 aus ihrem Dienst entlassen worden und war fortan arbeitslos. Drei Jahre lang lebte sie von Arbeitslosenunterstützung. Danach konnte sie sich finanziell nur dadurch über Wasser halten, weil sie Untermieter in ihrer Wohnung aufnahm und ihre Kinder sie unterstützten.
1940 begann gegen Hermine Peine ein Prozess wegen "Wehrkraftzersetzung", der eingestellt wurde, weil die gegen sie erhobenen Vorwürfe nicht bewiesen werden konnten.
1939 war Hermine Peine in die Lübeckerstraße 31 gezogen, wo sie in der Nacht vom 27./28.7. 1943 ausgebombt wurde.
Nach dem missglückten Attentat auf Hitler war Hermine Peine im August 1944 als "politisch unzuverlässig" für zehn Tage im KZ Fuhlsbüttel inhaftiert.
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus engagierte sich Hermine Peine wieder in der Hamburger Arbeiterwohlfahrt und war seit 1945 deren stellvertretende Vorsitzende.
Die Britische Militärregierung setzte sie zum 1. September 1945 wieder als Leiterin des Altersheims in Groß Borstel ein. Diese Funktion hatte sie bis zu ihrer Pensionierung im Jahre 1949 inne.
Nach ihrer Pensionierung zog Hermine Peine, die seit September 1945 in einer Dienstwohnung an der Borsteler Chaussee 301 gewohnt hatte, in eine Einzimmerwohnung am Kreuzweg 2. 1965 bezog sie ein Zimmer im Altenheim Groß Borstel, wo sie bis zu ihrem Tod am 19.8.1973 lebte, das letzte Jahr auf der Pflegestation..
Für ihre Verdienste erhielt Hermine Peine am 29.3.1949 die "Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes" in Bronze.
Text: wesentliche Inhalte von Ingrid H. Verch
Quelle:
Vgl: AWO Landesverband Hamburg: Arbeiterwohlfahrt in Hamburg. Eine Idee setzt sich durch - exemplarisch dargestellt an bedeutsamen Frauen der AWO. Hamburg 2015.
|
|
 |
 |
 |

Photo: privat |
 |
Rosamunde Pietsch |
Leiterin der weiblichen Schutzpolizei Hamburg, Polizeihauptkommissarin
20.2.1915 - 19.5.2016 |
 |
Johannes-Brahms-Platz 1
Kirchenallee Polizeirevier
Eine der ersten Polizistinnen der "weiblichen Polizei" war Rosamunde Pietsch. Als 1945 der erste Lehrgang für die neu einzurichtende Abteilung der uniformierten weiblichen Schutzpolizei einberufen wurde, gehörte sie dazu.
Die Polizeiabteilung "weibliche Schutzpolizei", die 1945 auf Intervention der britischen Militärregierung eingerichtet worden war, hatte damals ihren Sitz im 9. Stock das DAG-Hauses am Johannes-Brahms- Platz 1. Dort residierte damals die Innenbehörde.
Die Leitung der "weiblichen Schutzpolizei" übernahm Miss Sofie Alloway.
|
Die nach dem Vorbild von Scotland Yard geführte "Weibliche Schutzpolizei" hatte ihre Aufgabengebiete im Jugendschutz, in der Gefahrenabwehr für Minderjährige, in der Ahndung von Sittlichkeitsdelikten und in der Verfolgung von Straftaten Jugendlicher unter vierzehn Jahren sowie Straftaten von Frauen.
"Rosamunde Pietsch wollte wie ihr Vater zur Polizei gehen. Ihr Ausbildungswunsch blieb unerfüllt, weil der Vater als SPD-Mitglied nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 seinen Beruf verlor und nur eine kleine Pension erhielt, die für eine Familie mit drei Kindern nicht ausreichte. Außerdem wurde er 1934 auch noch von den Nazis verhaftet. Die Mutter ging Reinemachen und auch Rosamunde, als älteste Tochter, musste mitverdienen. Sie arbeitete als Hausgehilfin in verschiedenen Stellungen und während des Zweiten Weltkrieges in einer Munitionsfabrik, dem Hanseatischen Kettenwerk.
Der Vater war, fast 60jährig, gegen Kriegsende noch zur Wehrmacht einberufen worden. Als Unbelasteter wurde er nach der Befreiung vom Nationalsozialismus sofort aus Dänemark zurückgeholt, um in Hamburg beim Aufbau der deutschen Polizei mitzuhelfen. Dadurch erfuhr Rosamunde, dass die Engländer eine weibliche Schutzpolizei nach englischem Muster einrichten wollten. Bereits im August 1945 konnte sie sich zur Ausbildung melden. Für die Bewerbung gab es keine Altersgrenzen. Die einzige Bedingung war, vom Nationalsozialismus "unbelastet" zu sein und möglichst eine sozialfürsorgerische Ausbildung genossen zu haben. Rosamunde Pietsch hatte eine Ausbildung an einer Hauswirtschaftlichen Frauenfachschule absolviert.
Seit 1927 gab es in Hamburg eine kleine Zahl von Kriminalbeamtinnen, die nach 1945 weiter im Amt blieben. Eine von ihnen übernahm nun die Auswahl von 30 Anwärterinnen für die weibliche Schutzpolizei. Viele der Ausbildungsbewerberinnen hatten sich gemeldet, um ein Dach über den Kopf und eine warme Mahlzeit zu bekommen. Es waren Flüchtlinge aus dem Rheinland und Krankenschwestern, die aus irgendwelchen Lazaretten kamen. Ihnen gegenüber hatte Frau Pietsch als Hamburgerin durch die Anbindung an ihre Familie gewisse Vorteile.
Am 25. Oktober traten die 30 Frauen auf dem Kasernenhof Zeisestraße in Altona zur Einberufung an. Jede erhielt ihren Namen mit einer Sicherheitsnadel angeheftet. Der englische Oberst musterte alle von Kopf bis Fuß; es ging zu wie beim Militär. Die Polizeischülerinnen mussten die Kleidung selbst mitbringen: Baskenmütze, Trainingshose, Schuhe und Handschuhe. Die Frauengruppe war in einem wiederaufgebauten Kasernenblock untergebracht, in dem es feucht und kalt war; Wolldecken für die Betten gab es nicht. Unter den 300 Anwärtern waren die 30 Frauen in der Minderzahl. Sie erhielten die gleiche Ausbildung wie die Männer. Es gab keine reinen Frauenklassen; je 5 Schülerinnen wurden einer Klasse zugeteilt. In acht Wochen lernten sie das Wichtigste über Festnahme, Inverwahrnahme, Strafprozeßordnung, Anordnung einer Untersuchung. (…)
Nach Beendigung des Lehrgangs wurden je zwei der Polizistinnen einer Revierwache zugeteilt. Untergebracht warehn sie zunächst bei der weiblichen Kriminalpolizei auf der Drehbahn, später zogen die Schutzpolizistinnen um in die Kirchenallee. Zuerst wurden sie in Zivil eingesetzt, bis im November 1946 die Uniformen ankamen. (…)
Das Einsatzgebiet von Frau Pietsch war die Umgebung des Hauptbahnhofs mit den verschiedenen Bunkern (…). Besonders berüchtigt war die Jahnhalle, eine große Turnhalle, die sich dort befand, wo heute die Busse abfahren. Mitten durch die Halle führte eine ‚Wolldeckenallee': an aufgespannten Wäscheleinen hingen Betttücher und Wolldecken, dahinter lebten Familien, ebenfalls durch Decken voneinander abgetrennt. Wenn Personen wegen Haftbefehls gesucht wurden, mussten immer zuerst die Bunker durchgekämmt, die Ausweise kontrolliert werden, nachts mit Taschenlampen. Morgens saßen die beiden Polizistinnen zusammen mit ihren männlichen Kollegen in der Revierwache am langen Tresen, dann kamen auch schon Bunkerinsassen, barfuß, eine Wolldecke umgehängt, und erstatteten Anzeige darüber, was man ihnen in der Nacht gestohlen hatte.
Die Lokale am Hauptbahnhof, Reichshof, Europäischer Hof, waren unbeschädigt und von den Engländern besetzt. Davor fanden sich von frühmorgens an Scharen von Kindern ein, die die Engländer anbettelten, Kippen sammelten, um zu Hause den Tabak herauszunehmen und auf dem Schwarzmarkt zu bringen. Die Engländer wiesen die Polizei an, diese Belästigung abzuschaffen. Ja, aber wie? Als die Polizistinnen noch keine Uniform hatten, kam es immer wieder zu großen Aufläufen, wenn sie ein Kind erwischt hatten und dieses wie am Spieß schrie. Bis sie dann ihren Ausweis hervorgekramt hatten, war das Kind entwischt. (…)
Ähnlich war es beim Kohlenklau. Man wusste, dass die Kohlenzüge über Tiefstaak durch den Hamburger Hauptbahnhof fuhren. Da standen dann überall strafunmündige Kinder, von ihren Eltern geschickt, um für die Familie zu sammeln. Wie war da dem Befehl zur Verhinderung des Kohlediebstahls nachzukommen? In Gewissenskonflikte kamen die Polizistinnen ebenfalls bei der Jagd auf Hamstergut. Frau Pietsch empfand es als reine Schikane, wenn sie zusehen mussten, wie die Engländer ‚das in die Elbe schütteten'. Obendrein wurde die deutsche Polizei von ihren Landsleuten beschimpft.
52 Wochenstunden arbeiteten die Polizistinnen. Zum Streifendienst mussten sie sich beim Wachhabenden melden und wurden dann eingeteilt: Kinder und Jugendliche aufgreifen und zur Wache bringen. Nach zwei Stunden meldeten sie sich zurück, zogen schnell Zivilkleider an, um den Kriminalbeamtinnen zu helfen. Meist ging es um kleine Kriminalfälle in den Laubenkolonien: Apfelklau, Holzklau (…). Danach hetzten sie wieder zur Wache, wieder zwei Stunden Streife (…). Dazu kam schichtweise eine ganze Woche sehr anstrengender Nachtdienst von einem Sonntagabend bis zum nächsten; am Montag begann die Spätschicht um 16 Uhr. Die Schwerstarbeiterkarte, die Polizistinnen zustand, wies 50 gr Fleisch, 50 gr Butter, 100 gr Weißbrot auf. Zum Hunger kam der Mangel an Hygiene. Bei ihren Streifen durch die Lager fing sich Frau Pietsch Läuse, die sich ein einmal mit Petroleum loswurde.
Mit der britischen Militärregierung ergab sich eine besondere Art der Zusammenarbeit im Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten. Den Polizistinnen fiel die Aufgabe zu, die bei den Razzien festgenommenen Frauen zur Untersuchung zu bringen. Eine Kollegin von Frau Pietsch wurde für mehrere Wochen verpflichtet, mit den Engländern Streife zu gehen. Sie fureh dann irgendwohin, z. B. vor die Staatsoper, griffen zehn bis fünfzehn Frauen auf und führten sie einfach ab zur Untersuchungsstelle Altona. Die Betroffenen protestierten und schimpften, beschimpften auch die deutsche Polizistin. Frau Pietsch erinnert sich daran, dass bei jeder Fuhre eine bis zwei Kranke waren. Die Gesunden wurden sofort wieder entlassen, mit den Kranken fuhren die Polizistinnen, in Begleitung der Engländer, ins Krankenhaus Ochsenzoll. Die deutschen Polizistinnen mussten auch hin und wieder bei der Besatzungsmacht arbeitende deutsche Zivilangestellte nach Schmuggelware - Kakao, Kaffee, Schinken (…) - durchsuchen. Und wieder wurden sie beschimpft.
Auch bei Schwarzmarktrazzien in den Zentren Talstraße, bremer Reihe, Eppendorfer Park, wurden Polizistinnen eingesetzt. Eine Kollegin von Frau Pietsch erhielt Disziplinarstrafe, weil sie einer weinenden Frau mit Kind das beschlagnahmte Päckchen Zigaretten wieder zurückgegeben hatte. All dieses war höchst unangenehm (…).
1948 wurde Frau Pietsch als einzige Frau zusammen mit 48 Männern für die höhere Beamtenlaufbahn ausgesucht. Die Ausbildung dauerte 5 Jahre. [1953 war Rosamunde Pietsch die einzige Frau, die als Kommissarin ausgebildet wurde. 1954 avancierte sie zur Leiterin der 45 Frauen starken "Weiblichen Schutzpolizei" und gründete 1961 die so genannte Jugendschutztruppe. Mit jeweils einem Erzieher brachten sie "Ausreißer" nach Hause und durchsuchten Lokale auf dem Kiez nach Jugendlichen. 1975 schied Polizeihauptkommissarin Rosamunde Pietsch, die seit 1933 bis zu ihrem Tod Mitglied der SPD war, aus dem Polizeidienst aus. Dreizehn Jahre später löste sich die "Weibliche Schutzpolizei" als eigene Dienststelle auf.]
Die erfolgreiche Arbeit der Polizistinnen in diesem Bereich war einer der Gründe für den Senatsbeschluss 1978, den Polizeidienst für Frauen in Hamburg vollständig zu öffnen.
Rückblickend lautete das Urteil von Rosamunde Pietsch: Die Polizistinnen haben die Vorstellung von der Polizei als rein männliche Institution verändert. Hamburg hat die weibliche Schutzpolizei beibehalten, weil sie gut war. Polizistinnen wussten besser mit eingelieferten betrunkenen, randalierenden Frauen umzugehen, haben sie nicht zusätzlich provoziert, wie Männer das gewohnt sin dzu tun. Frauen können auch ‚umhertreibende' Mädchen besser verstehen, verletzte Kinder einfühlender vernehmen. Was Frau Pietsch in den turbulenten Nachkriegsjahren gelernt hat, wies ihr die Richtung für ihre spätere Arbeit, die sie vor allem dem Jugendschutz gewidmet hat, verstehend, vorbeugend, helfend." 1)
Der "Weiblichen Schutzpolizei" waren Streifengänge mit männlichen Kollegen der Revierwachen verboten. Auch durften die Polizistinnen weder den Straßenverkehr regeln noch einen Streifenwagen fahren. Sie mussten ihren Dienst zu Fuß versehen, und es war ihnen nicht erlaubt, eine Waffe zu tragen, weil sie daran nicht ausgebildet wurden. Eine Änderung trat erst 1976 ein, nachdem sich eine Beamtin der Wache St. Pauli über die Vorschriften hinweggesetzt hatte: Bei einem Streifengang mit ihrem Kollegen hatte sie einen Streit zwischen drei - wie es damals hieß - "Südländern" und einem Taxifahrer beobachtet. Als ihr Kollege eingreifen wollte, zog einer der "Ausländer" eine Pistole. Erst der lautstarke Einsatz seiner Gummiknüppel schwingenden Kollegin rettete den Polizisten aus seiner Bedrängnis und bewirkte einen Antrag auf gleichberechtigte Ausbildung aller Polizistinnen an der Waffe. Doch nicht alle waren mit dieser Neuerung einverstanden.
Viele männliche Kollegen diskriminierten die an der Waffe ausgebildeten Polizistinnen als "Flintenweiber".
Quelle:
1) Werkstatt der Erinnerung (WdE)/Fst 42, Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg. Abgedruckt in: Inge Grolle: Frauen nach dem Krieg 1945-1950. Geschichte - Schauplatz Hamburg. Hamburg 1994, S. 40-41.
|
|
 |
 |
 |
| Johanne Reitze geb. Leopolt |
 |

Bild: AdsB/Friedrich-Ebert-Stiftung |
Führende Funktionärin der sozialdemokratischen Frauenbewegung
16.1.1878 Hamburg - 22.2.1949 Hamburg |
 |
Johanne Reitze entstammte einer Arbeiterfamilie. Nach dem Besuch der Volksschule arbeitete sie als Dienstmädchen, später als Arbeiterin in einer Druckerei. Dort lernte sie Kollegen und Kolleginnen kennen, die sie mit der Arbeiterbewegung vertraut machten, so dass Johanne Reitze 1902 den Entschluss fasste, in die SPD einzutreten. Zwei Jahre zuvor hatte sie den sozialdemokratischen Journalisten Johannes Carl Kilian-Reitze geheiratet. Auch er wird ihren politischen Weg beeinflusst haben. Gemeinsam besuchten sie 1904 für ein halbes Jahr die SPD-Parteischule in Berlin.
|
Von 1908 bis 1919 war Johanne Reitze Vorstandsmitglied im Landesvorstand der Hamburger SPD und bis 1931 regelmäßig Delegierte bei den SPD-Frauenkonferenzen und SPD-Parteitagen auf Reichsebene. Während des Ersten Weltkrieges engagierte sie sich besonders in der Kriegshilfe, nachdem die SPD-Reichstagsfraktion für die Bewilligung der Kriegskredite gestimmt und die Genossinnen zu einer "allgemeinen Hilfsaktion" aufgerufen hatte. Diese Aufforderung entsprach der Burgfriedenspolitik, die die Mehrheit in der SPD-Führung seit Kriegsbeginn in dem Glauben betrieb, Deutschland führe einen "Verteidigungskrieg gegen den russischen Despotismus".
Johanne Reitze fungierte als Beiratsmitglied des Hamburger Kriegsversorgungsamtes sowie des Speiseausschusses der Kriegsküchen und arbeitete für die Kriegsfolgehilfe und die Kriegshinterbliebenenfürsorge.
Von 1919 bis 1921 war sie Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, von 1919 bis 1933 Mitglied des reichsweiten SPD-Parteiausschusses.
Ein Höhepunkt ihrer Parteikarriere war die 1919 erfolgte Wahl in die Nationalversammlung. 310 Frauen waren für die Wahl aufgestellt worden. Neben Johanne Reitze wurden noch weitere 36 Frauen und 386 Männer gewählt. Aus dem Wahlkreis Hamburg kamen neben Johanne Reitze noch vier Männer. Bis 1928 blieb Johanne Reitze die einzige weibliche Reichstagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Hamburg. Sie gehörte von 1919 bis 1932 als Abgeordnete des Wahlkreise Hamburg dem Reichstag an.
Die Hauptbetätigungsfelder der Politikerinnen waren die "angestammten" so genannten Frauenbereiche wie Sozialpolitik, Wohlfahrtspflege, Jugend-, Gesundheits- und Schulpolitik. Dadurch war es den Politikerinnen nicht möglich, auf allen Politikfeldern die Interessen der Frauen einzubringen. Die "Große Politik" richtete sich weiter nach den Interessen der männlich dominierten Gesellschaft.
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde Johanne Reitze 1944 von der Gestapo verhaftet und kam in "Schutzhaft". Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie am Wiederaufbau der Arbeiterwohlfahrt beteiligt.
|
|
 |
 |
 |
 |


Photos: privat |
 |
Gerda Rosenbrook-Wempe |
Widerstandskämpferin, Archivarin, Privatlehrerin
19.11. 1896 - 24.11. 1992 |
 |
Ihre frühe Kindheit verbrachte Gerda Wempe, Tochter von Frieda und Gerhard D. Wempe, mit vier Geschwistern in Oldenburg. Nach dem Tod der Mutter änderte sich das Leben der 7-Jährigen. Ihr Vater heiratete wieder und zog mit der Familie nach Hamburg. Dort eröffnete er im Schulterblatt ein Goldwaren- und Uhrengeschäft und ließ zu, dass seine zweite Frau die drei jüngsten Kinder aus der zum Laden gehörenden geräumigen Parterrewohnung in den Keller verbannte. Tagebucheintrag von Gerda Rosenbrook-Wempe: "Dieser Keller war unsere Welt, hier haben wir gefroren, gehungert, schwer gearbeitet und viel geweint. ... ein liebes Wort haben wir weder im Hause noch in der Schule je gehört." 1) Gerda Wempe hätte gern das Abitur gemacht. Doch der Vater ließ sie in seiner Firma arbeiten. 2)
1928 heiratete sie den Mathematiklehrer Dr. Curt Rosenbrook. Er war kriegstraumatisiert, die Ehe blieb kinderlos. Vier Jahre später trennten sich die Eheleute ohne Scheidung.
1937, dem Jahr, in dem die Fa. Wempe als nationalsozialistischer Musterbetrieb ausgezeichnet wurde, 3) lernte die inzwischen verwitwete Gerda Rosenbrook Walter Funder kennen, einen Freigeist und Publizisten, der schon vor Hitlers Machtübernahme Schriften gegen den Antisemitismus verfasst und veröffentlicht hatte. Konspirativ leistete das Paar Widerstand: Es verfasste kritische Flugblätter und warf sie nachts in Briefkästen immer anderer Hamburger Haushalte und anderer Wohnviertel. In Gerda Rosenbrooks Haus trafen sich Gleichgesinnte, um über das Unrechtsregime zu diskutieren.
|
Dem Verlangen ihres älteren Bruders, seit dem Tod des Vaters Inhaber der Fa. Wempe, sich von ihrem Lebensgefährten zu trennen, widersetzte sich Gerda Rosenbrook. 4) Nur noch einmal sahen sich die Geschwister: 1944 beim Prozess gegen Walter Funder, sie als Zeugin der Verteidigung, er als Zeuge der Anklage. Diese lautete: "Vorbereitung des Hochverrats". 5)
Funder war am 1.8.1943 gemeinsam mit dem Künstler Hugo Meier-Thur verhaftet worden. Letzterer, Professor am Lerchenfeld, war längst im KZ Fuhlsbüttel ermordet worden, als man Funder den Prozess machte, wegen der schlechten Beweislage nicht vor dem Volksgerichtshof in Berlin, sondern vor einem Hamburger Gericht. Funder erhielt eine Gefängnisstrafe, zeitweise saß er sie in KZs ab. 6) Wenn möglich, reiste Gerda Rosenbrook ihm nach, versuchte, ihm die Haft zu erleichtern. Im März 1945 wurde er freigelassen, körperlich ein Wrack, seelisch gebrochen.
Nach dem Krieg hörten die Verleumdungen gegen Walter Funder nicht auf. Alte Feinde wollten ihn für unzurechnungsfähig erklären lassen, um ihn mundtot zu machen. Gerda Rosenbrook half ihm, sich dagegen erfolgreich zu wehren. Rehabilitierung und Wiedergutmachung blieben ihm jedoch versagt. Walter Funder starb als vorbestrafter Mann 1960. Gerda Rosenbrook überlebte ihn um 32 Jahre, ordnete Korrespondenzen und Prozessakten und gab sie an die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg weiter. Die Verabschiedung des Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile erlebte auch sie nicht mehr. Es annullierte Jahrzehnte nach seinem Tod das Urteil gegen Walter Funder.
Als ihre schönste Zeit bezeichnete sie das Lernen fürs Abitur als Externe: Im Alter von gut dreißig Jahren hatte sie sich zur Abiturprüfung gemeldet und war mündlich in Mathematik durchgefallen. Erst als Rentnerin erfüllte sich ihr Wunsch zu unterrichten. Gratis gab sie Stunden in Latein, Englisch, Französisch und Geschichte. Allen, die ihr begegneten, brachte sie politisches Wissen nahe. Kurz vor ihrem Tod schrieb sie: "Das Gespräch ist mir das Wichtigste in meinem Leben."
Text: Regina Deertz, Iris Pompesius, Brigitte Wempe
Quellen:
1) Tagebuchaufzeichnungen
2) Tagebuchaufzeichnungen
3) Wikipedia unter:
a. Gerhard D. Wempe - Unternehmensgeschichte
b. Kategorie: Nationalsozialistischer Musterbetrieb - Gerhard D. Wempe
4) Tagebuchaufzeichnungen und Ordner in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg (FZH)
5) Anklageschrift und Urteil beim HOLG, AZ: O.Js. 9/44
6) Tagebuchaufzeichnungen - Ordner in der FZH
|
|
 |
 |
 |
| Prof. Dr. med. Thea Louise Schönfelder |
 |

Photo: privat |
Psychiaterin und Hochschullehrerin. Erste Frau, die in Deutschland auf einen Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie berufen wurde
16.2.1925 Hamburg - 25.7.2010 Hamburg
bestattet im Garten der Frauen |
 |
| Thea Louise Schönfelder wurde in Hamburg als Tochter des damaligen sozialdemokratischen Innensenators Adolph Schönfelder und seiner Frau Minna geboren. Ihre Jugend stand unter dem Zeichen der Verfolgung ihres Vaters durch das nationalsozialistische Regime, und die Erfahrung der Gefährdung ihrer Familie blieb für sie lebensgeschichtlich prägend.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges studierte Thea Louise Schönfelder Medizin und wurde 1957 Fachärztin für Psychiatrie.
|
| 1970 wurde sie, als erste Frau in Deutschland, auf den neu geschaffenen Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf berufen, den sie bis zu ihrer Emeritierung innehatte. Dank ihres Einsatzes wurde 1971 zusätzlich zur bestehenden Kinderstation eine Jugendstation eingerichtet. Schwerpunkte ihrer klinischen Arbeit waren zum einen familientherapeutisch orientierte Behandlungsansätze, zum anderen körper- und symbolbezogene Therapiemethoden (Konzentrative Bewegungstherapie), mit deren Hilfe es ihr möglich war, Zugang zur inneren Welt auch verschlossenster Patientinnen und Patienten zu finden und Kontakt und Verständigung mit gänzlich verstummten Menschen herzustellen.
Ihre Arbeit mit Familienskulpturen bereitete den Weg für die heutige Technik der Familien- und Systemaufstellung.
1987 zog sich Thea Louise Schönfelder aus ihren institutionellen Aufgaben in ein selbstbestimmtes Privatleben zurück. Sie war weiterhin in Fortbildung und Supervision tätig, zusätzlich entfaltete sie neue Interessen und Tätigkeitsbereiche: sie beschäftigte sich intensiv mit Kreativem Schreiben, leitete dazu Seminare in der Seniorenakademie, sang im Chor der Seniorenkantorei St. Nikolai und wirkte in Altentheater-Projekten am Deutschen Schauspielhaus und am Ernst-Deutsch-Theater mit. Dabei setzte sie sich bewusst und gestalterisch mit dem Prozess des Alterns und dem Tod auseinander.
Sie war vielen Menschen eine zuverlässige, warmherzige Freundin und kluge Beraterin. Voll Freude lebte sie ihre Rolle als Großmutter. Sie hinterlässt eine Spur aus Liebe.
|
|
 |
 |
 |

Photo: privat |
 |
Hanna Schüßler |
Leiterin des Evangelischen Frauenwerks Hamburg, Begründerin der Hamburger Familienbildungsstättenarbeit
23.5.1909 Rüstern/Liegnitz - 26.6.1985 Hamburg |
 |
| Hanna Schüßler entstammte einem Pastorenhaushalt. Nach dem Abitur absolvierte sie bis 1930 eine kirchliche Ausbildung im Burckhardthaus Berlin-Dahlem und lernte die kirchliche Frauenarbeit kennen. Von 1933 bis 1934 widmete sie sich als Pfarrgehilfin in einer Berliner Kirchengemeinde der Jugendarbeit. Hanna Schüßler lehnte die "Deutschen Christen", die eine rassistische, antisemitische und am Führerprinzip orientierte Strömung im deutschen Protestantismus waren, ab. Nachdem Hanna Schüßler 1934 eine Veranstaltung der "Bekennenden Kirche", eine Oppositionsbewegung evangelischer Christen gegen Versuche einer Gleichschaltung von Lehre
|
| und Organisation der Deutschen Evangl. Kirche in der NS-Zeit, besucht hatte, wurde sie bedrängt, den "Deutschen Christen" beizutreten. Sie weigerte sich und erhielt die fristlose Kündigung. Hanna Schüßler verließ Berlin und trat 1935 in Hamburg die Stelle als Leiterin der Landesstelle Hamburg des Burckhardthauses an, des größten deutschen Verbandes weiblicher Jugend. Diese Funktion hatte sie bis 1958 inne. Ihre schriftlichen Ausarbeitungen, die sie für die Bibelarbeit mit Heranwachsenden verfasste, führten mehrfach zu Verhören durch die Gestapo. Von 1947 bis 1956 leitete sie den Aufbau des Evangelischen Mädchenpfadfinderbundes der BRD, dessen erste Vorsitzende sie von 1949 bis 1953 war. Ab 1948 fungierte sie für 30 Jahre als Kirchenvorsteherin in der Hauptkirche St. Katharinen. 1952 beteiligte sie sich federführend an der Eröffnung und Führung des "Hauses der Offenen Tür", eines kirchlichen Klubheimes für Jugendliche in der Sierichstraße. Im selben Jahr übernahm sie Ausbau und Leitung des "Evangelischen Frauenwerkes der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate". Diese Funktion behielt sie bis zum Eintritt in den Ruhestand 1974 inne. Gleichzeitig war sie bis 1958 Leiterin des Evangelischen Jugendwerkes, außer-dem von 1952 bis 1976 Synodale der Synode der Hamburgischen Landeskirche und ab 1953 Deputierte der Hamburger Jugendbehörde. Zwischen 1953 und 1958 amtierte sie als Vorsitzende des Arbeitskreises für Jugendgildearbeit, welcher sich an Jugendliche wandte, die aus der sowjetisch besetzten Zone nach Hamburg kamen. Darüber hinaus widmete sie sich der Müttergenesungsarbeit und koordinierte sowie organisierte in Hamburg mit anderen die jährl. Sammlungen. Auch war sie maßgeblich an der Einrichtung der Mütterkurheime in Dahmeshöved/ Ostsee und Bispingen/ Lüneburger Heide beteiligt. Hanna Schüßler sorgte durch ihr kirchliches und politisches Engagement für eine Vernetzung zwischen den Organisationen und Trägern, deren ehrenamtliches Mitglied, deren Leitung, Vorstand oder Präsidentin sie war. Alle diese Tätigkeiten wiesen auf ein Ziel Hanna Schüßlers hin, die Arbeitsbereiche der Frauen- und Jugendarbeit, an der sie beteiligt war, an einem Ort zusammenzuziehen. Deshalb forderte sie 1956 auf der Landeskirchlichen Synode einen zentralen Ort für die Arbeit. 1959 war es dann so weit: Im Mai wurde das "Haus der Frau" im von der Evangelischen Kirche erworbenen Haus am Loogeplatz 16 eingeweiht. Hier erfolgte eine Zusammenführung und Zentralisierung aller Aktivitäten, Funktionen, Tätigkeiten und Ämter. 1974 ging Hanna Schüßler in den Ruhestand. Ein Jahr später wurde ihr das Bundesverdienstkreuz überreicht
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Adele Schwab, geb. Mennerich, Buchpseudonym Lexa Anders |
Diakonisse, Sozialfürsorgerin, Buchautorin
14.6.1907 Hamburg - 30.7.1991 Hamburg |
 |
Adele Schwab äußerte über ihr Leben: "Mein Leben verlief in stark ansteigenden und steil abfallenden Linien, unter viel Krankheitsnot und manchen inneren Kämpfen. Menschen, zu denen ich aufgesehen hatte im Leben, wurden mir genommen, auf dass Jesus mir alles würde. Er erfüllt meinen Alltag mit dankbarer Freude!"
Adele Mennerich wuchs gemeinsam mit ihrer älteren Schwester in Hamburg in der Heinrich-Hertz-Straße 118 auf. Ihre Mutter betrieb ein Handarbeitsgeschäft. Adele war handwerklich begabt, besuchte neben dem regulären Schulunterricht die Kunstgewerbeschule und fertigte noch zu Schulzeiten Bastpuppen an, für deren Herstellung sie ein Patent erwarb. Diese Erfindung half der Familie durch die schweren Zeiten der Wirtschaftskrise.
|
Im Alter von zwölf Jahren entschied sich Adele bewusst für Christus. Ihr geistiges Zuhause fand sie in der Freien evangelischen Gemeinde in Hamburg am Holstenwall. Auch ihre Eltern sowie ihre Schwester Olga stellten sich in den Dienst des diakonischen Werkes innerhalb der Freien evangelischen Gemeinde.
Nach der Schulentlassung 1922 wurde Adele Mennerich auf Anraten des Leiters der Freien evangelischen Gemeinde, der gleichzeitig auch Direktor des Hamburger Krankenhauses "Elim" war, Diakonisse. Im März 1935 machte sie ihr Krankenschwesterstaatsexamen. Doch bald bekam sie Schwierigkeiten. Ihr wurde vorgeworfen, sich nicht mehr zur Elimschwesternschaft zu zählen. Als sie von ihrer ehemaligen Mitschwester Heidi erfuhr, dass diese sich an "die Partei" (NSDAP) wenden wolle, um sie aufzuklären "wie man in Elim mit Menschen umgeht, die Jesus nachfolgen wollen", warnte Adele die Mutter Oberin. Adele wurde daraufhin aufgefordert, die Elim-Haube abzulegen. Wenige Tage später wurde der Rauswurf zurückgenommen unter der Bedingung, dass Adele Heidi nicht mehr sehen dürfe. Doch Adele weigerte sich, und so verließ sie am 31. August 1936 die Diakonie Elim.
Nun begann ihr Leben als freie Schwester. Zuerst erhielt sie Arbeit im "Abendroth-Haus" in Hamburg-Hamm. Dort wurden Prostituierte und geschlechtskranke Frauen aufgenommen. Später wurde sie als behördliche Krankenhausfürsorgerin in Hamburger Krankenhäusern tätig. In diese Zeit fällt auch ihre Heirat. Ein ihr unbekannter Witwer, der ebenfalls Mitglied der Freien evangelischen Gemeinde war, stellte ihr einen Heiratsantrag. Im Mai 1943 wurde Hochzeit gefeiert. Doch schon bald merkte Adele, wie sie es beschreibt: "daß er als Mann nicht zu seinem Recht kam". Eine gynäkologische Untersuchung ergab, dass Adele Schwabs Geschlechtsorgane infolge einer in der Kindheit erlittenen Rachitiserkrankung unterentwickelt waren. Das Paar ließ sich scheiden und Adele Schwab begann wieder in ihrem alten Beruf zu arbeiten.
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus war Adele Schwab noch viele Jahre als Fürsorgerin tätig, so auch auf St. Pauli.
Unter dem Pseudonym "Lexa Anders" veröffentlichte sie in den 1960er bis 1980er Jahren eine Vielzahl von Büchern, in denen sie u. a. über ihr Leben und ihre Hinwendung zu Gott berichtet und z. B. auch über ihre Erlebnisse als Fürsorgerin auf St. Pauli und in Hamburgs Straßen.
|
|
 |
 |
| Dr. Ellen Simon |
 |

Photo: privat |
Jugendamtsleiterin
16.7.1895 Nordhausen bei Erfurt -13.7.1982 Berlin |
 |
| Dr. Ellen Simon, Schwester von Lola Toepke, studierte nach bestandenem Abitur im Jahre 1915 Volkswirtschaft, Jura, Philosophie und Psychologie. 1921 promovierte sie in Jura über das Thema "Schutzerziehung und Besserungserziehung". Von 1925 bis 1931 war sie Abteilungsleiterin des Jugendamtes und des Landesjugendamtes in Hamburg. 1931, nach dem Tod der Mutter Anna Simon, zog sie nach Königsberg, um dort die Leitung des Jugendamtes zu übernehmen. 1932 führte sie den ersten Arbeitsdienst für erwebslose Mädchen ein. Wegen ihrer Parteizugehörigkeit (seit 1930) zur SPD wurde sie 1933 von den Nazis ihres
|
Amtes enthoben. Im selben Jahr emigrierte sie in die Schweiz, arbeitete dort als Dozentin an einer Schwesternschule und als Privatpflegerin und ging 1938 nach London. Dort war sie als Sozialarbeiterin im East End tätig, hielt Verbindung zur bekennenden Kirche in Deutschland und kehrte im Mai 1948 nach Deutschland zurück. Nachdem sie 1950 in den USA einen Ausbildungskursus für Einzelfallhilfe absolviert hatte, wurde sie 1951/52 Lehrbeauftragte für Vormundschaftsrecht an der Universität Frankfurt/Main.
Von 1953 bis 1960 arbeitete sie als Leiterin des Pestalozzi-Fröbel-Hauses in Berlin. Dr. Ellen Simon war Gründungsmitglied der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und Beiratsmitglied im deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Bis zu ihrem Tod lebte die unverheiratet und kinderlos Gebliebene in Westberlin.
Recherchen Dr. Stephan Heinemann, Potsdam
|
|
 |
 |
 |

Photo: parlamentarischer Informationsdienst der Hamburgischen Bürgerschaft |
 |
Elsa Teuffert (geb. Jansen) |
Bürgerschaftsabgeordnete der FDP
12.6.1888 Hamburg - 10.3.1974 Hamburg |
 |
| Elsa Teuffert betreute ehrenamtlich von 1923 bis 1933 die durch die Inflation um ihre Ersparnisse gebrachten Menschen und setzte sich für die Wiedergutmachung des "Inflationsunrechtes" ein. 1946 trat sie der FDP bei und machte politische Karriere. Von 1951 bis 1954 war sie Bezirksabgeordnete in Hamburg-Altona, von 1953 bis 1954 Deputierte der Baubehörde und von 1953 bis 1959 Vorsitzende der FDP-Landesfrauengruppe. Von 1954 bis 1957 war Elsa Teuffert für den Hamburg Block (CDU, FDP, Deutsche Partei, Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten) und von 1958 bis 1966 für die FDP Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Außerdem war sie in den 50-er Jahren Vorstandsmitglied des Hamburger Frauenringes. |
|
 |
 |
 |
| Antonie Wilhelmine Traun (geb. Westphal) |
 |



Bildquellen: Gertrud Bäumer: Gestalt und Wandel. Frauenbildnisse. Berlin 1939. |
Gründerin des Vereins "Die Sozialen Hilfsgruppen"; Mitbegründerin des "Bundes Hamburgischer Hausfrauen" und des "Stadtbundes Hamburgischer Frauenvereine"
6.12.1850 Hamburg - 28.10.1924 Hamburg |
 |
Antonie Westphal war die älteste Tochter Carl Wilhelm Ludwig Westphal, Kaufmann und Mitinhaber der Firma G.W.A. Westphal Sohn & Co. Die Teefirma besteht noch heute und hat ihren Sitz in der Speicherstadt. Einer ihrer fünf Geschwister war der Senator Otto Westphal (Wirtschaft und Verkehr). Im Alter von 21 Jahren heiratete Antonie Westphal den acht Jahre älteren Kaufmann und Harburger Fabrikanten Otto Traun. Dessen Mutter war Bertha Traun geb. Meyer.
Sie hatte sich für die Selbstständigkeit und Rechte der Frauen stark gemacht, und mit Emilie Wüstenfeld 1850 die Hochschule für das weibliche Geschlecht gegründet. In zweiter Ehe heiratete sie 1851 den Prediger der Deutschkatholiken Johannes Ronge, der ebenfalls für die Emanzipation der Frau eintrat.
Wie ihre Schwiegermutter wurde auch Antonie Traun eine Anhängerin und Aktivistin der bürgerlichen Frauenbewegung. Als sie mit 48 Jahren Mitglied des "Allgemeinen Deutschen Frauenvereins" wurde, hatte sie in 26 Jahren sechs Kinder geboren, von denen eins im Alter von einem Jahr gestorben war. Und als Antonie Traun 1900 den Verein "Die sozialen Hilfsgruppen" gründete, waren die jüngeren Kinder 19, 17 und 11 Jahre alt. Ihr ältestes Kind war bereits verheiratet und hatte sie schon zur Großmutter gemacht. Die "Sozialen Hilfsgruppen" waren ein Zweigverein des "Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, Ortsgruppe Hamburg". Ihr Ziel war: "Frauen und Mädchen zur tatkräftigen, persönlichen Teilhabe an solchen Unternehmungen heran zuführen, die das Elend der ärmeren Volksklassen zu lindern bestimmt
sind." Durch diese gemeinnützige Tätigkeit sollten die weiblichen Vereinsmitglieder auch eine Bereicherung des eigenen Lebens und innere Befriedigung erlangen.
1907, ein Jahr nach dem Tod ihres Ehemannes, wurde Antonie Traun Mitglied des Hauptvorstandes des "Allgemeinen Deutschen Frauenvereins", acht Jahre später,1915, Mitbegründerin des "Bundes Hamburgischer Hausfrauen" und nach einem weiteren Jahr, im Alter von 66 Jahren Mitbegründerin des "Stadtbundes Hamburgischer Frauenvereine". Ziel des Hausfrauenbundes war: die Vertretung der volkswirtschaftlichen Interessen der Hausfrauen als Konsumenten und Produzenten.
Der Bund wollte die Arbeit der Hausfrau mit der Tätigkeit in anderen Berufen gleichsetzen. |
| Dieser Passus wurde jedoch 1918 gestrichen, denn gegen Ende des Ersten Weltkriegs entwickelten sich die Hausfrauenvereine immer mehr zu nationalistischen, konservativen Frauenvereinigungen. Die Ausdehnung des Ersten Weltkrieges machte es für die bürgerlichen Frauenverbände notwendig, ihre losen Verbindungen in eine straffe Zusammenfassung aller Hamburgischer Frauenvereine umzuwandeln. Deshalb wurde der "Stadtbund Hamburgischer Frauenvereine" gegründet, dessen Ziel es war, die gemeinsamen Interessen der angeschlossenen Frauenvereine zu vertreten und zu stärken. Antonie Traun starb acht Jahre, nachdem sie den Stadtbund mitbegründet hatte, im Alter von 73 Jahren.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Dr. Marie Unna geb. Boehm |
Dermatologin
03. 06. 1881 Schewen/Westpreußen (heute Szewa/Polen) - 23.12.1977 Hamburg |
 |
| Marie Unna war die Tochter eines Gutsbesitzers in Westpreußen. Nachdem sie einige Zeit Privatunterricht erhalten hatte, besuchte sie zwischen 1894 und 1896 die städtische höhere Töchterschule in Thorn und von 1898 bis 1902 die Gymnasialkurse für Frauen bei der Frauenrechtlerin Helene Lange in Berlin. Im September 1902 machte sie am kgl. Luisengymnasium in Berlin ihr Abitur. Zwischen 1902 und 1906 studierte sie dann Medizin in Freiburg, München und Berlin. 1906 promovierte sie an der Universität in Freiburg i. Br. und erhielt ein Jahr später ihre Approbation. 1910 ließ sie sich als Fachärztin für Haut- und
|
Geschlechtskrankheiten nieder. Sie war in den Jahren 1911, 1912, 1914, 1917, 1919, 1926/27, 1929, 1933, 1935, 1937, 1952 niedergelassene Ärztin in Hamburg mit Praxis in ihrem Privatwohnhaus in der Wentorferstraße 74 in Hamburg Bergedorf, wo sie mit ihrem Mann, dem Dermatologen Karl Unna (1880-1964) und den gemeinsamen drei Kindern lebte. Karl Unna entstammte einer Dermatologenfamilie. Sein Vater, der Dermatologe Paul Gerson Unna, nach dem in Hamburg der Unna-Park und die Unnastraße, an der das Hauptgebäude der Beiersdorf AG steht, benannt wurden, arbeitete eng mit dem Apotheker Paul Cark Beiersdorf zusammen. Zur Unna-Familie gehörte auch die Malerin Julie de Boor. Auch Karl Unna praktizierte eine Zeitlang in eigener Praxis in der Wentorferstraße 47, hatte später aber seine Praxis in der Dammtorstraße 27.
In der Zeit des Nationalsozialismus fiel Karl Unna als "Mischling 1. Grades" unter die NS-Rassegesetze. Einer ihrer Söhne, der Pharmakologe Klaus Robert Walter Unna (geb. 30. Juli 1908 in Hamburg, gestorben am 26.6.1987 in Santa Fe/New Mexico) emigrierte 1933 nach Österreich und 1937 in die USA.
1925 beschrieb Marie Unna eine neue, bis dahin unbekannte Form der Alopezie (des Haarausfalls). Diese seltene Erbkrankheit wird heute auch als "Unna-Syndrom" oder als hereditäre kongenitale Hypotrichose Typ Marie Unna bezeichnet. Diese Erkrankung zeigt sich oft schon nach der Geburt. Manchmal sind die Haare kurz nach der Geburt noch normal oder auch schon sehr dünn, bzw. gar nicht vorhanden. Waren Haare bei der Geburt vorhanden, werden sie in den ersten Lebensjahren schütter und spärlich, später dann grob und unregelmäßig gedreht. Kam das Kind ohne Haare auf die Welt, so wachsen zwar die Haare, sind dann aber auch grob, von drahtiger Struktur und schwer zu kämmen. Der Haarausfall beginnt dann in der Pubertät. Als Therapie gibt es nur die Möglichkeit einer Haartransplantation oder das Tragen einer Perücke.
Marie Unna war Gründungsmitglied des 1924 gegründeten Bundes Deutscher Ärztinnen (BDÄ). Über dessen Gründungsversammlung schrieb sie in der Vierteljahresschrift Deutscher Ärztinnen einen Bericht. Unter der Leitung von Marie Unna wurde 1925 auf der Tagung des Gesamtvorstandes des BDÄ ein Entwurf zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten diskutiert. Marie Unna gehörte dem Ausschuss zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten des BDÄ an, aus dem sie 1927 austrat. Außerdem war sie Mitglied des Hartmannbundes, aus dem sie 1953 ausschied.
Marie Unna war auch Schriftleiterin der von ihrem Schwiegervater Paul Gerson Unna geführten "Dermatologischen Wochenschrift".
|
|
 |
 |
 |
| Anna Wilhelmine Catharina Veldkamp |
 |

Photo: privat |
"Mutter Veldkamp"
5.7.1865 Hamburg - 13.12.1944 Hamburg |
 |
| "Mutter Veldkamp" besaß das renommierte, 1200 Sitzplätze fassende Café Veldkamp auf dem Hamburger Dom, ursprünglich gegründet von der Großmutter 1821 als Zuckerwarenhandel in Groningen. Nachdem sie nach Hamburg übergesiedelt war, errichtete ihre Tochter ein kleines Dom-Café, das die Enkelin erbte. „Mutter Veldkamp“ heiratete 1900 ihren Konditor, mit dem sie drei Söhne bekam. Mit ihrer holländischen Haube aus Gold, Brüsseler Spitzen und mit Brillanten besetzten Ohreisen, thronte sie hinter der Kasse. Ihren Namen „Mutter Veldkamp“ erhielt sie, weil sie Hamburgs Waisenkinder finanziell unterstützte und einen Tag während der jährlichen Domzeit ihr Café schloss, um die Waisenkinder kostenlos mit Kakao und Kuchen zu bewirten. Als Mutter Veldkamp starb, standen bei ihrer Beerdigung die Waisenkinder mit Kerzen in der Hand an ihrem Grab. |
|
 |
 |
 |

Photo: Staatsarchiv Hamburg |
 |
Bertha Wendt, geb. Bahnson |
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (DDP), organisiert in der bürgerlichen Frauenbewegung
6.10.1859 Hamburg - 14.3.1937 Hamburg |
 |
|
Geboren wurde Bertha Bahnson als erstes von acht Kindern von Rosalie Bahnson, geb. Philipp und deren Mann, dem Gymnasiallehrer Prof. Dr. Franz Wilhelm Bahnson. Rosalie Bahnson war jüdischer Herkunft und ließ sich vor ihrer Hochzeit evangelisch taufen. Bertha Bahnson besuchte die Höhere Töchterschule und die Klosterschule St. Johannis. 1878, im Alter von knapp 19 Jahren, heiratete sie den Lehrer und späteren Reichstagsabgeordneten Prof. Dr. Gustav Wendt (1848-1933), der 1901 Leiter der vom Verein Frauenbildung und Frauenstudium gegründeten Real- und später Gymnasial-Kurse für Mädchen wurde. Bertha Wendt bekam mit ihrem Mann acht Kinder.
|
|
Außerdem nahm sie nach dem frühen Tod ihrer Mutter (gest. 1884) ihre beiden jüngeren Brüder Fritz (acht Jahre) und Rudolph (3 Jahre) auf. Kinderschutz, hauswirtschaftliche Ausbildung für Mädchen und die Abstinenzbewegung, das waren Bertha Wendts Themen, denen sie ihre Kraft widmete. Bertha Wendt war führend in der bürgerlichen Frauenbewegung, und schon Jahre bevor die Frauen das Wahlrecht erlangten, begann sie sich politisch zu betätigen. So wurde sie 1911 in den Vorstand der Vereinigten Liberalen gewählt. Bertha Wendt trat z. B. für die Ab-schaffung des Lehrerinnenzölibats ein, denn sie war der Auffassung, dass alle Frauen das Recht auf einen Beruf haben sollten. Im Ersten Weltkrieg wandte sie sich anderen Aufgaben zu. Sie organisierte Kriegsküchen und leistete Aufklärung über praktische Ernährung. Außerdem stellte sie Unterkünfte für heimkehrende Soldaten und alleinstehende Frauen bereit. Nach dem Krieg und nachdem 1918 die Frauen das Wahlrecht erlangt hatten, begann Bertha Wendt mit der politischen Frauenbildungsarbeit. Als Führerin der demokratischen Frauen richtete sie für Frauen Notkurse in politischer Bildung ein und leitete solche Kurse selbst noch im Alter von 70 Jahren. Von 1919 bis 1924 war sie für die Deutsche Demokratische Partei Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. In dieser Zeit als Abgeordnete beschäftigte sie sich besonders mit Frauen- und Kinderfragen. Außerdem war sie Vorsitzende der demokratischen Frauengruppe Hamburg. Außerhalb der Parteipolitik engagierte sie sich in der Ortsgruppe Hamburg des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins auf dem Gebiet des Jugendschutzes. Hier kümmerte sie sich insbesondere um die Unterbringung und weitere Betreuung schulentlassener Mädchen und um die Überwachung des Koststellennachweises für uneheliche Kinder. Außerdem richtete sie Heimstuben für weibliches Hauspersonal ein, übernahm Vormundschaften, arbeitete im Verein gegen Ausnutzung und Misshandlung von Kindern und in der Bewegung für Mütterabende, war als Waisenpflegerin und in der Ferienkolonie Waltershof tätig. Sie war Mitglied im Frauenklub Hamburg, im Deutschen Bund Abstinenter Frauen, im Verband Norddeutscher Frauenvereine und im Hamburger Zweig des Deutschen Verbandes für Frauenstimmrecht. Zu ihrem 70. Geburtstag organisierte der Stadtbund hamburgischer Frauenvereine für sie eine Teestunde, an der rund 100 Frauen teilnahmen. Emma Ender, die diesen Nachmittag vorbereitet hatte, Klara Fricke, als Vorsitzende der Ortsgruppe Hamburg des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins und Helene Bonfort hielten kleine Reden. Für ihre karitativen Arbeiten erhielt Bertha Wendt das Verdienstkreuz. 1933, nach dem Tod ihres Mannes, zog sich Bertha Wendt aus der Öffentlichkeit zurück und starb am 14.3.1937 in ihrer Wohnung in der Oderfelderstraße 11.
|
|
 |
 |
 |
| Paula Westendorf geb. Gühlk |
 |

Photo: Staatsarchiv Hamburg |
Politikerin, Bürgerschaftsabgeordnete
26.10.1893 Hamburg - 3.10.1980 Hamburg |
 |
Die politische Karriere der geschiedenen Frau mit vier Kindern begann gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Bereits in der ersten Wahlperiode im November 1946 wurde Paula Westendorf für die SPD als Abgeordnete in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt, der sie bis 1953 angehörte.
Paula Westendorf setzte sich besonders für die Straffreiheit bei Abtreibung und für die soziale Indikation ein und forderte in diesem Zusammenhang die Einrichtung öffentlicher Ehe- und Sexualberatungsstellen. Als einseitigen Machtausdruck des Staates lehnte sie Strafverfolgung wegen Abtreibung ab und gab zu bedenken, dass Verbote die Menschheit nicht erzögen, weil Moral nicht befohlen werden könne.
Auf ihre Initiative hin wurde dann in den Räumen des Gesundheitsamtes eine öffentliche Ehe- und Sexualberatungsstelle eingerichtet, die als erste ihrer Art in den Westzonen im August 1948 eröffnet wurde.
Auch ihr Einsatz zur Freigabe des Vertriebes von Verhütungsmitteln hatte Erfolg. Am 1. Juni 1948 gab der Senat bekannt, dass die Polizeiverordnung des früheren Reichsinnenministers vom Juni 1941 über "Verfahren, Mittel und Gegenstände zum Schwangerschaftsabbruch" - worunter auch Verhütungsmittel fielen - aufgehoben sei.
|
|
 |
 |
 |

Photo: privat

Photo: privat |
 |
Adele Will, geb. Hessberger |
| (25.2.1903 in Antwerpen - 28.5.1997 in Hamburg) Kindergärtnerin mit Privat-Kindergarten in Hamburg-Eppendorf |
 |
Adele wurde als einziges Kind der Gouvernante Maria Klü und des Seemanns Johann Hessberger in Antwerpen geboren. Im selben Jahr zog die Familie nach Hamburg-Eimsbüttel. Im Seminar der Vereinigten Fröbelkindergärten erfolgte von 1918 bis 1919 die Ausbildung zur Kindergärtnerin. In den Jahren danach arbeitete Adele Hessberger als
"Kinderfräulein" in Familien und als Kindergärtnerin in verschiedenen staatlichen Einrichtungen - unter anderem in der Nähe der Reeper-bahn, wo sie sich Plattdeutsch aneignete, um die Kinder der Hafenarbeiterfamilien verstehen zu können. Zur beruflichen Selbstständigkeit entschied sie sich vor dem Hintergrund der Fröbel-Pädagogik: "Ich wollte keinen Massenbetrieb, sondern pädagogische Betreuung für jedes einzelne Kind."
Am 1.10.1925 gründete sie einen Privatkindergarten in Hamburg-Eppendorf: zunächst im Billiardraum der Conditorei C. W. Nobiling, Eppendorfer Landstraße, 1927 in ihrer Privatwohnung Erikastr. 143, bald darauf Im Winkel 21. Es war der vierte Privatkindergarten in Hamburg.
|
Am 17. Mai 1928 heiratete sie Max Will. Ihr Mann, ein gelernter Kaufmann, arbeitete als Buchhalter, später als Prokurist. Sobald er frühmorgens zur Arbeit ging, wurde die Wohnung mit routinierten Handgriffen kindgerecht verwandelt, sodass sich 15 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren wohlfühlen und verschiedene altersgemäße Spiel- und Lerngruppen stattfinden konnten. Mittags wurde aus dem Kinderparadies wieder eine Familienwohnung für Max und Adele Will, ab 1931 mit Tochter Eva-Maria. Der "fröhliche singende Kindergarten" wurde über sechs Jahrzehnte zu einer Institution in Eppendorf: jeden Vormittag zog Adele Will in Begleitung der angestellten Kinderpflegerin mit der Kindergartengruppe singend durch das Viertel an die Alster zu den Spielwiesen oder an den Mühlenteich, wo sich ein Spielplatz befand, der auf Adele Wills Initiative hin eingerichtet worden war. Viele Jahre organisierte sie Sommerferien an der Nordsee für ihre Kinder. Zuhause ging es regelmäßig ins Schwimmbad. Der jahreszeitliche Rhythmus prägte das Kindergartenjahr mit Frühlingsfest, Osterfeuer, Apfelernte, Nikolaus und Weihnachten ebenso, wie mit dem Puppenfest, Kasperltheater, Hafenausflug, Geburtstagsritual oder Abschiedsfest zum Schulbeginn für jedes Kind. Mit Unterstützung der dafür von Adele Will entwickelten Vorschulmappe, wurden die Kinder auf die Einschulung vorbereitet. 1970 entwarf sie ein "Uhren-Lotto", das der Ravensburger Verlag jahrelang verlegte, mit dem auch lernbehinderte Kinder spielerisch die Uhr kennenlernen konnten.
Durch die Gleichschaltung der Kindergärten während der nationalsozialistischen Diktatur 1933 bis 1945 wurde der Erhalt des Privatkindergartens zu einer besonders schwierigen und oft nur mit Verhandlungsgeschick zu lösenden Aufgabe: jede privatpädagogische Initiative war dem Reichsjugendamt verdächtig, besonders auch das Feiern von Ostern und Weihnachten. Während der Kriegsjahre wurde der Kindergarten so lange wie möglich offengehalten, bis der Beginn des Bombardements Hamburgs die Schließung nötig machte. Auf Initiative eines Arztes betreute Adele Will in dieser Zeit Kinder von Bombenopfern in der Lüneburger Heide und dem Kleinwalsertal.
Den Eltern der Kinder und auch "Ehemaligen" stand Adele Will immer mit Rat und Tat in schwierigen Erziehungs- und Familiensituationen zur Seite. Viele hielten über Jahrzehnte den Kontakt, manche waren inzwischen selber (Groß-)Eltern und brachten ihre Kinder zu "Tante Will" in den "Winkel 21".
1986 - bald nach dem sechzigjährigen Jubiläum und kurz vor Eintritt in den Ruhestand - bekam sie das Bundesverdienstkreuz am Bande "für ihr beispielhaftes Engagement bei der Betreuung von Kindern" verliehen. Sie nahm den Orden nur entgegen: "stellvertretend für meine Kolleginnen der anderen privaten Kindergärten Hamburgs". Einige Jahre war sie deren Sprecherin im "Verein der privaten Kindergärten von Hamburg und Umgebung" gewesen. 1990 wurde ihr der Portugaleser Taler in Bronze "BÜRGER DANKEN" durch den "Zentralausschuss Hamburgischer Bürgervereine v. 1886" überreicht.
Ehrenamtlich engagierte sich Adele Will in der Ökumene ihrer Kirchengemeinde St. Antonius sowie im Seniorenheim Anscharhöhe in Eppendorf, wo sie auch ihren Lebensabend verbrachte.
|
|
 |
 |
 |
| Karin Wilsdorf |
 |

Photo: privat |
| (11.10.1944 - 12.06.2015 ) 70 Jahre, Aktivistin der Hamburger Frauenbewegung, Mitinhaberin des Frauenhotels Hanseatin |
 |
Unbeirrbar kritisch und geradeaus war Karin Wilsdorf eine Aktivistin der Frauenbewegung, die Frauenräume immer wieder neu gestaltete. Gemeinsam mit Ihrer Lebenspartnerin Linda Schlüter eröffnete sie 1988 das Frauencafé endlich und verwirklichte 1995 mit ihr zusammen die Idee von einem Hotel für Frauen, das unzähligen Interessierten weit über die Grenzen Hamburgs und Deutschlands bekannt wurde.
Vorangegangen waren Erfahrungen der Vereinzelung auf einem klassisch konventionellen Weg für Frauen in den 1960ern: Nach einer Ausbildung zur Dekorateurin folgte eine Heirat und die Geburt ihrer Tochter
|
Jovanka. Als Ehefrau und Mutter arbeitete sie für den Haushalt und die Kleinfamilie; erwerbstätig zu sein war für Frauen in diesem Lebensmodell nicht vorgesehen - doch Karin wollte unabhängig sein. Über die Literatur der neuen Frauenbewegung erfuhr sie Anfang der 1970er, dass es vielen Frauen ging wie ihr. Sie trennte sich vom Vater ihrer Tochter und zog in eine WG mit Frauen, die unterschiedliche Lebensentwürfe lebten, entschied sich mit 34 für ein Studium der Sozialökonomie und engagierte sich für Frauenkultur.
Ihr Lebensinhalt war es für und mit Frauen etwas zu bewegen. Mit Karins Worten gesprochen hieß das: "Das ist ja spannend, das musst Du machen!" Ihre Lebensfreude und ihre überschäumende Kreativität waren dabei Karins Markenzeichen und ihr Mut zu Neuerungen machte vielen anderen Frauen Mut.
Eine motivierende Bühne für kulturelle und künstlerische Arbeit war das Frauencafé endlich, dass nach 25 Jahren umgewandelt wurde in den Frauensalon endlich. Viele verschiedene Gruppen gehörten mit regelmäßigen Treffen zum festen Rahmen des Cafes im Frauenhotel Hanseatin. Kontakte zu (prominenten) Schriftstellerinnen, Musikerinnen oder Politikerinnen, die im endlich eine Bühne bekamen oder zu solchen, die dadurch an Bekanntheit gewannen, waren die Highlights für die interessierte Hamburger Frauenwelt. Zu den externen Veranstaltungen gehörten neben Frauenpartys auch Dampferfahrten auf der Alster.
Darüber hinaus organisierte Karin 25 Jahre lang mit einem Team von Frauen den legendären Hamburger Frauenball im Curio-Haus und später im CCH.
Über vier Jahrzehnte hinweg war sie (Mit-) Initiatorin von Kulturräumen für Frauen.
Die Erinnerung an Karin Wilsdorf bleibt verbunden mit der Liebe und Energie, mit der sie die Stärken, Fähigkeiten und Talente von Frauen in Szene setzte und sie öffentlich machte. Nicht nur der Erfolg des Frauenhotels zeigt, dass es Karin Wilsdorf gelungen ist eine Vision von Frauenkultur und Solidarität zu verwirklichen.
|
|
 |
 |
 |

Bild aus: Festschrift zur Hundertjahrfeier der Charlotte-Paulsen-Schule. Hamburg-Wandsbek, im November 1966
 |
 |
Anna Cunigunde Wohlwill |
Schöpferin der Schule des Paulsenstiftes
20.6.1841 Seesen - 30.12.1919 Hamburg |
 |
| Länger als ein halbes Jahrhundert war Anna Wohlwill Lehrerin und viereinhalb Jahrzehnte leitete sie die Schule des Paulsenstiftes. „Wer nicht mehr selbst lernt, der lehrt nicht gut und hört auf, zu erziehen“ war ihr Leitspruch. Ohne jemals eine Prüfung abgelegt zu haben - Bildungsanstalten für Lehrerinnen gab es damals noch nicht - unterrichtete sie seit ihrem 15. Lebensjahr die Kinder des Paulsenstifts. Als sie mit 25 Jahren die Schulleitung übernahm, war die Schule keine Armenschule mehr, sondern entwickelte sich zu einer privaten höheren Mädchenschule. 1906 wurde die Anna-Wohlwill-Stiftung gegründet, die Freistellen für begabte Schülerinnen aus ärmeren Familien vergab. Im selben Jahr erhielt Anna Wohlwill als erste Frau vom Senat eine goldene Denkmünze. |
|
 |
 |
 |
| Margarethe Wöhrmann, geb. Brosterhues |
 |

Photo: Archiv der sozialen Demokratie Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn |
Politikerin (SPD)
19.7.1900 Hamburg - 7.1.1989 Hamburg |
 |
Margarethe, genannt Grete Wöhrmann war das dreizehnte Kind eines Schusters und einer gelernten Weißnäherin, die als Putzfrau arbeitete. Politisch tendierten die Eltern der SPD zu. Schon früh nahmen die älteren Geschwister Grete mit zu Veran-staltungen der Arbeiterjugend. 1914 trat sie dem Arbeiter-Jugend-Bund bei, wo sie zunächst Obmännin, später Leiterin einer Jüngerengruppe wurde.
Nach Abschluss der Volksschule absolvierte sie eine zweijährige kaufmännische Lehre und arbeitete von 1917 bis 1919 als Kontoristin und von 1919 bis 1923 als Sekretärin im Büro der Filiale des Transportarbeiterverbandes.
1918 trat sie der SPD bei, lernte dort ihren späteren Mann, den kaufmännischen Angestellten Bernhard Wöhrmann, kennen, und leitete mit ihm eine Jugendgruppe in der Neustadt.
|
Nach der Hochzeit im April 1923 wurde Grete Wöhrmann aus ihrer Stellung ent-lassen. Sie betätigte sich nun ehrenamtlich in einem Hamburger Mädchenheim. Diese Arbeit übte sie bis zur Geburt ihres ersten Kindes im Jahre 1924 aus. Vier Jahre später wurde ihre zweite Tochter geboren. Ihr Mann war seit Anfang der zwanziger Jahre Geschäftsführer der städtischen Blindenfürsorge in Altona.
Grete Wöhrmann war eine der wenigen Frauen, die Mitglied des Hauptvorstandes der Hamburger AWO war. Außerdem arbeitete sie seit 1927 als Frauendistrikts-leiterin der Altonaer SPD und war von 1929 bis 1933 Mitglied des Vorstandes der SPD Hamburg-Altona. 1930/31 wurde sie in der SPD zur Leiterin der Frauenarbeit gewählt und setzte sich gezielt für die Teil-nahme von Frauen an der Parteienpolitik ein. Zur selben Zeit wurde sie Kandidatin der Stadtverordnetenversammlung und 1931 Delegierte auf dem Reichsparteitag.
Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernahmen, wurde Bernhard Wöhrmann wegen seiner Mitgliedschaft im Arbeiter-Jugend-Bund, in der SPD, der AWO sowie bei den freien Gewerkschaften, aus dem Dienst entlassen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligte sich das Ehepaar Wöhrmann bei der Neuorganisation der SPD und wurde in der AWO aktiv. Von 1946 bis 1949 gehörte Grete Wöhrmann als Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft an.
|
|
 |
 |
 |

Photo: Kinderheim im Erlenbusch Hamburg |
 |
Hilde Wulff |
Jugendwohlfahrtspflegerin
7.1.1898 Dortmund - 23.7.1972 Hamburg |
 |
| Sie half während der Zeit des NS-Regimes bedrängten und gefährdeten Menschen. Hilde Wulff erkrankte im Alter von zwei Jahren an Kinderlähmung und war dadurch zeitlebens körperbehindert. Sie engagierte sich im Rahmen ihrer Berufsausbildung im Selbsthilfebund der Körperbehinderten. Sie setzte sich zunächst in Düsseldorf und dann in Berlin insbesondere für eine ordentliche Schulbildung körperbehinderter Kinder ein. 1931 gründete sie in Berlin eine erste eigene Einrichtung für Kinder. Im Zuge der "Gleichschaltung" des Selbsthilfebundes durch die Nationalsozialisten trat Hilde Wulff aus dem Bund aus und verlegte ihre Arbeit mit körperbehinderten Kindern 1935 nach Hamburg-Volksdorf. Hier half sie vielen Bedrängten und Gefährdeten. Ihr Volksdorfer Heim führte sie bis 1964 selbst und übergab es dann der Martha Stiftung, die ihre Lebensarbeit seitdem weiterführt. |
|
 |
 |
 |
| Grete Marie Zabe (geb. Tischkowski) |
 |

Photo: Staatsarchiv Hamburg |
Vorsitzende des Frauenaktionsausschusses der SPD, Mitglied (SPD) der Hamburgischen Bürgerschaft
18.3.1877 Danzig - 1.12.1963 Hamburg |
 |
Grete war fünf Jahre alt, als ihre Eltern, der Vater ein Schiffszimmergeselle, die Mutter ein Dienstmädchen, verstarben. Sie kam in ein Waisenhaus, später zu Pflegeeltern. Sie besuchte die Volksschule, wurde Dienstmädchen, später Arbeiterin in einer Zigarrenfabrik. Im Alter von 20 Jahren heiratete sie einen Malergehilfen. Ein Jahr später wurde das erste Kind, drei Jahre darauf das zweite und nach weiteren vier Jahren das dritte Kind geboren. Da das Gehalt ihres Mannes nicht für den Lebensunterhalt der Familie ausreichte, übernahm Grete Zabe zwischenzeitlich Aushilfsarbeiten.
Nachdem die Familie 1906/07 nach Hamburg
|
gezogen war, wurde Grete Zabe auf Anregung ihres Mannes, einem aktiven Sozialdemokraten und Gewerkschafter, Mitglied der SPD. Grete Zabe, die großes Redetalent besaß, machte Parteikarriere: 1913 wurde sie in den SPD-Distriktvorstand Hamburg-Uhlenhorst gewählt und leitete während des Ersten Weltkrieges die Kriegsküche dieses Stadtteils. Von 1919 bis 1933 war sie Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und im Ausschuss für Wohnungsfragen sowie in der Oberschulbehörde als einzige Frau in der Deputation für das Gefängniswesen tätig. Dort machte sie sich für eine Reform des Strafvollzuges stark. Zwischen 1922 und 1933 war sie Mitglied des SPD-Landesvorstandes und des SPD-Frauenaktionsausschusses. Im Letzeren hatte sie von 1922 bis 1927 den Vorsitz. Die zentralen Forderungen der SPD und des Frauenaktionsausschusses waren damals u. a.: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Verbesserung des Arbeits- und Mutterschutzes für erwerbstätige Frauen, gleiches Recht auf Erwerbstätigkeit für Mann und Frau und die Reform des Schwangerschaftsparagraphen 218.
1933 und 1944 wurde Grete Zabe von der Gestapo mehrere Tage inhaftiert.
Nach 1945 war Grete Zabe wieder für die SPD und die Arbeiterwohlfahrt aktiv.
|
|
 |
 |
 |
|
|
