 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
| Erinnerung an bedeutende Frauen Hamburgs, deren Grabsteine nicht nicht in den Garten der Frauen kommen, sondern auf unterschiedlichen Grabflächen des Ohlsdorfer Friedhofs stehen. |
 |
Im Juli 2016 wurde im Infopavillon des Gartens der Frauen eine von der Bildhauerin Doris Waschk-Balz geschaffene Terrakotta-Skulptur aufgestellt. Mit dieser Skulptur soll an diejenigen Frauen erinnert werden, die zwar auf dem Ohlsdorfer bzw. dem jüdischen Friedhof an der Ilandkoppel bestattet sind, deren Grabsteine aber nicht in den Garten der Frauen kommen, weil die Grabplätze z. B. von den Familien stets verlängert werden, oder die Grabsteine bereits museal aufgestellt sind (Heckengartenmuseum auf dem Ohlsdorfer Friedhof), am Eingang zum Ohlsdorfer Friedhof beim Christus an einige dieser Frauen erinnert wird oder sie Senatsgräber haben, im Ehrenhain der Widerstandskämpferinnen- und kämpfer begraben sind oder bei der Geschwister-Scholl-Stiftung ihre letzte Ruhe bekommen haben. Im Sockel, auf dem die Skulptur steht, wird es eine eine Art Schublade geben, in der diese Frauen mit Namen und Grablagen aufgeführt sind.
Diese Information aus der Schublade können Sie hier ausdrucken: Bedeutende Frauen Hamburgs.pdf.
Ihre Biografien können Sie hier nachlesen.
|
 |
 |
 |
Gerda Ahrens, geb. Müller |
| 2.4.1914 - 11.4.2001 |
| Stenotypistin, Hausfrau, Widerstandskämpferin, Mitglied der SPD 1931-1932, dann SAP |
Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung., Bn 73, 216
Weil Gerda Ahrens Flugbätter verteilte und über die Verbrechen des Hitler-Regimes aufklärte, kam sie 1933 und 1937 für jeweils zwei 2 Monate ins KZ Fuhlsbüttel. Die Anklage lautete: "Vorbereitung zum Hochverrat". Gerda Ahrens verlor ihren Arbeitsplatz. Ihr Mann wurde von den Nationalsozialisten ermordet, ihr Bruder als Angehöriger einer Strafkompanie getötet.
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus wurde Gerda Ahrens Betreuerin und später Vorsitzende des Landesausschusses der Arbeitsgemeinschaft "Frohe Ferien für alle Kinder" bis zu deren Verbot im Juli 1961. Nach einer Hausdurchsuchung kam sie in dieser Zeit für einen Tag in Haft.
|
In einem Brief vom 11.7.1961 an ihre Eltern schreibt Gerda Ahrens: "Ein unerfreulicher Anlass ist der Grund dieses heutigen Briefes. Mitten in den Vorbereitungen der Ferienverschickung, einmal die Verschickung in das Ferienlager ‚Ferienglück' in Wesel, Lüneburger Heide und 2ten die Verschickung in die Deutsche Demokratische Republik, wurde am 7. Juli 1961 durch eine Verfügung der Polizeibehörde Hamburg die Arbeitsgemeinschaft ‚Frohe Ferien für alle Kinder' Landesausschuss Hamburg verboten und aufgelöst. Am gleichen Tage wurde die zentrale Arbeitsgemeinschaft ‚Frohe Ferien für alle Kinder', Düsseldorf und die ihr angeschlossenen Landesausschüsse verboten und aufgelöst. In dieser Verfügung werden verfassungsfeindliche Bestrebungen zum Vorwurf gemacht.
Da das Vorgehen gegen die Arbeitsgemeinschaft als eine undemokratische Massnahme zu betrachten ist, haben wir gegen diese Verfügung vom 5.7.61 der Polizeibehörde Hamburg am 11.7.1961 Widerspruch erhoben. Gleichzeitig ist gegen die sofortige Vollziehung Antrag auf Aussetzung der Vollziehung am 18.7.1961 beim Verwaltungsgericht gestellt worden.
Die vornehmste Aufgabe unserer Tätigkeit während unseres siebenjährigen Bestehens war, allen Schulkindern zu einem mehrwöchigen Ferienaufenthalt zu verhelfen, um zur Erhaltung und Förderung ihrer Gesundheit beizutragen. (…) Durch unsere halbjährigen Eingaben an die Hamburger Bürgerschaft forderten wir die Bereitstellung von Mitteln für die Ferienerholung der Schuljugend. Darüber hinaus versuchten wir durch wohl durchdachte und begründete Vorschläge eine gesetzliche Verankerung des Rechtes auf Ferienerholung für jedes Schulkind und die Schaffung eines umfassenden Ferienwerkes in der Bundesrepublik zu erreichen.
Richtschnur unseres Handelns war die Un-Charta des Kindes, in der es u. a. heisst: ‚Das Kind erfreut sich der Wohltaten der sozialen Sicherheit. Es ist berechtigt, in Gesundheit heranzuwachsen und zu reifen (…). Das Kind hat das Recht auf ausreichende (…), Wohnung, Erholung und ärztliche Betreuung. (…) Es wird erzogen in (…) Verstehens, der Duldsamkeit, der Freundschaft zwischen (…) Völkern, des Friedens, weltumspannenden Brüderlichkeit (…).'" 1)
Am 7.9.1992 schrieb der "Spiegel" unter der Überschrift "Dunkler Tatbestand. Die Opfer des Kalten Krieges in Westdeutschland fordern nach der Einheit Wiedergutmachung für früheres Unrecht."
"Das Angebot war ein Knüller: zwei Wochen Ferien für Kinder, fast umsonst. Viele Eltern griffen dankbar zu, als die ‚Zentrale Arbeitsgemeinschaft Frohe Ferien für alle Kinder' (ZAG) 1954 erstmals das preiswerte Vergnügen organisierte. Kaum jemand störte sich daran, daß die meisten Fahrten in die DDR gingen. Jährlich reisten mehrere tausend Westsprößlinge in den Osten.
1961 war Schluß mit lustig. Die ZAG wurde verboten, die Organisatoren kamen vor Gericht. Ihr Vergehen: Sie hatten den DDR-Behörden stets die Personalien der jungen Reisenden mitgeteilt. ‚Das war doch selbstverständlich, falls den Kindern was passiert', meint die damalige ZAG-Mitarbeiterin Elfriede Kautz, heute 84. Das Landgericht Lüneburg sah darin ‚staatsgefährdenden Nachrichtendienst'. Das Urteil: ein Jahr Gefängnis ohne Bewährung.
Elfriede Kautz verbüßte ihre Strafe im Gefängnis Vechta. 30 Jahre später fordert sie Wiedergutmachung: ‚Wir sind Opfer des Kalten Krieges, wir wollen genauso behandelt werden wie die (…) politisch verfolgten Brüder und Schwestern in der ehemaligen DDR.'
Die rüstige Hausfrau ist nicht allein. In mehreren alten Bundesländern haben sich Initiativen von Leidtragenden jener durch hysterische Kommunistenfurcht geprägten bleiernen Zeit gebildet, von der heute niemand etwas wissen will. ‚Wenn die deutsche Geschichte jetzt aufgearbeitet wird, dann muß dieses Kapitel mit einbezogen werden', verlangt Sepp Meyer, 64, der in den fünfziger und sechziger Jahren 28 Monate in Untersuchungshaft saß. Die Anschuldigung: Verstoß gegen das KPD-Verbot und Vorbereitung zum Hochverrat.
16 Jahre liefen Ermittlungen gegen den Verlagsangestellten, bis das Verfahren nach der Reform des politischen Strafrechts 1968 endlich eingestellt wurde. Die Monate der U-Haft fehlen Meyer nun bei der Rente, als Ausfallzeit werden sie nicht angerechnet.
Der frühere nordrhein-westfälische Justizminister Diether Posser, 70, gibt den Opfern recht: ‚Die Leute von links sind damals miserabel behandelt worden, das war wirklich eine Schande.'
Der Jurist, der zwischen 1951 und 1968 als ‚Anwalt im Kalten Krieg' politisch Verfolgte vor Gericht vertrat, weiß aus eigener Erfahrung, daß es ‚nie um Gewalttaten, sondern immer um Gesinnung' ging. Natürlich sei in der DDR alles viel schlimmer gewesen, aber: ‚Das war ja auch kein Rechtsstaat.'
Der Rechtsstaat Bundesrepublik baute damals Dämme zum Schutz der Demokratie. In panischer Angst vor kommunistischen Umsturzbestrebungen nagelte der Bundestag 1951 hastig das Erste Strafrechtsänderungsgesetz zusammen und trieb es im Blitzverfahren durch die Beratungen. Das Gesetz umfaßte 37 politische Strafvorschriften, unklar definiert und beliebig auslegbar. ‚Eine Waffe, die geschmiedet wurde, um im Kalten Krieg zu bestehen', räumte der CDU-Abgeordnete Horst Haasler 1957 ungeniert ein.
Mehr als 150 000 Ermittlungen wegen Staatsgefährdung liefen damals, Tausende von Urteilen wurden gefällt. ‚Zahlen, die einem ausgewachsenen Polizeistaat alle Ehre machten', konstatierte 1965 der Staatsrechtsprofessor und spätere FDP-Innenminister Werner Maihofer. Das tiefe Eingreifen von politischer Polizei und Justiz in das persönliche und berufliche Schicksal von Hunderttausenden stehe ganz offenkundig in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Gefährdungen des Staates. (…)
Nachdem KPD-Verbot von 1956 wurden Tausende Genossen wegen ihrer vorher eingegangenen Parteimitgliedschaft verfolgt. Und als am 7. Juli 1961 die ‚Zentrale Arbeitsgemeinschaft Frohe Ferien für alle Kinder' verboten und aufgelöst wurde, da hatte Elfriede Kautz längst ihre 503 Seiten umfassende Anklageschrift erhalten. (…)
Besonderes Mißtrauen erregten Kommunisten, die schon unter Hitler verfolgt worden waren. Die Frankfurter Rundschau zitierte 1958 einen Lüneburger Staatsanwalt im Verfahren gegen einen Beschuldigten, der unter den Nazis wegen KPD-Mitgliedschaft sieben Jahre im Zuchthaus gesessen hatte: ‚Straferschwerend kommt hinzu, daß der Angeklagte bereits wegen solcher Tätigkeit hart bestraft worden ist. Das hat nichts genützt.' (…)". 2)
Auf den Internetseiten der Bundeszentrale für politische Bildung ist ein Beitrag von Jens Niederhut vom 16.11.2011 über die Ferienaufenthalte in der DDR zu lesen. Überschrift: "Frohe Ferien in der DDR. Kommunismus und Antikommunismus in den 1950er-Jahren." 3)
"Zehntausende westdeutscher Kinder lud die DDR zwischen 1954 und 1961 in Ferienlager ein. Die Bundesrepublik reagierte mit zusätzlichen Mitteln für Ferienhilfswerke, Kampagnen, polizeilichen und juristischen Maßnahmen. Die Geschichte der Ferienaktion wirft Schlaglichter auf die SED-Westpolitik, den westdeutschem Antikommunismus und die deutsch-deutsche Systemkonkurrenz.
Kostenlose Ferien jenseits des Eisernen Vorhangs? In den 1950er-Jahren war dieses Angebot für viele westdeutsche Familien attraktiv. Die ‚Zentrale Arbeitsgemeinschaft (ZAG) - Frohe Ferien für alle Kinder', 1955 in Düsseldorf gegründet und mit Landesausschüssen in fast allen Bundesländern vertreten, bot Kindern und Jugendlichen Plätze in Ferienlagern in der DDR - gegen ein geringes Entgelt, in vielen Fällen auch kostenlos. Also rollten zwischen 1954 und 1960 Jahr für Jahr Sonderzüge von West- nach Ostdeutschland und brachten Tausende Kinder in Ferienlager an der Ostsee, im Harz oder im Thüringer Wald. Über 20.000 Kinder waren es allein im Premierenjahr 1954, mehr als 46.000 im darauf folgenden Jahr.[1]
Für viele Kinder bedeuteten die Ferienfahrten einige Wochen voller Lagerfeuerromantik und Naturerleben. Im Wettstreit der Systeme in der Hochphase des Kalten Krieges war die Ferienaktion jedoch eine hochpolitische Angelegenheit, die die Regierungen in Ost-Berlin und Bonn, die Medien, die Sicherheitsbehörden und schließlich auch die Justiz beschäftigten. Anhand der Ferienaktion lässt sich die Konkurrenz der beiden deutschen Staaten aufzeigen. Insbesondere auf dem sozialen Felde musste die DDR ihrem eigenen Selbstverständnis gemäß zeigen, dass sie das bessere Deutschland sei. Die Bundesrepublik wiederum musste auf diese Herausforderung reagieren.[2]
Die Ferienaktion ist auch ein Beispiel dafür, wie die DDR direkten Einfluss auf die bundesdeutsche Gesellschaft gewinnen wollte. Die ‚Westpolitik' der SED war vor dem Mauerbau vor allem darauf gerichtet, Sympathien zu gewinnen und - besonders nach dem Verbot der KPD 1956 - eine organisatorische Basis aufzubauen. Die ZAG zählte zu diesem Netzwerk kommunistischer Organisationen in der Bundesrepublik, die bislang nur wenig erforscht sind.[3]
Schließlich zeigen aber auch die westdeutschen Reaktionen das Ausmaß und die Bedeutung des Antikommunismus für die junge Bundesrepublik auf. Die Kampagnen gegen die kommunistische Unterwanderung stimmten dabei nicht unbedingt mit der tatsächlichen Gefahr für die Sicherheit in der Bundesrepublik überein. Dies lässt sich insbesondere an der juristischen Verfolgung der ZAG-Mitarbeiterinnen zeigen.[4]
Die Geschichte des deutsch-deutschen Systemwettstreits ist insbesondere in ihrer konstitutiven Bedeutung für die politische und Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik noch nicht abschließend geschrieben. Die Geschichte der Aktion ‚Frohe Ferien für alle Kinder' kann als exemplarische Fallstudie zu dieser Geschichte beitragen.
Am 6. Mai 1954 veröffentlichten die Tageszeitungen in der DDR einen Aufruf an alle westdeutschen Eltern, Lehrer und Kinder, mit dem die Kinder der Bundesrepublik zu Ferienaufenthalten in der DDR eingeladen wurden. Die Betriebs- und Pionierlager boten Plätze für die Westdeutschen an, die Unkosten für die Eltern waren gering und wurden bei Bedürftigkeit sogar erlassen.[5]
In Bonn fiel die Reaktion heftig aus: Eine ‚starke Wirkung im Sinne der Aufweichung der Haltung der Bevölkerung gegenüber dem Kommunismus' befürchtete der Staatssekretär im Gesamtdeutschen Ministerium, Franz Thedieck: Die ‚Aktion sei wahrscheinlich die wirkungsvollste Aktion der kommunistischen Stellen in der Bundesrepublik'.[6]
Ganz unbegründet waren die Befürchtungen nicht: Die Ferienaktion war zunächst ein Erfolg. Allein 1955 reisten über 46.000 westdeutsche Kinder in ostdeutsche Ferienlager und auch in den folgenden fünf Jahren lagen die Teilnehmerzahlen im fünfstelligen Bereich. Für die DDR war dies ein gelungener Propagandacoup im Wettstreit der Systeme, konnte man doch die eigenen sozialen Errungenschaften mit Mängeln der westdeutschen Gesellschaft kontrastieren.
Die Regierungen in Bund und Ländern mussten dabei zunächst auf repressive Gegenmaßnahmen verzichten. Die Verschickung von Kindern in ostdeutsche Ferienlager war nicht illegal. (…)
Die staatseigene Bundesbahn stellte Sonderzüge für die Ferienreisen zur Verfügung. Dies war zwar nicht unumstritten, aber die Bundesregierung fürchtete, dass die DDR andernfalls Reiserestriktionen in der anderen Richtung erlassen würde.[9]
Stattdessen setzte Bonn auf publizistische Maßnahmen und auf die Ausgrenzung und Krimininalisierung der Ferienaktion und ihrer Mitarbeiter. (…)
Im vom Gesamtdeutschen Ministerium finanzierten ‚SBZ-Archiv' schrieb Heinz Kersten, die DDR-Ferienlager dienten der Erziehung der Kinder zu ‚Kollektivwesen, die sich vorbehaltlos für das kommunistische Regime einsetzen lassen'. Eine gleichfalls vom Ministerium herausgegebene Broschüre nannte die Aktion ‚Gift für Kinderseelen'.[11]
Die Presse machte sich diese Position unisono - sieht man von den kommunistischen Zeitungen ab - zu eigen. (…)
Die angebliche Unterwanderung der Bundesrepublik durch den Kommunismus war seit den späten 1940er-Jahren der Fokus des westdeutschen Antikommunismus. Die antikommunistische Propaganda operierte dabei mit der Vorstellung eines Netzwerkes kommunistischer Organisationen, deren tatsächliche Aktivitäten grob überzeichnet wurden. Die Bilder, die dabei produziert wurden, stellten den Kommunismus als ein ‚Gift' bzw. eine ‚Infektion' in der eigentlich gesunden Gesellschaft dar.[14]
Die Kinderferienaktion passte in diese antikommunistische Strategie der Bundesrepublik. (…)
Die im Westen befürchtete kommunistische Beeinflussung der Kinder stand zunächst tatsächlich auf der Agenda von SED/KPD. In den Ferienlagern erlebten die westdeutschen Kinder morgendliche Appelle und politische Schulungen genauso wie Geländespiele und Lagerfeuer. Sie sollten ‚mit den Errungenschaften unserer Deutschen Demokratischen Republik vertraut gemacht' werden. (…) Am Lagerleben nahmen die Gäste gemeinsam mit ihren ostdeutschen Altersgenossen teil, und Politik spielte dabei eine gewichtige Rolle. Es kam zu Treffen mit SED- oder KPD-Politikern und mit sowjetischen Soldaten oder Komsomolzen. Die Kinder sahen den ‚Thälmann-Film' und nahmen an Feiern zu Ehren des von den Nationalsozialisten ermordeten Arbeiterführers teil.[20]
Viele Kinder kehrten mit dem Sportabzeichen der FDJ oder auch dem Pionierhalstuch in die Bundesrepublik zurück.[21] Sport- und Freizeitaktivitäten hinterließen bei den Kindern aber nachdrücklicheren Eindruck. Dies belegen die Briefe und Erlebnisberichte der Kinder, in denen von Politik nicht viel die Rede ist, und die Erinnerung von Zeitzeugen: Der Sportmoderator Waldemar Hartmann aus Nürnberg, von 1958 bis 1960 im Alter von zehn bis zwölf Jahren dreimal im Ferienlager in der DDR, sagte 2009 in einer Fernsehsendung im Mitteldeutschen Rundfunk, dass ihn das Sportangebot fasziniert habe, die Ideologie hingegen sei ihm egal und die politischen Rituale für die Kinder viel zu abstrakt gewesen.[22]
Überhaupt war es realitätsfern, in wenigen Ferientagen eine dauerhafte politische Beeinflussung von Kindern zu erreichen. Sowohl in der SED als auch bei der ZAG wurde dies von vornherein nur einer von einer Minderheit als Ziel ausgegeben. Wie wenig dies erreicht werden konnte, zeigen schon früh Berichte der ostdeutschen Lagerleitungen, die über Undiszipliniertheiten und das geringe ‚Einfühlungsvermögen' der westdeutschen Kinder ‚in die Pioniergesetze' klagten: Durch ‚Lächerlichmachen der Morgenappelle' sei auch die ‚Moral der Jungen Pioniere' in Mitleidenschaft gezogen worden. Insgesamt - so hielt die ZAG im Oktober 1956 fest - müsse ‚die Einflussnahme einer kollektiven Erziehung auf die westdeutschen Kinder (...) als gescheitert angesehen werden.'[23]
In der Bundesrepublik fürchtete man nicht nur die kommunistische Beeinflussung der Kinder, sondern allgemein die Unterwanderung der Gesellschaft durch kommunistische Tarnorganisationen. Als solche galt auch die ZAG. Dabei entsprach diese nicht der typischen Vorstellung von einer parteihörigen Kaderorganisation. In der Öffentlichkeit präsentierte sie sich al überparteilich und karitativ, nur ein geringer Teil der zumeist weiblichen Mitarbeiter gehörte auch der KPD oder anderen kommunistischen Vereinigungen an. (…) Auch die Ferienkinder kamen nur zum Teil aus dem engeren Umfeld der KPD. Verfassungsschutz und Polizei gingen davon aus, dass nur ein Drittel der Kinder aus explizit kommunistischen Familien stammte. (…)
Auch wenn die ZAG keine typische kommunistische Kaderorganisation war, kann doch kein Zweifel darüber bestehen, dass Ost-Berlin die Zügel stets fest in der Hand behielt. Zwar waren viele Mitarbeiterinnen der ZAG keine Mitglieder der KPD - gerade auch viele Landesvorsitzende -, aber in jedem Landesausschuss saß wenigstens ein hauptamtlicher, das heißt von der KPD/SED bezahlter, Kader, der die ehrenamtlichen Helferinnen kontrollierte und sich mit dem Amt für Jugendfragen der DDR abstimmte. Insbesondere in der Frühphase der Ferienaktion schickte Ost-Berlin auch SED-Kader nach Düsseldorf, um die ZAG direkt anzuweisen; regelmäßige Treffen fanden in der DDR statt.[27]
Die wirksamsten westdeutschen Reaktionen auf die Ferienverschickung waren nicht die Kampagnen des Gesamtdeutschen Ministeriums, sondern die Investitionen in ein eigenes Ferienprogramm. (…) Staatliche Mittel für die Ferienprogramme von Kommunen, Wohlfahrtsverbänden und Kirchen wurden massiv erhöht. Im Jahr 1954, als die Aktion ‚Frohe Ferien für alle Kinder' begann, hatte das Land dafür lediglich 50.000 DM in den Haushalt eingestellt. Für 1955 erhöhte die Landesregierung diesen Posten auf 2,3 Millionen DM, 1956 waren es knapp 3 Millionen DM, bis 1958 stiegen die Zuschüsse auf über 7,6 Millionen DM. Die Zahl der Kinder, die an staatlich finanzierten Ferienmaßnahmen der Wohlfahrtsverbände teilnahmen, erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 40.000 auf 230.000.[29] (…)
Die massive Aufstockung der Mittel für Ferienaufenthalte belegt, dass die Bundesrepublik auf sozialstaatlicher Ebene ihre Überlegenheit zeigen musste, um ihrerseits nicht an Legitimation einzubüßen. Der wachsende Wohlstand in der Bundesrepublik machte diese speziellen Maßnahmen zwar bereits zehn Jahre später überflüssig, das zu Grunde liegende Muster - die Konkurrenz auf sozialem Gebiet - blieb aber darüber hinaus konstitutiv für beide deutschen Staaten.
Auch andere Faktoren trugen zum Niedergang der Aktion ‚Frohe Ferien für alle Kinder' am Ende der 1950er-Jahre bei: Ost-Berlin verlor wegen des ausbleibenden Erfolges und wegen der Neuausrichtung der Deutschlandpolitik das Interesse. Innere Konflikte schwächten die ZAG. Auch die Exklusions- und Diskreditierungspolitik der Bundesregierung schadete der ZAG. Die Teilnehmerzahl sank auf rund 10.000 Kinder im Jahr 1960.
Durch ihre Vertrauensleute, die seit 1956 in mehreren Landesverbänden der ZAG angeworben worden waren, waren die Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern über diesen Niedergang im Bilde.[32] Entsprechend schätzte man dort die Ferienaktion kaum noch als Bedrohung ein. So stellte der Verfassungsschutz NRW in einem Bericht an Innenminister Hermann-Josef Dufhues im Mai 1959 fest, dass der ‚starke Rückgang' bei den Teilnehmerzahlen erkennen lasse, dass ‚das Interesse an dieser Aktion in der Bundesrepublik erheblich abgenommen hat.' Die Zahl der in die DDR verschickten Kinder mache ohnehin ‚nur einen verschwindend kleinen Bruchteil' der vom Ferienhilfswerk NRW betreuten Kinder aus. Auch sei zuletzt bei den teilnehmenden Kindern ‚der Personenkreis (...) im wesentlichen der gleiche geblieben'.[33]
Obwohl die Ferienaktion an Bedeutung verlor und den Behörden dies auch bewusst war, gingen Verwaltung, Justiz und Polizei verstärkt gegen die ZAG vor. Polizeibeamte durchsuchten im April 1959 die Geschäftsräume der ZAG in Düsseldorf und beschlagnahmten Unterlagen.[34] In Niedersachsen stellte die Polizei die Personalien von 20 Mitarbeitern der Ferienaktion fest, die sich zu einer Besprechung in einem Lokal versammelt hatten, und beschlagnahmte alle Materialien.[35] Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen weigerten sich, die Kinder vor Reiseantritt zu untersuchen.[36] In Düsseldorf, Mönchengladbach und Remscheid holte die Polizei Schulkinder aus dem Unterricht, um sie über ihre Aufenthalte in DDR-Ferienlagern zu befragen.[37] (…)
Die verstärkten Kampagnen und Maßnahmen gegen die Ferienaktion hatten nicht zuletzt innenpolitische Gründe. Der deutsch-deutsche Kalte Krieg hatte sich in den späten 1950er-Jahren aufgeheizt. Aber auch für konkrete Gesetzesvorhaben spielte die Ferienaktion als Begründung eine Rolle: Im Januar 1961 brachte die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf von Innenminister Schröder in den Bundestag ein, der die Ein- und Ausreise in die bzw. von der Bundesrepublik neu regeln sollte. Das ‚Gesetz über Ein- und Ausreise' sollte die ungehinderte Einreise von Bundesbürgern in die DDR und von DDR-Bürgern in die Bundesrepublik stärkerer Kontrolle unterwerfen. Die Gesetzesbegründung führte vor allem die ‚Infiltration' durch ‚kommunistische Wühler und Agenten' an, aber auch den Ferienfahrten sollte auf diesem Wege ein Ende bereitet werden. Ein Ausbau der Grenzsicherung auf westdeutscher Seite wäre die Folge gewesen. Das Gesetz scheiterte schließlich am Widerstand der SPD und der West-Berliner CDU, die Erschwernisse im Transitverkehr befürchtete.[41]
Das Verbot der Ferienaktion beendete deren Aktivitäten schließlich im Sommer 1961 - kurz vor dem Bau der Berliner Mauer, der ohnehin ihr Ende bedeutet hätte. Zwar hatten die Innenministerien der Länder noch kurze Zeit vorher festgestellt, dass es eine gesetzliche Grundlage für ein Verbot nicht gebe, aber die Anklageschrift der Lüneburger Staatsanwaltschaft gegen vier Mitarbeiter der ZAG schien neue Tatsachen zu schaffen.[42] In dieser - so hielt es das Innenministerium NRW - sei ‚die Verfassungswidrigkeit' der Ferienaktion ‚eindeutig nachgewiesen'.[43]
Das Verbot der Zentralen Arbeitsgemeinschaft und ihrer Landesausschüsse nach Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes erfolgte am 7. Juli 1961 durch die Innenminister der Länder. Die Innenminister verwiesen auf die Gründung der ZAG auf Veranlassung der KPD und die auch über das Verbot der KPD hinaus bestehende Steuerung der ZAG durch KP-Funktionäre bzw. durch staatliche Stellen der DDR. Diese Steuerung klassifiziere die ZAG als kommunistische Hilfsorganisation. Darüber hinaus habe sich die ZAG systematisch mit den politischen Zielen von KPD und SED identifiziert. Da das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsfeindlichkeit der KPD festgestellt habe, folge aus dieser Identifizierung die Verfassungsfeindlichkeit der ZAG.[44]
Für einige Protagonistinnen der Ferienaktion endete ihr Engagement im Gefängnis. In einem Prozess verurteilte das Landgericht Lüneburg die Angeklagten zu Freiheitsstrafen wegen Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Organisation, nachrichtendienstlicher Tätigkeit - als solche galt bereits die Übermittlung der Personalien der Kinder an die DDR - und Verstoßes gegen das KPD-Verbotsurteil.[45] Angesichts der Tatsache, dass die Ferienaktion jahrelang ungehindert und in Zusammenarbeit mit der Bundesbahn tätig sein konnte, erscheint das Urteil sehr hart. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob in der Revision die Freiheitsstrafen gegen eine der Angeklagten auf, bei zwei Frauen - Elfriede Kautz und Gertrud Schröter - bestätigte er jedoch das auf ein Jahr Gefängnis lautende Urteil. Bei ihnen stellte der BGH, im Gegensatz zu den Mitangeklagten, den Vorsatz zu verfassungsgefährdenden Tätigkeit fest. In seiner Rechtsgeschichte schreibenden Begründung führte der BGH die frühere Mitgliedschaft der beiden Frauen in der KPD an. Die Nicht-Parteimitglieder kamen frei. Die fatal an Gesinnungsjustiz erinnernde Bestrafung der politischen Haltung anstelle der objektiven Tatbestände war auch zuvor schon angewandt worden. Sie war nun aber oberste Rechtssprechung in der Bundesrepublik geworden.[46] Kautz und Schröter wurden nach knapp zehn Monaten - nachdem das Landgericht eine Entlassung nach zwei Dritteln der Strafe abgelehnt hatte - dank des Einsatzes ihres Strafverteidigers Diether Posser und des Generalbundesanwalts Max Güde vom niedersächsischen Ministerpräsidenten begnadigt.[47]
Ab 1964 kümmerte sich Gerda Ahrens im Rahmen der Sozialarbeit der VVN-BdA (Vereinigung der Verfolgten des NS-Regimes) um ehemalige Leidensgenossinnen und -genossen, half ihnen in Entschädigungsfragen, hielt Vorträge und veranstaltete Führungen durch das ehemalige KZ Fuhlsbüttel.
Quellen:
1) Archiv/Sammlung: Gedenkstätte E. Thälmann Hamburg.
1) http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13681542.html
2) http://www.bpb.de/themen/4TXCD1,0,0,Frohe_Ferien_in_der_DDR.html
Hier die folgenden Fußnoten:
1. Nicht alle Kinder wurden über die Ferienaktion eingeladen, auch direkte Einladungen der Betriebe sind in den Zahlen enthalten. Aus internen Unterlagen des Amts für Jugendfragen bzw. des Ministeriums für Volksbildung der DDR lässt sich die Zahl westdeutscher Teilnehmer an den Ferienlagern nur für die Jahre 1954 (28.231), 1955 (46.199), 1959 (17.815) und 1960 (7.552; nur ZAG ohne Direkteinladungen) rekonstruieren. Das Propagandamaterial der ZAG spricht für 1955 von 55.000 und für die Folgejahre von 20-30.000 Kindern. Der Verfassungsschutz NRW schätzte etwas geringere Teilnehmerzahlen: 1954: 15.000, 1955: 23.800, 1956: 23.250, 1957: 14.750, 1958: 11.700, 1959: 12.180, 1960: 10.245). Diese Zahlen berücksichtigen nur die Sonderzüge der Bundesbahn, sind also zu niedrig. Zahlen in: BArch DC 4 Nr. 164, 1549; ebd. DR 2 Nr. 3090; Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (LAV NRW R) NW 614 Nr. 597. Zur Gründung der ZAG: Amt für Jugendfragen (AfJ), Situationsbericht über [...] Vorbereitungsarbeiten für eine Feriengestaltung der Kinder in Westdeutschland im Jahre 1955, 21.4.1955, BArch DC 4/164, Bl. 487-498.
2. Klassisch zu den deutsch-deutschen Beziehungen: Christoph Kleßmann, Verflechtung und Abgrenzung. Aspekte der geteilten und zusammengehörigen deutschen Nachkriegsgeschichte, in: APuZ, 29-30/1993, S. 30-41; zuletzt Hermann Wentker, Zwischen Abgrenzung und Verflechtung. Deutsch-deutsche Geschichte nach 1945, in: APuZ, 1-2/2005, S. 10-17; Udo Wengst/ders. (Hg.), Das doppelte Deutschland. 40 Jahre Systemkonkurrenz, Berlin 2008.
3. Zur Geschichte der KPD vgl. Till Kössler, Abschied von der Revolution. Kommunisten und Gesellschaft in Westdeutschland 1945-1968, Düsseldorf 2005; außerdem: Eric D. Weitz, The Ever-Present Other. Communism in the Making of West-Germany, in: Hanna Schissler (ed.), The Miracle Years. A Cultural History of West-Germany, 1949-1968, Princeton/Oxford 2001, S. 219-232; Patrick Major, The Death of the KPD. Communism and Anti-Communism in West-Germany, 1945-1956, Oxford 1998.
4. Vgl. vor allem Josef Foschepoth, Rolle und Bedeutung der KPD im deutsch-deutschen Systemkonflikt, in: ZfG 56 (2008), S. 889-909; ders., Postzensur und Telefonüberwachung in der Bundesrepublik Deutschland (1949-1968), in: ZfG 57 (2009), S. 413-426; ders., Staatsschutz und Grundrechte in der Adenauer-Zeit. Paradigmenwechsel in der Zeitgeschichte, in: Jens Niederhut/Uwe Zuber (Hg.), Geheimschutz transparent? Verschlusssachen in staatlichen Archiven, Essen 2010, S. 27-58.
5. Siehe die Zusammenstellung von Berichten v. Mai 1955, LAV NRW R NW 614 Nr. 598, vgl. Innenministerium Nordrhein-Westfalen (IM NRW), Einladung westdeutscher Kinder zum kostenlosen Aufenthalt in der SBZ, 29.9.1955, ebd. NW 308 Nr. 235, Bl. 74-77.
6. Zusammenfassende Niederschrift über die Sitzung der gesamtdeutschen Referenten der Regierungen der Länder am 7.12.1954, BArch B 106 Nr. 1670.
9. 31. Sitzung des Bundeskabinetts, 5.7.1955, http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0001/x/x1954e/kap1_2/kap2_32/para3_2.html [11.9.2011].
11. Heinz Kersten, Die sowjetzonale Ferienaktion 1955. Kommunistische Erziehung am Lagerfeuer, in: SBZ-Archiv 6 (1955) 17, S. 258-260, hier 258; Otto Stolz, Gift für Kinderseelen. Die sowjetzonale Ferienaktion in der Bundesrepublik und ihre Ziele, Bonn 1958.
14. So z.B. der Anklagevertreter der Bundesregierung im KPD-Prozess, Staatssekretär Ritter von Lex: Die KPD sei "ein gefährlicher Infektionsherd im Körper unseres Volkes, der Giftstoffe in die Blutbahn des staatlichen und gesellschaftlichen Organismus der Bundesrepublik sendet." Zit.: Josef Foschepoth, Antikommunismus in der politischen Kultur der USA und der Bundesrepublik. 10 Thesen, http://www.uni-hildesheim.de/media/fb1/geschichte/eg/ws2009/07-Antikom_10_Thesen.pdf [11.9.2011], S. 2.
20. AfJ, Abschlußbericht über die [...] Aktion Frohe Ferientage für alle Kinder 1954, o. D., BArch DC 4/154, Bl. 33-46; Beratung über die Teilnahme westdeutscher Kinder an der Sommerferiengestaltung 1956, 13.3.1956, ebd., Bl. 57-59; Bericht über den 1. Durchgang der Aktion "Frohe Ferientage für alle Kinder" 1954, o. D., BArch DC 4/152. - Der zweiteilige DEFA-Film über Ernst Thälmann von 1954/55 war einer der wichtigsten Propagandafilme der DDR.
21. LfV Hamburg, Hamburger Ferienkinder in der SBZ, 10.9.1956, LAV NRW R NW 614 Nr. 596; IM NRW, Frohe Ferien für alle Kinder, o. D. (1955/56), LAV NRW R NW 308 Nr. 235, Bl. 63f.
22. Waldemar Hartmann in der Sendung "Fakt ist...!" am 20.7.2009 im MDR. - Für den Hinweis auf die Sendung danke ich Nancy Aris (Dresden).
23. IM NRW (LfV), Erfahrungsaustausch über die Kinderferienverschickung in die SBZ 1956, 24.10.1956, LAV NRW R NW 614 Nr. 597.
27. AfJ, Situationsbericht über den Stand der Vorbereitungsarbeiten für eine Feriengestaltung der Kinder in Westdeutschland im Jahre 1955, 21.4.1955, BArch DC 4/164, Bl. 487-498; Beratung über die Teilnahme westdeutscher Kinder an der Sommerferiengestaltung 1956 beim Zentralkomitee der SED am 9. März 1956, ebd., Bl. 57-59; Sekretariat der KPD, Übersicht über die wichtigsten Kader der Arbeitsgemeinschaft Frohe Ferien beim Zeitpunkt ihres Verbots, o. D. (1961), BArch BY 1/3937; IM NRW (LfV), Bericht, 16.7.1955, LAV NRW R NW 614 Nr. 596.
29. Arbeits- und Sozialminister NRW an Ministerpräsidenten, 6.3.1959, LAV NRW R NW 179/320 Bl. 46-49.
32. Zu den V-Leuten in der Ferienaktion siehe v.a. die Berichte in LAV NRW R NW 614 Nr. 599; vgl. auch Wolfgang Buschforth, Geheime Hüter der Verfassung. Von der Düsseldorfer Informationsstelle zum ersten Verfassungsschutz der Bundesrepublik (1947-1961), Paderborn 2004, S. 201f.
33. IM NRW (LfV), Kinderferienverschickung in die DDR, 14.5.1959, LAV NRW R NW 614 Nr. 597.
34. ZAG, Kommuniqué, o. D.(Juni 1959), abschr.: LAV NRW R NW 614 Nr. 599.
35. KPD, Jugendkommission, Information über die Ferienaktion 1960, 10.9.1960, BArch BY 1/4363.
36. PP Recklinghausen, Bericht, 20.7.1960, LAV NRW R NW 614/521, vgl. IM NRW, Abt. VI, Untersuchung von Ferienkindern durch das Gesundheitsamt Gladbeck, 27.3.1957, ebd., sowie IM NRW (LfV), Arbeitstagung am 22.9.1956 in Berlin-Großköris, 23.4.1957, ebd.
37. Sekretariat der KPD, Bericht, o. D. (1957), BArch BY1/3938. Die Vernehmungen von Kindern erfolgten auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und beschäftigten die Landesregierung NRW im Mai 1957. Der Justizminister wies die Staatsanwaltschaft an, die Vernehmungen einzustellen. Vgl. die 511. und 512. Kabinettsitzung, in: Volker Ackermann (Bearb.), Die Kabinettsprotokolle der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 1954 bis 1958, Siegburg 1997, S. 954, 957.
41. 102. Sitzung des Bundeskabinetts, http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0000/k/k1960k/kap1_2/kap2_43/para3_8.html [4.1.2011]; Gegen den roten Funktionär. Materialien zum Gesetz über Einreise und Ausreise, Hg. Bundesregierung, Bonn 1960; Torsten Oppelland, Gerhard Schröder (1910-1989). Politik zwischen Staat, Partei und Konfession, Düsseldorf 2002, S. 312-315.
42. IM NRW, Kinderferienverschickung in die DDR, 18.6.1959, LAV NRW R NW 614 Nr. 597.
43. IM NRW, Verbot verfassungsfeindlicher Organisationen, Zentrale Arbeitsgemeinschaft Frohe Ferien für alle Kinder, 4.7.1961, LAV NRW R NW 308 Nr. 236, Bl. 80f; Niederschrift über die Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister der Bundesländer am 14./15. Juni 1961 in Bremerhaven, ebd. NW 266 Nr. 164, Bl. 30. Vgl. auch BMI, Vermerk v. 13.6.1961, BArch B 106/16071.
44. Muster der Auflösungsverfügung gegen die Zentrale Arbeitsgemeinschaft Frohe Ferien für alle Kinder, 4.7.1961, LAV NRW R NW 308 Nr. 236, Bl. 86-93, dort i. Folg. auch die Verbotsunterlagen aus den einzelnen Bundesländern; vgl. auch Regierungspräsident Düsseldorf, Verbot von Vereinigungen, hier Zentrale Arbeitsgemeinschaft Frohe Ferien für alle Kinder, 6.7.1961, ebd. BR 2154 Nr. 8. Rechtskräftig wurde die Auflösung durch das Urteil des OVG NRW V A 1508/64, ebd. NW 308 Nr. 238, Bl. 109-119.
45. §§ 42, 47 BVGG, 90a, 92, 100d (2) StGB. Zum Prozess siehe die Prozessberichte der KPD in: BArch DC 4/1549 u. SgY 27/234; sowie v.a. Diether Posser, Anwalt im Kalten Krieg. Ein Stück deutscher Geschichte in politischen Prozessen 1951-1968, München 1991, S. 259-265.
46. Das Urteil des BGH 3 StR 58/62, BGHSt 18, 246; vgl. auch Alexander von Brünneck, Politische Justiz gegen Kommunisten in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1968, Frankfurt a. M. 1978, bes. S. 109-116, 143-150.
47. Diether Posser, Anwalt im Kalten Krieg. Ein Stück deutscher Geschichte in politischen Prozessen 1951-1968, München 1991, S. 263.
|
|
 |
 |
 |
| Johanna Bästlein, geb. Zenk |
 |
 |
| 25.7.1895 -31.7.1982 |
| Schneiderin, Widerstandskämpferin |
Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bo 73, 1
Johanna Bästlein "stammte wie [ihr Mann Bernhard Bästlein] aus einer sozialdemokratischen Arbeiterfamilie. Ihre Eltern waren Albert Zenk und Wilhelmine, geb. Schröder. (…) 1920 heiratete Johanna Bernhard Bästlein (1894-1944). Als sich im selben Jahr der linke Flügel der USPD mit der KPD vereinigte, trat das Ehepaar Bästlein der KPD bei.
Bernhard Bästlein wurde im März 1921 zum Mitglied der Hamburger Bürgerschaft gewählt. Durch Beschlüsse der Kommunistischen Internationale gedrängt, löste die KPD in Sachsen und dem Ruhrgebiet Unruhen aus. In Hamburg wurde am 23. März 1921 ("Märzaktion") zum Generalstreik aufgerufen. Bernhard Bästlein beteiligte sich am Demonstrationszug zur Werft Blohm & Voss. Es kam zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei.
|
Da gegen die beteiligten Abgeordneten Anklage wegen ‚Vorbereitung zum Hochverrat' erhoben und am 30. März 1921 ihre Immunität als Volksvertreter aufgehoben wurde, organisierte die KPD seine Flucht per Schiff von Stettin nach Leningrad (heute St. Petersburg). In der Sowjetunion arbeitete Bernhard Bästlein als Redakteur, Lektor und Lehrer an der Deutschen Parteischule in Moskau. Seine Frau kam aus Hamburg nach. Nach der Schließung der Parteischule arbeitete er als Dreher in einer Moskauer Fabrik. Nur durch Schwarzmarktgeschäfte und ‚Kohlenklau' blieb ihm und seiner Frau genug zum Leben. Das Ehepaar nahm im Dezember 1922 am IV. Weltkongress der Kommunistischen Internationale teil.
Aufgrund einer Amnestie kehrte das Ehepaar Bästlein im Januar 1923 nach Deutschland zurück. Bernhard Bästlein war dann im Parteiauftrag von 1923 bis 1930 bei verschiedenen Zeitungen im rheinisch-westfälischen Industriegebiet als Redakteur tätig. 1928 lebte das Ehepaar in Hagen, 1930 in Düsseldorf. Mindestens dreimal wurde Bernhard Bästlein wegen Presse-Delikten und einmal wegen Vorbereitung zum Hochverrat vor Gericht gestellt. Da er inzwischen gute Kenntnisse des politischen Strafrechtes hatte, verteidigte er sich erfolgreich selbst. Im Oktober 1929 wurde Bernhard Bästlein Unterbezirksleiter der KPD in Düsseldorf, 1930 Bezirksleiter in Köln. Da er in diesen Jahren kaum Lohn für seine Tätigkeiten erhielt, musste das Ehepaar bei Genossen zur Untermiete leben.
1924 verstarb ihr erstes Kind kurz nach der Geburt.
Von Februar 1931 bis März 1933 war Bernhard Bästlein Politischer Sekretär der KPD-Bezirksleitung Mittelrhein und erhielt das erste Mal eine ausreichende Besoldung. Im April 1932 wurde er in den preußischen Landtag gewählt. Johanna Bästlein engagierte sich bis 1932 in der kommunistischen Frauenarbeit." 1) Sie war zwischen 1926 und 1933 in Düsseldorf Verantwortliche für die Frauenarbeit im Bezirk Niederrhein der KPD. "Sohn Bernt Henry Jürgen wurde am 3.12.1932 geboren." 1)
"Bernhard Bästlein nahm am 7. Februar 1933 an der letzten illegalen Tagung der KPD unter dem Vorsitz Ernst Thälmanns im ‚Sporthaus Ziegenhals' bei Berlin teil. Er wurde am 5. März 1933 in den Reichstag gewählt, konnte das Mandat aber aufgrund der einsetzenden Verfolgung nicht mehr annehmen.
Als 1933 das Kölner KPD-Parteihaus in der Aquinostraße 11 beschlagnahmt wurde, musste Johanna Bästlein mit ihrem [drei Monate alten] Sohn die dortige Dreizimmerwohnung räumen, in der sie seit 1931 lebten. Ihre Bibliothek wurde beschlagnahmt. Johanna Bästlein stellte ihren Hausstand bei fremden Leuten unter und bekam später nichts davon ausgehändigt. Sie kehrte wieder nach Hamburg zurück und lebte von Wohlfahrtsunterstützung durch die Stadt Köln.
Ab März 1933 hielt sich Bernhard Bästlein als Organisator der illegalen KPD in Frankfurt am Main auf und wurde dort im Mai 1933 verhaftet. Der Volksgerichtshof klagte ihn erst im Dezember 1934 wegen Hoch- und Landesverrates an. Diese Anklage wandelte das Gericht in ‚Vorbereitung zum Hochverrat' um und verurteilte ihn zu 20 Monaten Zuchthaus. Vom 12. Juni 1933 bis zum 12. Februar 1935 befand er sich im Gefängnis Siegburg in Haft. Danach ging er zu seiner Familie nach Hamburg, die zu der Zeit in der Straßburger Straße 33 lebte.
Bereits am 8. März 1935 kam Bernhard Bästlein erneut in ‚Schutzhaft'. Er wurde als intellektueller Urheber eines Mordes in Bonn unter Anklage gestellt. Obwohl das Verfahren eingestellt wurde, hielt man ihn in den Konzentrationslagern Esterwegen und - ab 1936 - Sachsenhausen fest. Dort lernte er Robert Abshagen, Franz Jacob, Julius Leber (SPD), Harry Naujoks, Wilhelm Guddorf und Martin Weise kennen. 1937 gehörte er zu den Verfassern des Sachsenhausenliedes, das auf Anweisung des SS-Lagerführers Weiseborn als Lagerlied entstand, dann aber verboten wurde. Im April 1939 wurde er in das Kölner Gefängnis ‚Klingelpütz' überstellt und blieb dort bis zum 6. April 1940 in Polizeihaft.
Nach seiner Entlassung kehrte er zu seiner Familie in Hamburg zurück und lebte mit ihr ab dem 10. April 1940 am Goldbekufer 19. Er arbeitete als Wagenwäscher, Chauffeur und dann in den Altonaer Riepe-Werken, die Tintenkugelschreiber herstellten. Bernhard Bästlein traf sich mit anderen entlassenen Kameraden aus dem KZ Sachsenhausen. Sie wollten den aktiven Widerstandskampf gegen das NS-Regime fortsetzen. So baute er mit Robert Abshagen, Franz Jacob, Oskar Reincke und anderen Kommunisten eine Widerstandsorganisation auf. Ihre vorrangigen Ziele waren die politische Mitgliederschulung, Aufklärungsarbeit und Produktionssabotage in den Betrieben. Als Gründungssitzung wird ein Treffen im November 1941 angesehen, auf dem Bernhard Bästlein mit der Ausarbeitung einer Konzeption beauftragt wurde. Im Dezember 1941 kamen in Berlin Bernhard Bästlein, Robert Abshagen, Wilhelm Guddorf, Martin Weise und Fritz Lange zusammen, um das sechsseitige Papier zu beraten. Wilhelm Guddorf gehörte zur KPD und hatte über Martin Weise Kontakte zu Berliner Widerstandsgruppen wie der Uhrig- und Schulze-Boysen/Harnack-Organisation geknüpft (‚Rote Kapelle').
Bernhard Bästlein war als politischer Leiter für die Abwehr von Spitzeln, die Nachrichtenbeschaffung und Bereitstellung von Waffen verantwortlich. (…). Die Widerstandstätigkeiten konzentrierten sich weitgehend auf die Großbetriebe der Bereiche ‚Werften' und ‚Metall', in denen es über 30 illegale Betriebsgruppen gab. Die Widerstandskämpfer unterstützten Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, wodurch auch Kontakte zu ausländischen Gruppen entstanden. Mitte 1942 kam es zur wohl einzigen größeren Flugblatt-Aktion. Das ‚Merkblatt für Bauarbeiter' richtete sich insbesondere an Hamburger Bauarbeiter, die zu Bauvorhaben der ‚Organisation Todt' nach Norwegen und in die Sowjetunion zwangsverpflichtet wurden. Es verknüpfte allgemeine sozialpolitische Forderungen (Lohnhöhe, Trennungsgelder) mit dem Aufruf zu Sabotageakten sowie der anständigen Behandlung der einheimischen Bevölkerung und schloss mit der Losung ‚Hitlers Niederlage ist nicht unsere Niederlage, sondern unser Sieg!'
Mitte Mai 1942 sprangen über Ostpreußen vier Personen mit Fallschirmen aus sowjetischen Flugzeugen ab. Sie sollten wohl durch mitgeführte Funkgeräte und gefälschte Papiere die Schulze-Boysen/Harnack-Organisation in Berlin unterstützen. Da sie aber dort keinen Kontakt herstellen konnten, machten sich zwei von ihnen, Erna Eifler und Wilhelm Fellendorf, auf den Weg nach Hamburg zur Mutter von Wilhelm Fellendorf. Anfang Juli gelang es Erna Eifler und Wilhelm Fellendorf Kontakt zur Bästlein-Organisation herzustellen, die nun für ein Versteck und Verpflegung sorgte. Inzwischen war ihnen allerdings die Gestapo auf der Spur. Am 15. Oktober 1942 begann in Hamburg eine Verhaftungswelle, der am 17. Oktober auch Oskar Reincke und Bernhard Bästlein zum Opfer fielen. Ein Fluchtversuch Bernhard Bästleins scheiterte an einem Schuss in den Unterschenkel. Nach schweren Folterungen im Hamburger Stadthaus, dem Sitz der Staatspolizeileitstelle, unternahm er einen Selbstmordversuch, indem er sich einen Treppenschacht hinunterstürzte. Er überlebte - und blieb trotz der folgenden Torturen bei seiner Haltung des politischen Widerstandes. Am 30. November 1942 gab er vor der Gestapo eine schriftliche Erklärung dazu ab, die jetzt auch die Erfahrungen während der NS-Herrschaft einbezog. (…)
Im August 1943 wurde Bernhard Bästlein aus der Untersuchungshaft in Fuhlsbüttel in die Strafanstalt Berlin-Plötzensee überstellt, um als Zeuge im Prozess gegen Martin Weise auszusagen. Bei einem Luftangriff am 30. Januar 1944 wurde das Berliner Gefängnis getroffen. Bernhard Bästlein konnte fliehen und seiner Frau per Brief darüber berichten. Er fand bei Berliner Kommunisten Unterschlupf und war weiterhin im Widerstand aktiv. Im April 1944 sah er Franz Jacob zufällig in der S-Bahn. Zusammen mit Anton Saefkow wurden sie der ‚Dreierkopf' der illegalen KPD Berlin. Doch wurde Bernhard Bästlein am 30. Mai 1944 verhaftet, in Berlin im Reichssicherheitshauptamt in der Prinz-Albrecht-Straße vernommen und tagelang gefoltert. Er kam im Juli in das KZ Sachsenhausen. Das am 5. September 1944 durch den Volksgerichtshof gefällte Urteil wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung und Wehrkraftzersetzung galt auch für Franz Jacob und Anton Saefkow. In der Urteilsbegründung heißt es: ‚Sie sind unbelehrbar und unverbesserlich.'
Bernhard Bästlein wurde am 18. September 1944 im Zuchthaus Brandenburg-Görden mit dem Fallbeil enthauptet.
Johanna Bästlein arbeitete nach Streichung ihrer Wohlfahrtsunterstützung ab 1938 als Uniformnäherin. Sie wurde im Juli 1943 ausgebombt und lebte seitdem mit ihrem Sohn in einer primitiven Wohnlaube am Ziegelsee 60 in Jenfeld, die ihr Mann bereits vorausschauend als Notquartier ausgebaut hatte. Als sie ihre Arbeit verlor, nähte sie für Privatleute. Zweimal wurde sie verhaftet und aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Vom Tod ihres Mannes erfuhr Johanna Bästlein erst am 30. September 1944. Die Veröffentlichung einer Todesanzeige wurde ihr untersagt. (…)
Text: Maike Bruchmann
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus war Johanna Bästlein für die KPD/DKP sowie in der VVN aktiv, besuchte Versammlungen, ging in Schulen und berichtete über die NS-Zeit.
Quellen:
AfW 031294; Ursel Hochmuth, Niemand und nichts wird vergessen, Biogramme und Briefe Hamburger Widerstandskämpfer 1933-1945, Hamburg 2005, S. 31-34; Andreas Klaus, Gewalt und Widerstand in Hamburg-Nord während der NS-Zeit, Hamburg 1986, S. 66-76; Frank Müller (Hrsg.), Mitglieder der Bürgerschaft, Opfer totalitärer Verfolgung, Hamburg 1995, S. 15-18; www.politisch-verfolgte.de (eingesehen am 18.08.2007); www.volksliedarchiv.de (eingesehen am 18.08.2007); Telefonisches Interview mit Bernhard Bästlein am 26.08.2007; Klaus Bästlein, "Hitlers Niederlage ist nicht unsere Niederlage, sondern unser Sieg!", Die Bästlein-Organisation, in: Beate Meyer/Joachim Szodrzynski (Hrsg.), Vom Zweifeln und Weitermachen, Fragmente der KPD-Geschichte, Hamburg 1988, S. 44-89; Volker Ullrich, Weltkrieg und Novemberrevolution: Die Hamburger Arbeiterbewegung 1914 bis 1918, in: Landeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Hamburg im ersten Viertel des Jahrhunderts: die Zeit des Politikers Otto Stolten, Hamburg 2000, S. 106-107, Angelika Voss, Der "Hamburger Aufstand" im Oktober 1923, aaO, S. 171; Harry Naujoks, Mein Leben im KZ Sachsenhausen 1936-1942, Köln 1987, S. 49, 51, 52, 134; Ursel Hochmuth/Gertrud Meyer, Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933-1945, Frankfurt am Main 1980, S. 360. Archiv/Sammlung: Gedenkstätte E. Thälmann Hamburg.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Eddy Beuth, geb. Marie Cohn; verh.+verw. Sohm, gesch. Sack und verw. Ar(o)nheim |
| 7.5.1872 Breslau (ehem. Schlesien; heute: Wroclaw/Polen) - 16.12.1938 Hamburg |
| Textautorin, Schriftstellerin, Drehbuchautorin |
Jüdischer Friedhof Ilandkoppel
Stolperstein vor Eppendorfer Landstraße 28
Eddy Beuth, alias Marie Cohn wurde als Tochter des jüdischen Technikers Isidor Cohn (geb. 1841) und seiner Frau Frida (geb. Vogel, verstorben 1920) im damaligen Breslau/Niederschlesien geboren. Für ihre Veröffentlichungen - Liedtexte, Beiträge für Zeitschriften und Bücher - verwendete sie jedoch zeitlebens das Pseudonym Eddy Beuth. Vermutlich wählte sie, wie viele Frauen ihrer Zeit, ein androgyn klingendes Pseudonym in der Hoffnung, auf diese Weise ihren Beruf ohne Vorurteile ausüben zu können und leichter Anerkennung zu finden.
|
Das Chanson begann sich gerade in Deutschland zu etablieren als Eddy Beuth ihre Arbeit als Textautorin mit den bedeutendsten Komponisten des Genres aufnahm.
Die Schauspielerin und (Chanson-)Interpretin Evelyn Förster (geb. 1955) hat die Lebensgeschichte Eddy Beuths zu ihrem Buchprojekt "Die Frau im Dunkeln" angeregt 1). Von ihr erfahren wir, dass Eddy Beuth ihre Liebe zur Literatur schon als Backfisch entdeckt habe, wie diese selber schrieb: "Ich dichtete in meinen Mußestunden zu Hause. Die Lieder einer Verlorenen, einer Verlorenen, wie ich sie mir mit 15 Jahren vorstellte; ich glaube, die Mädels in der Friedrichstrasse hätten sich totgelacht, wenn sie ihr Spiegelbild in meinem Gedichtbuch gelesen hätten. In einem Jour, den ausschließlich vornehme, alte Damen besuchten, auch meine Mutter war anwesend, trug Mirjam Horwitz 2), auch ein kleines Mädchen damals, diese überhitzten Verse vor. Wir hatten es uns so schön gedacht, daß die vornehmen alten Damen durch unsern beredten Mund das soziale Elend der Dirnen kennen lernen sollten. ( ... ) Die vornehmen alten Damen zeigten keinerlei Verständnis für diese Abart des ,sozialen Elends', erst rückten und rutschten sie verlegen auf ihren Stühlen, beim zweiten Gedicht schickten sie ihre erwachsenen Töchter 'raus, beim dritten Gedicht gab mir meine Mutter eine schallende Ohrfeige (Eddy Beuth: Cabaret und ich. Cabaret-Tanz-Revue, ohne Jahresangabe, zitiert von Evelyn Förster 2013, S. 57/58).
Auf einem Vereinsfest sei sie dem Komponisten Rudolf Nelson mit den Worten "dieses Fräulein dichtet auch", vorgestellt worden, berichtet Evelyn Förster weiter. Sein erster Besuch bei Eddy Beuth habe damit geendet, dass er eines ihrer Gedichte vertonte:
Reichst Dein Mäulchen mir zum Kuß,
Daß ich nicht mehr grolle,
Weißt's daß ich Dich lieben muß,
Süsse, kleine Tolle.
1902 wurden "Die Lieder einer Verlorenen" in der Publikation "Liebeslieder Moderner Frauen. Eine Sammlung" von Paul Grabein" im Berliner Verlag von Hermann Costenoble veröffentlicht. Das Chanson begann sich gerade in Deutschland zu etablieren, als 1904 Eddy Beuths Zusammenarbeit mit den bedeutendsten Komponisten, die sich diesem Genre verschrieben hatten, begann. Dies waren, um einige zu nennen: Rudolf Nelson, Ludwig Friedmann, Martin Knopf, Siegwart Ehrlich oder Erich Ziegler. Bis heute bekannte Diseusen wie Claire Waldoff, Elly Leonard, Käthe Erlholz, Fritzi Massary und Erika (Elli) Glässner interpretierten Chansons, deren Texte von Eddy Beuth geschrieben waren (Förster 2013, S.59).
Eine intensive, über Jahre dauernde Zusammenarbeit mit Rudolf Nelson begann ebenfalls 1904. Er leitete das Cabaret "Roland von Berlin" in der Potsdamer Straße, sie schreib Couplets für seine Bühnenshows. Ab 1907
schloss sich ihre ständige Mitarbeit im ebenso noblen wie mondänen Berliner Nachtclub "Chat Noir" in der berühmten Passage, der Kaisergalerie, zwischen Unter den Linden und Friedrichstraße an. Dort hatte die Revue "eine besondere Note, die das Verlangen eines Großstadtdurchschnitts nach leichter, halb sentimentaler und halb frivoler Musik traf. Das Talmikavaliertum einer aufsteigenden, smarten Geschäftswelt und ihre kesse, hundeschnäuzige, doch kitschig verbrämte ‚Erotik' fand den rechten Ausdruck" (Max Herrmann Neiße, zitiert in Förster 2013, S. 60f.).
1907 textete Eddy Beuth auch für das in Wien gegründete Kabarett "Die Hölle" unter anderem das Lachchanson "Nach dem Balle". Ihre gepfefferten "erotisch-gewagten oder satirisch überdeutlichen Texte wurden gekonnt graziös, lebendig, ausdrucksvoll, mit soviel mimischen Einfällen in Szene und Musik gesetzt", dass sie zu stürmischem Beifall führten (vgl. Förster 2013, S.60 f.).
Von 1906 bis 1931 publizierte sie in Zeitschriften wie Berliner Leben und diversen Verlagen. Zudem war Eddy Beuth ab 1918 als Drehbuchautorin tätig. Ihr Werk kann der expressionistischen Phase des Stummfilms zugeordnet werden. 1920 wurde an der Komischen Oper in Berlin die Operette "Die Frau im Dunkeln" uraufgeführt: "Für die Musik zeichnete der Komponist Siegfried Schulze verantwortlich, die Texte verfassten Erich Urban und Eddy Beuth. In einer Rezension aus dem Jahr 1920 in dem Gesellschaftsblatt "Elegante Welt", wurden jedoch nur die Protagonisten Erich Urban und Siegfried Schulz sowie Trude Hesterberg als Hauptdarstellerin, nicht aber Eddy Beuth erwähnt (Förster 2013, S. 62).
Im Laufe ihres Lebens verwendete bzw. trug sie verschiedene Namen und Namensvarianten wie Marie Vogel. Den Geburtsnamen ihrer Mutter hatte sie wohl durch die Adoption nach dem frühen Tode der Mutter durch ihren Onkel Josef Vogel erhalten (vgl. Eddy Beuth, Personendaten in: Lexm.uni-hamburg.de). Auch Doppelnamen während ihrer drei Ehen - wie Beuth-Sohm oder Beuth-Sack - sind in den Adressbüchern zu finden. Darüber hinaus änderten sie und ihr dritter Gatte ihren jüdisch-klingenden Namen Aronheim um in "Arnheim". Eddy Beuth alias Marie Cohn war dreimal verheiratet und ist zweimal verwitwet Anfang des 20. Jahrhunderts heiratete Beuth den Theater-Oberinspektor 3) Fritz Sohm. Nach dessen Tod im Jahre 1909 verband sie sich fünf Jahre später dem Verleger und Schriftsteller Hermann Karl Otto Sack (geb. 1886). Am 27. Mai 1918 wurde diese Ehe geschieden, woraufhin sie am 1. März 1919 den Bankbeamten Fritz Magnus Aronheim (1874-1928) ehelichte.
"Eddy Beuth war inzwischen 56 Jahre alt, und als im Jahr 1930 der dritte Mann ihrer Schwester, der Hamburger Industrielle Siegmund Freund (ehemals Geschäftsführer der Ges. f. Eisenbahn-Draisinen) verstorben war, zog sie zu ihrer Schwester nach Hamburg, wo sie bis zu ihrem gemeinsamen Tod zusammenlebten. Das Geschwisterverhältnis muss, ähnlich dem in ihrem Roman "Sehnsucht nach Glück" beschriebenen, sehr intensiv gewesen sein. Immer wieder kreuzten sich die Biographien (...). Es gibt ein Chanson über schwesterliche Seelenverwandtschaft; beide waren dreimal verheiratet und beide hatten keine Kinder.
Der letzte Lebensabschnitt war für die jüdischen Schwestern überschattet von den zunehmenden antisemitischen Repressalien. Die Gesetze der Nationalsozialisten führten auch für Eddy Beuth 1938 zum endgültigen Berufsverbot als Schriftstellerin. In der Pogromnacht im November 1938 fanden die Angriffe gegen Juden auch in Hamburg einen neuen Höhepunkt. Eine Synagoge wurde angezündet und der jüdische Friedhof geschändet, es wurden Scheiben eingeschlagen und Juden willkürlich verhaftet. Viele ältere Juden sahen nur noch in der Selbsttötung einen Ausweg. In einem ihrer der letzten Briefe schrieb Lisbeth Margot Freund: "Gebe Gott Dir die Stärke, die uns fehlt, um all das zu überstehen, was über uns verhängt ist". Als sie das schrieb, hatten sich die Schwestern bereits Gift besorgt. Am 16. Dezember 1938 wurden ihre Leichen aufgefunden. Der kurze Abschiedsbrief war datiert auf den 14. Dezember: "Hiermit erklären wir, dass wir unserem Leben freiwillig ein Ende gemacht haben. Frau Lisbeth Freund. Frau Marie Aronheim."
Der Nachlass wurde entsprechend dem Wunsch der Toten an Freunde und Verwandte verteilt, ein Rest wurde versteigert. Eine Kiste mit Manuskripten von Eddy Beuth wird nur in einem Protokoll erwähnt und taucht
dann nicht mehr auf. Der Verbleib ist ungeklärt. Einige Fotos wurden vererbt, die neue Besitzerin deportierten die Nationalsozialisten 1942 nach Theresienstadt, wo sie 1943 ums Leben kam. So wie sie wurden viele Freunde und Verwandte von Eddy Beuth ermordet.
Das Grab von Marie Aronheim alias Eddy Beuth und ihrer Schwester Lisbeth Margot Freund befindet sich auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg" (Recherchen von Jörg Engelhardt, zitiert aus Förster 2013, S. 65 - 67).
Am 29 Oktober 2014 sind vor dem Haus in der Eppendorfer Landstraße 28, in dem die Schwestern zuletzt lebten, Stolpersteine gelegt worden (stolpersteine-hamburg.de). Die Initiative hierzu kam von der Berliner Sängerin und Schauspielerin Evelin Förster und dem Museologen Jörg Engelhardt.
Text: Cornelia Göksu
Quellen:
1) Evelin Förster: Die Frau im Dunkeln. Autorinnen und Komponistinnen des Kabaretts und der Unterhaltung von 1901 bis 1935. Eine Kulturgeschichte. Mit Textbeiträgen von Anja Köhler und Jörd Engelhardt. Berlin 2013; mit einem umfangreichen, sorgfältig recherchierten Werkverzeichnis und Abbildungen von S. a206-217 = Förster 2013
2) Mirjam Horwitz (1882-1967) leitete zusammen mit ihrem Ehemann Erich Ziegel (1876-1950) bis 1926 die Hamburger Kammerspiele am Besenbinderhof, zur damaligen Zeit eine der wichtigsten deutschsprachigen Bühnen außerhalb von Berlin.
3) Verantwortlicher Koordinator von Bühnen- und Lichttechnik sowie allen Abläufen rund um die Theatervorstellung.
|
|
 |
 |
 |
| Hertha Borchert, geb. Salchow |
 |
 |
| 17.2.1895 Altengamme - 26.2.1985 Hamburg |
| Vierländer Schriftstellerin und Mutter des Schriftstellers Wolffgang Borchert |
Ohlsdorfer Friedhof, Grab Nr. AC 5,6, am Fuß des Hügels
Borchertring, Steilshoop (1973), benannt nach Wolfgang Borchert (1921-1947), Schriftssteller
Wolfgangs Mutter Hertha, geb. Salchow war Vierländer Schriftstellerin.Hertha Salchow wurde am 17. Februar 1895 in den Vierlanden im Schulhaus in Altengamme als fünftes Kind des dortigen Lehrers Carl Salchow geboren. Bald zog die Familie ein Stück weiter in das Schulhaus in Kirchwerder. Hertha war der Nachkömmling der Familie, eine uninteressierte und schlechte Schülerin, die aber als einzige in der Familie ein echtes Vierländer Platt beherrschte. Sie liebte die Landschaft und die Menschen ihrer Heimat.
Als der Junglehrer Fritz Borchert aus Mecklenburg auftauchte, war Hertha ganze 16 Jahre alt. Die beiden verliebten sich ineinander, und Hertha machte die beglückende Erfahrung, dass es einen Menschen gab, der sich nicht daran störte, dass sie selbst in der Dorfschule kaum mitgekommen war:
|
"Ja, es war ein Ereignis geschehen, und das Ereignis war gravierend und umwälzend, ich war nicht mehr allein. Und das war für mich das Außergewöhnliche an diesem Ereignis, dass Wissen und Nichtwissen kleingeschrieben war, denn das Ereignis hatte mich gewählt, so wie ich war", 1) schreibt Hertha Borchert in ihren Lebenserinnerungen. Bald merkte sie jedoch, dass es etwas für ihn gab, an dem sie keinen Anteil hatte: die Welt der Bücher. Er versuchte, sie durch Vorlesen behutsam an diese Welt heranzuführen, sie versuchte, ihn darüber zu täuschen, dass sie sich dabei langweilte. Dennoch war da so viel Gemeinsames, dass sie beschlossen zu heiraten.
Die Aufnahme im Hause der zukünftigen Schwiegereltern war so unfreundlich, dass das junge Mädchen einen Schock erlitt, der sich über viele Jahre in zeitweiligen Zuständen der Apathie wiederholte. Aber auch die eigenen Eltern zeigten weinig Begeisterung, weil Hertha zu jung und Fritz ohne feste Anstellung war. Sie verlangten eine Wartezeit von zwei Jahren, in der Hertha eine Haushaltsschule in Winsen besuchte, um Kochen und Nähen zu lernen, und Fritz Borchert in einer Volksschule in Hamburg-Eppendorf unterrichtete, wohin er auf Veranlassung von Herthas Vater versetzt worden war. Am 29. Mai 1914 war es dann soweit: Im Schulhaus wurde eine große Hochzeit gefeiert. Danach zog das Paar in die Tarpenbekstraße 82 in Hamburg-Eppendorf, wo später auch der Sohn Wolfgang geboren wurde. Für die junge Frau begann ein neues Leben.
Nich ohne ein gewisses Zaudern hatte sie die ländliche Umgebung gegen eine Etagenwohnung im Hamburger Stadtgebiet getauscht, die "Lüd' vun `n Diek" gegen den Freundeskreis ihres Mannes: die Maler Paul und Martin Schwem,er, den Barlach-Freund Friedrich Schult, den Bildhauer Opfermann, den Pädagogen und Schriftsteller Höller und Karl Lorenz, den Graphiker, Schriftsteller, Dadaisten und Gründer der Zeitschrift "Die rote Erde", in der u. a. expressionistische Autoren und Maler veröffentlichten. Sie fühlte sich wohl in diesem Boheme-Kreis, wollte mitreden können. Sie begann - zunächst in halbstündigen Etappen - sich durch die gesamte Geschichte durchzukämpfen, angefangen bei der Völkerwanderung! Dann machte sie sich an die Literatur, las querbeet Droste-Hülshoff, Dehmel, Falke, Tieck, Hölderlin, Stifter und lernte Dada-gedichte auswendig, weil sie die am leichtesten behalten konnte. Ihr Mann war ihr ein unermüdlicher Helfer; kein Lehrer, ein formender Künstler, wie sie schreibt.
Der Erste Weltkrieg brach aus. Fritz Borchert musste wegen einer Sehschwäche zwar nur als Sanitäter ins Hinterland, ruinierte seine Gesundheit aber dennoch. Die Welt der Kunst wurde für das Ehepaar zum "Fluchtpunkt und Ausweg" 2). Sie erwarben ein Erstaufführungsabonnement für die nach Kriegsende als Alternative zum Schauspielhaus gegründeten Hamburger Kammerspiele am Besenbinderhof, wo vornehmlich zeitgenössische, oft avantgardistische Theaterstücke gespielt wurden, und traten dem "Freundeskreis der Hamburger Kammerspiele" bei. Ein neuer Kreis um den Schriftsteller und Redakteur der "Hamburger Zeitung" H. W. Fischer, zu dem der Bildhauer Wield, die Tänzerinnen Jutta von Collande, Gertrud und Ursula Falke, der Dichter Robert Walter und Carl Albert Lange gehörten, öffnete sich ihnen. Man las gemeinsam moderne Dramen und diskutierte. Was Hertha Borchert schon im Umfeld Schwemers gewundert hatte, verstand sie auch hier nicht: was fanden alle diese Künstlerinnen und Künstler an ihnen, dem bürgerlichen Paar, dass sie es als freunde betrachteten?
Im siebenten Ehejahr meldete sich das langersehnte Kind an: "Ich war längst nicht mehr das frische Landmädchen. Ich war blaß geworden und sehr empfindsam. Es wurde deutlich, daß ich diese 7 Jahre zu meiner Entwicklung gebraucht hatte."3)
Mit der Geburt des Sohnes Wolfgang am 20. Mai 1921 begann die wohl glücklichste Zeit im Leben Hertha Borcherts, wie sie aus dem Rückblick meint. Man lebte sehr nahe zu dritt beieinander, der Freundeskreis kam jetzt ins Haus. Die Bildhauerin Lola Töpke, die später von den Nationalsozialisten, vermutlich am 6. Dezember 1941, nach Riga deportiert wurde, regte Hertha Borchert zum Modellieren in Ton an. Glaubte sie zunächst nicht an ihr Talent, arbeitete sie bald nächtelang wie besessen.
Dann kam Wolfgang in die Schule, sie war vormittags wieder alleine, fühlte sich einsam. Hinzu kam die Bangsche Krankheit, die sie sich auf einer Ferienreise durch das Trinken roher Milch zugezogen hatte und die sie oft, isoliert von der Außenwelt, fiebernd ans Bett fesselte. Bilder der Heimat tauchten auf. Die Anschaffung eines Schrebergartens bot keine Lösung, die körperliche Arbeit war zu schwer für Fritz und Hertha Borchert. Als der Freund Paul Schwemer mit Erleichterung das Scheitern des in seinen Augen ohnehin lächerlichen Unterfangens konstatierte, fing Hertha Borchert an, von ihrer Kindheit zu erzählen, von der Landschaft, von den Menschen und ihrer Art zu leben. Die beiden Männer hörten zunehmend gebannt zu, und Fritz Borchert beschwor seine Frau nicht nur, diese Geschichten aufzuschreiben, sondern schickte eine davon heimlich an die "Hamburger Nachrichten", wo sie am 4. Dezember 1927 erschien: "Und ich schrieb in meiner Heimtsprache, wie ich dort draußen mit den Leuten sprach. Ich schrieb ganz hilflos in ein Schulheft - und diese erste Geschichte wurde gedruckt (…). Mir war nun geholfen. Ich vergaß die engen Zimmer und schrieb und trieb mich mit meinen Gestalten draußen an den Deichen herum." 4) In der Folge entstanden unzählige Geschichten, Gedichte und Hörfolgen auf Plattdeutsch, die im "Quickborn" und in der "Mooderspraak" gedruckt oder im Rundfunk ausgestrahlt wurden. Hertha Borchert gehörte fortan zu dem anerkannten Kreis niederdeutscher Schriftsteller.
Mit diesem Erfolg wandelte sich auch ihr Umfeld: Aline Bußmann, Schauspielerin an der Niederdeutschen Bühne, die Hertha Borcherts Texte im Rundfunk las, Bernhard Meyer-Marwitz und Hugo Sieker, Redakteure des "Hamburger Anzeigers", waren die neuen Freunde, die sie nicht mit ihrem Mann teilte: "Den Niederdeutschen Kreis hatte ich mir gewählt und in ihm stand man still und verläßlich auf der Erde. Und doch war dies die Welt, in der ich schöpferisch werden sollte. Mein Mann wurde jetzt Betrachter. Immer war er sonst der Initiator gewesen. Er war für mich mein Halt und die Geborgenheit. Die verbindende Atmosphäre blieb unangetastet. Das Leben spannungsgeladen hatte uns umgeformt, aber zu viel trug ich von ihm und eigentlich ging ich jetzt den sehr eigenen Weg, den er mir gebahnt hatte." 5) Sie wurde in die GEDOK (Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnen) aufgenommen, ein weiterer Schritt zur Selbstständigkeit.
Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten änderte Hertha Borcherts Leben zunächst nicht einschneidend. 1934 erschienen sechs unpolitische heitere Erzählungen unter dem Titel "Sünnroos un anner Veelanner Geschichten" im 48. Band der Reihe "Plattdütsch Land und Waterkant", die ein gutes Lebensbild der Zeit geben. 6) 1936 dann wurde Hertha Borchert von einem mißgünstigen Nachbarn, der lieber seine eigenen Arbeiten veröffentlicht sehen wollte, denunziert. Die Sache verlief glimpflich, es wurde Hertha Borchert jedoch nahegelegt, in die "Nationalsozialistische Frauenschaft" einzutreten. Fortan hielt sie Lesungen in Ortsgruppen und reiste, als der Krieg ausgebrochen war, zwecks Truppenbetreuung wochenlang durchs Land. Der Sohn Wolfgang war inzwischen längst in die Fänge des nationalsozialistischen Machtapparats geraten. Schon im Frühjahr 1940 wegen des Verdachts der Homosexualität vorgeladen, wurde er 1942 wegen einer Verletzung an der linken Hand, die als Selbstverstümmelung an der Front ausgelegt wurde, unter Anklage gestellt, dann aber freigesprochen. Noch im selben Jahr wurde er in einem zweiten Prozess wegen mündlicher und brieflicher Äußerungen, die als Angriff auf den Staat gewertet wurden, zu vier Monaten Haft verurteilt. 1943, kurz vor seiner Entlassung als Frontuntauglicher aufgrund fortdauernder schwerer Krankheit, wurde er dann wegen einer Parodie auf Goebbels in der Jenaer Kaserne erneut eingesperrt. Die Eltern versuchten ihn durch Besuche zu stärken und ihm beizustehen.
Als am 10. Mai 1945 die Nachricht kam, Wolfgang sei aus französischer Gefangenschaft geflohen und habe sich bis zur Elbe durchgeschlagen, machte sich Hertha Borchert auf den Weg in die Vierlande. Als sie ihren Sohn auf dem Elbdeich sah, erkannte sie ihn nicht. Schwerkrank kehrte er nach Hause zurück. Die Familie wohnte seit der Denunziation durch den Nachbarn in Alsterdorf, in der Mackensenstraße 80 (heute Carl-Cohn-Straße). Nach Monaten des Hoffens und Bangens starb Wolfgang Borchert am 20. November 1947, einen Tag bevor sein Theaterstück "Draußen vor der Tür" in den Hamburger Kammerspielen uraufgeführt wurde.
"Ich pflegte ihn zwei Jahr lang, und die Sorge um ihn schlug mir die Feder aus der Hand. Aber dafür blühte sein Werk auf. Er arbeitete mit einem fieberhaften Eifer, sodaß in unserer Wohnung für nichts anderes Raum war. Es war ein Erlebnis, ihm beim Schreiben zuzusehen. Jedes Wort, das er schrieb, war Befreiung aus innerster Not. Er zwang uns, sein Leben mitzuleben, und weil es so schnell und steil hinaufging, nahm es uns allen den Atem. Nach Wolfgangs Tod bleibt uns nur die Aufgabe, nach der Fülle dieses Schmerzes und dieses Glückes den Rest unseres Lebens auszurichten und unseres Sohnes Anklage an die Welt weiterzugeben", 7) beschrieb Hertha Borchert 1948 ihre Profession. Die Eltern besuchten gemäß dem Vermächtnis ihres Sohnes anfangs fast alle Aufführungen von "Draußen vor der Tür". Sie empfingen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt, die ihnen nahe sein und von ihrem Sohn Wolfgang hören wollten, und folgten deren Einladungen.
Der Biograph Wolfgang Borcherts, Claus B. Schröder, 8) beurteilt das Verhältnis von Mutter und Sohn nicht so harmonisch. Aus dem Sachverhalt, dass die Trennung von der Mutter ein zentrales Motiv in den Dichtungen Wolfgang Borcherts ist, besonders der Text "Meiner Mutter zu meinem Geburtstag", den er in der Nacht zu seinem 25. Geburtstag schrieb, schließt Schröder auf einen realen Mutter/Sohnkonflikt, eine nie wirklich gelungene Loslösung von der Mutter. Aber schon die Tatsache, dass das Motiv der Mutter bei Borchert zumeist mit dem Motiv der Geliebten verknüpft ist, lässt eher an die Sehnsucht nach einem paradiesischen Zustand des Einsseins denken, die leicht nachvollziehbar ist bei einem so jungen und sensiblen Mann, den die männerbündlerisch-faschistische Ideologie abstieß und der sich vollkommen isoliert fühlte.
Nach dem Tode ihres Mannes 1959 wusste Hertha Borchert zunächst nicht, wie es weitergehen sollte, doch bald sammelte sie ihre Kräfte und ging den gemeinsam begonnenen Weg im Dienste des Sohnes weiter: "Un winn se hier in `n Hus bie mi ankloppt, kummt Wolfgang jümmer weller mit jüm rin de Dör. So sünd se jümmer oberall dor mit bie, mien Jung und sein' Vatter. Ook op de anner Siet vun uns Erd', dor weuren se ook beide an mi, u nick nicht alleen." 9)
Am 26. Februat 1985, neun Tage nach ihrem 90. Gebrutstag, starb Hertha Borchert."
Text: Brita Reimers
Quellen:
1) Hertha Borchert: Vergangenes Leben. Unveröffentlichtes Manuskript im Wolfgang-Borchert-Archiv.
2) Ebenda.
3) Ebenda.
4) Ebenda.
5) Ebenda.
6) Ein vollständiges Werkverzeichnis von Jürgen Meier und Irmgard Schindler erstellt, findet sich im Jahresheft der Internationalen Wolfgang-Borchert-Gesellschaft e. V. Heft 6 (1994).
7) Hertha Borchert: Ruf der Mütter, in: Barbara Nordhaus-Lüdecke (Hrsg.): Der Ruf der Mütter. München 1948.
8) Vgl.: Claus B. Schröder: Draußen vor der Tür. Eine Wolfgang-Borchert-Biographie. Berlin 1988.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Lisbeth Bruhn, geb. Holz |
| 26.12.1893 - ermordet am 14.2.1944 im KZ Neuengamme |
| Widerstandskämpferin der Widerstandsgruppe Bästlein- Jacob-Abshagen. Hausfrau |
Grab: Ehrenhain Hamburger Widerstandskämpfer 1933-1945, L 5 256-310
Stolperstein vor dem Wohnhaus Schellingstraße 16 und vor dem Wohnhaus, in dem sie Unterschlupf gefunden hatte: Bogenstraße 23.
Das Ehepaar Bruhn war seit seiner Jugend politisch tätig. 1942 schloss sich Gustav Bruhn (16.3.1889 Angermünde - ermordet am 14.2.1944) der Bästlein-Jacob-Abshagen-Widerstandsgruppe an. Elisabeth und Gustav Bruhn wurden am 14. Februar 1944 ohne Gerichtsurteil im KZ Neuengamme erhängt.
|
Gustav Bruhn stammte aus einer Eisenbahnerfamilie in Angermünde in der Uckermark. Sein Vater war der Stellwerksmeister Wilhelm Bruhn, seine Mutter Minna, geborene Ziegler. Gustav besuchte die Volksschule. Nach dem Abschluss der Tischlerlehre arbeitete er in mehreren Städten Deutschlands in seinem Beruf. 1909 wurde er zum dreijährigen Militärdienst bei der I. Marinedivision in Kiel einberufen. 1912 trat er in Hannover in die SPD ein und war seitdem in der Arbeiterbewegung politisch aktiv.
Elisabeth Bruhn, geborene Holz, stammte aus einer Arbeiterfamilie. Ihre Eltern, der Landarbeiter Johann Heinrich Holz und Catharina Margaretha, geborene Peters, fühlten sich der Arbeiterbewegung zugehörig. Sie lebten mit ihren sechs Kindern lange in Lunden nahe Groven in Dithmarschen. 1921 war Elisabeths Vater Leiter der KPD-Ortsgruppe Lunden.
Elisabeth musste schon früh als Kindermädchen zum Lebensunterhalt der elterlichen Familie beitragen. Nach der Schulzeit ging sie nach Kiel. Dort fand sie eine Anstellung als Haushaltshilfe. Später verdiente sie ihren Lebensunterhalt als Arbeiterin.
Gustav Bruhn und Elisabeth Holz lernten sich in Kiel kennen. Sie heirateten am 25. Januar 1913 in Lunden. Ihr Sohn Heinrich, der spätere Hochschullehrer in Leipzig, wurde am 29. Januar 1913 in Lunden geboren. Ihre spätere Schwiegertochter berichtete nach dem Zweiten Weltkrieg von einem zweiten Sohn, der Otto hieß und als Soldat der Wehrmacht bei Stalingrad verschollen sei. Über diesen Sohn ist Näheres nicht überliefert.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde Gustav Bruhn zur Matrosen-Division nach Wilhelmshaven eingezogen. Bis 1915 fuhr er auf dem Linienschiff "Woerth". Dann wurde er dem "Marinecorps Flandern" zugeteilt und diente bis Kriegsende in einer Pionierkompanie in Flandern. Der Kriegsgegner Gustav Bruhn entwickelte sich in einem längeren Prozess zum Anhänger des Spartakusbundes. Dahin führten ihn nicht zuletzt die Nachrichten vom Sturz des Zarenregimes in Russland und von den Matrosenaufständen auf dem Schlachtschiff "SMS Prinzregent Luitpold" Anfang August 1917.
Elisabeth Bruhn teilte die politischen Überzeugungen ihres Mannes und nahm zeitlebens an seinen politischen Kämpfen teil. Sie war seit 1919 politisch organisiert. Während der Kriegszeit zog Elisabeth Bruhn nach Hannover. Sie verdiente ihren Lebensunterhalt als Kolonnenarbeiterin bei der Eisenbahn. In dieser Zeit kam auch sie in Kontakt mit dem Spartakusbund.
Nach dem Ersten Weltkrieg fand die Familie Bruhn wieder zusammen. Sie bekam in Heide/ Holstein in der Westerstraße eine Wohnung. Noch in den Tagen der Novemberrevolution 1918 sprach Gustav Bruhn in Soldatenuniform zur Heider Bevölkerung und war bald als "Roter" in Dithmarschen bekannt. Er wechselte noch während des Krieges von der SPD zur USPD, anderen Quellen zufolge erst 1919. Zusammen mit dem Redakteur Carl Metze und dem Kaufmann Paul Burmähl war er in Heide und Umgebung einer der bekanntesten USPD-Vertreter. Im Oktober 1920 gründete er die Ortsgruppe Heide der Kommunistischen Partei Deutschlands mit. 1921, auf dem VII. KPD-Parteitag in Jena, zählte er bereits zu den Delegierten. 1923 wurde er Vorsitzender der KPD in Heide.
Auch Elisabeth Bruhn trat 1920 in die KPD ein. Sie leitete in Heide zunächst den Jung-Spartakus-Bund, in dem Kinder von 10 bis 14 Jahren organisiert und an die Ziele der KPD herangeführt werden sollten.
Als am 13. März 1920 unter Leitung von Wolfgang Kapp und Walther von Lüttwitz Reichswehrangehörige und ehemalige Angehörige der alten Armee und Marine versuchten, die legale Reichsregierung zu stürzen (Kapp-Putsch), unterstützte in Heide der Garnisonsälteste Hauptmann von Liliencron zusammen mit dem örtlichen Postdirektor die Putschisten. Der Bürgermeister verhielt sich unentschieden. Der Heider Arbeiterrat verhaftete von Liliencron in der Nacht vom 13. auf den 14. März. Während der am Sonntag, dem 14. März, im Heider Tivoli abgehaltenen großen Volksversammlung sprachen Carl Metze und Gustav Bruhn. Bruhn: "Man sucht uns zu entreißen, was wir an Freiheit errungen haben. Die neue Regierung bringt uns weder Frieden noch Brot, dafür aber Krieg! Und das Volk soll geknebelt und geknutet werden." Gustav Bruhn wurde in einen neuen Arbeiterrat gewählt und zum Beigeordneten für den nationalkonservativen Landrat bestimmt. Unbeschadet seiner zunehmend auch überregionalen Wirksamkeit konzentrierten sich Gustav Bruhns politische Aktivitäten in den nächsten Jahren auf Heide und Dithmarschen. Als exponierter Kommunist hatte Gustav Bruhn bald kaum noch eine Chance auf einen Arbeitsplatz. Es wird berichtet, dass Arbeitgeber, die ihn einstellen wollten, davon abgehalten wurden. Also versuchte Elisabeth Bruhn, den Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen.
Als am frühen Morgen des 23. Oktober 1923 der Hamburger Aufstand begann, standen von Gustav Bruhn und seinen Genossen geführte Arbeiter und Bauern auch in Heide bereit einzugreifen. Dazu kam es jedoch nicht. Die Polizei verhaftete Gustav Bruhn und einen Teil seiner politischen Freunde. Angesichts von drei Hundertschaften der "Roten Arbeiterwehr" der Maschinenfabrik Köster, die die Freilassung notfalls erzwingen wollten, wurden die Gefangenen von Heide nach Flensburg überführt und in "Schutzhaft" genommen. Eine Inhaftierung ohne Verurteilung oder dringenden Tatverdacht wurde schon in der Weimarer Republik als "Schutzhaft" bezeichnet. In den ersten Krisenjahren der Weimarer Republik wurden "Schutzhäftlinge", wobei es sich meist um Kommunisten handelte, in Lagern untergebracht.
Nach seiner Haftentlassung 1924 setzte Gustav Bruhn seine politische Tätigkeit fort.? Er wurde zum Stadtverordneten in Heide und zum Kreistagsabgeordneten von Norderdithmarschen gewählt. Außerdem war er Abgeordneter des Provinziallandtages in Kiel. 1924 delegierte ihn die KPD zum V. Weltkongress der Kommunistischen Internationale nach Moskau. Ab 1925 arbeitete er als Parteisekretär und Unterbezirksleiter in Heide und Itzehoe.
Am 30. Januar 1926 gründete sich die Ortsgruppe Heide der NSDAP im Heider Tivoli. Bereits vorher hatten sich mehrere NSDAP-Ortsgruppen in Dithmarschen gebildet, darunter auch in Lunden, dem früheren Wohnort der Familie Bruhn. Diese Entwicklung erfüllte Gustav Bruhn mit großer Sorge. In einem Bericht des damaligen Ortsgruppenleiters in der Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der NSDAP wird Gustav Bruhns oppositionelles Auftreten in der Gründungsversammlung erwähnt.
Ab 1927 arbeitete Gustav Bruhn als Parteisekretär und Unterbezirksleiter der KPD in Lübeck. Seine Familie blieb in Heide. Als Gustav Bruhn von einer Versammlung aus Meldorf kam, wurde er auf dem Heider Bahnhof verhaftet. Ihm wurde der Vertrieb einer illegalen Broschüre (Willy Sachse: Anti-Nautikus - Deutschlands revolutionäre Matrosen) vorgeworfen. Der 4. Strafsenat des Reichsgerichts verurteilte Gustav Bruhn am 25. September 1927 zu neun Monaten Festungshaft und 100 Mark Geldstrafe wegen Vorbereitung zum Hochverrat in Tateinheit mit Vergehen gegen § 7 des Republikschutzgesetzes. Ziel dieses Gesetzes aus dem Jahre 1922 war es, alle republikfeindlichen monarchistischen Organisationen zu verbieten oder handlungsunfähig zu machen, es richtete sich in der Praxis zugleich gegen linke Bestrebungen. Gustav Bruhn sollte die Haftstrafe auf der Festung Gollnow in der damaligen preußischen Provinz Pommern in der Nähe von Stettin (heute: Szczecin) verbüßen.
Während der Festungshaft erhielt Gustav Bruhn zwei Tage Hafturlaub für die Teilnahme an der Jugendweihe seines Sohnes. Über die Haftbedingungen ist nur wenig bekannt. Am 20. Mai 1928 wurde Gustav Bruhn für die KPD als Abgeordneter des Preußischen Landtags gewählt, dem er bis 1932 angehörte. Die durch das Landtagsmandat gewonnene parlamentarische Immunität beendete seine Festungshaft. Nun zog die Familie in das damals preußische Altona. Der Sohn Heinrich wechselte nach Beendigung der Schulzeit nach Berlin und begann dort 1928 eine kaufmännische Lehre bei der Firma "Derutra" (Deutsch-Russische Transport-Aktiengesellschaft).
Gustav Bruhn übernahm nun zusätzlich die Funktion des Unterbezirkssekretärs in Kiel, später in Hamburg. 1930 lautete seine Adresse Kiel, Annenstraße 59. Er gehörte dem Plenum und der Bezirksleitung Wasserkante der KPD an. In den Akten der Kriminalpolizei Lübeck ist für Ende 1931 als Adresse die Beckergrube 29 in Lübeck festgehalten.
Es kann davon ausgegangen werden, dass Gustav Bruhn unter polizeilicher Beobachtung stand. Eine "Nachrichtensammelstelle" des Reichsministeriums des Innern zog Informationen über "KPD-Zersetzung - Tätigkeit in der Reichswehr und Polizei" in der gesamten Republik ein. Die Kriminalpolizei Lübeck hatte einen V-Mann auf Gustav Bruhn angesetzt und berichtete ab Anfang Oktober 1931 nach Berlin. Danach soll Gustav Bruhn mit einer in einem Ministerium beschäftigten weiblichen Person befreundet gewesen sein, die ihm Zuträgerdienste geleistet habe. Wenig später wurde berichtet, "die Ermittlungen über die ‚Freundin' des Bruhn und die angebliche Villa in Tempelhof [seien] ergebnislos verlaufen".
In Erwartung der Machtübernahme der NSDAP traf die KPD Vorsorge für den Fall ihres Verbots und des dann folgenden illegalen Widerstands in Hamburg und Schleswig-Holstein. Daran beteiligt waren viele Funktionäre der Bezirksleitung Wasserkante, darunter auch Gustav Bruhn.
Vom 26. April bis zum 17. Juni 1933 wurde Gustav Bruhn in so genannte Schutzhaft im KZ Fuhlsbüttel genommen. Nach seiner Entlassung nahm er die Parteiarbeit für die KPD sofort wieder auf. Sein Aktionsfeld erweiterte sich jetzt bis nach Hannover. Überliefert ist auch ein Aufenthalt in Minden mit dem Ziel, Verbindung zur dortigen illegalen KPD-Organisation aufzunehmen.
Im September 1933 wurde er erneut verhaftet. Seine Haftkarteikarte weist aus, dass er am 13. Oktober 1933 in das Untersuchungsgefängnis Hamburg eingeliefert und am 27. Juni 1934 nach Hannover überstellt wurde. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Am 9. August 1934 brachte man Gustav Bruhn nach Hamburg in das Untersuchungsgefängnis zurück. Er wurde am 1. März 1935 nach Berlin überstellt. Am 14. März 1935 verurteilte ihn der Volksgerichtshof in Berlin wegen "Vorbereitung zum Hochverrat" zu drei Jahren Zuchthaus. Unter Anrechnung der bereits erlittenen Untersuchungshaft endete diese Haftzeit 1937. Es ist nicht bekannt, wo Gustav Bruhn die Haftzeit verbrachte. Sein Sohn Heinrich berichtete später, Gustav Bruhn habe die Zuchthausstrafe in Rendsburg abgesessen. Dafür lassen sich Belege jedoch nicht finden.
Anschließend an die Zuchthausstrafe wurde Gustav Bruhn am 16. April 1937 im Konzentrationslager Sachsenhausen als "rückfälliger Schutzhäftling" eingeliefert. Zu derselben Zeit befanden sich dort auch andere führende Kommunisten, u. a. aus Hamburg Bernhard Bästlein, Robert Abshagen, Hans Christoffers, Franz Jacob, Adolf Wendt.
Auch Elisabeth Bruhn bekam die Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu spüren. Sie wurde verhaftet und am 5. April 1934 in das KZ Fuhlsbüttel eingeliefert. Als ihre Adresse wurde Heinrich-Dreckmannstraße 1 (heute: Susannenstraße im Stadtteil Sternschanze) notiert. Es folgten Untersuchungshaft und die Verurteilung zu zwei Jahren Gefängnis wegen Wiederaufbaus der verbotenen Kommunistischen Partei. Die Haftstrafe begann am 25. September 1934. Vollzugsanstalt war das Frauengefängnis Lauerhof in Lübeck. Lina Knappe, eine ebenfalls in Lübeck-Lauerhof einsitzende junge Kommunistin, äußerte sich später: "Wir hatten das Gefühl, als wären sie [Elisabeth Bruhn und die weitere Gefangene Maria Cords] unsere Mütter, die sich um uns sorgten. Das gab uns Kraft und Zuversicht, und wir holten auch gesundheitlich wieder auf." Am 5. April 1936 wurde Elisabeth Bruhn entlassen und nahm die politische Arbeit unverzüglich wieder auf. Schon im Herbst 1936 wurde sie erneut verhaftet und wieder ins KZ Fuhlsbüttel eingeliefert. Mit ihr wurden auch ihr Sohn Heinrich und dessen Ehefrau gefangen genommen. Aus Mangel an Beweisen kam Elisabeth Bruhn am 18. Januar 1937 wieder frei.
Das nationalsozialistische Regime fühlte sich in den Jahren 1937 bis 1940 seiner Macht sehr sicher. Nur so lässt sich erklären, dass in dieser Zeit eine Anzahl führender Kommunisten aus der KZ-Haft freigelassen wurden, darunter im April 1939 auch Gustav Bruhn. Nach seiner Entlassung aus dem KZ Sachsenhausen war Gustav Bruhn erneut im Widerstand gegen die Nationalsozialisten aktiv. Auch die anderen Freigelassenen suchten die Verbindung zu Hamburger Kommunisten und anderen Widerständlern. Im Herbst 1941 konstituierte sich eine Widerstandsgruppe unter Einbeziehung bereits vorhandener illegaler Zirkel und Widerstandsgruppen. Sie sollte hauptsächlich in den Hamburger Großbetrieben verankert sein und wurde als Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe bekannt. Robert Abshagen gewann Gustav Bruhn laut Anklageschrift des Oberreichsanwalts am Volksgerichtshof im Frühjahr 1942 zur Mitarbeit. Zum inneren Kern der Gruppe zählten etwa 210 Männer und Frauen, darunter auch einige SPD-Leute und Gewerkschafter. In den Jahren 1943 bis 1945 wuchs die Gruppe auf mindestens 300 Personen an. Sie unterhielt u. a. Kontakte zum Widerstand der Schulze-Boysen/Harnack-Gruppe in Berlin und bildete einen bedeutenden Schwerpunkt des Widerstandes in Deutschland.
Die Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe war zunächst in Einzelgruppen in diversen Großbetrieben organisiert, bald schon wurden Industriegruppen für einzelne Branchen, z. B. Bauindustrie, Metallindustrie, gebildet. Gustav Bruhn übernahm die Leitung der Industriegruppe "Metall" von Oskar Reincke, einer der Leitungspersonen der Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe, und lernte wenig später Paul Thürey (siehe: Thüreystraße, in diesem Band) kennen, der die Widerstandsarbeit bei den Conz-Elektromotoren-Werken in Hamburg-Bahrenfeld organisierte. Gustav Bruhn erhielt Informationen über Belegschaftsstärke, Produktion, Stimmung unter der Belegschaft, Lohnverhältnisse und Akkordsystem. Auf diesem Wege beschaffte er auch Informationen über russische Zwangsarbeiterinnen bei den Conz-Werken. Über die Klöckner Flugmotorenbau GmbH in Hamburg-Billbrook erhielt er Informationen von dem Maschinenschlosser Hans Köpke, der am 26. Juni 1944 nach einem Todesurteil des Volksgerichtshofes im Untersuchungsgefängnis Hamburg hingerichtet wurde.
Die Aktivitäten der Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe blieben den Nationalsozialisten nicht verborgen. Sie starteten eine umfangreiche Verhaftungswelle, deren erste Opfer am 18. Oktober 1942 neben anderen Gustav und Elisabeth Bruhn wurden. Beide waren intensiven Verhören und schweren Folterungen ausgesetzt. Ihr Sohn Heinrich erfuhr von der Gefangennahme dadurch, dass Post zurückkam mit dem Vermerk: "Verhaftet". Ein Mithäftling (Heinz Gerhard Nilsson) berichtete später, Gustav Bruhn sei während der Vernehmungen misshandelt worden.
Am 23. März 1943 waren die Voruntersuchungen der Gestapo gegen Gustav und Elisabeth Bruhn so weit fortgeschritten, dass beide aus dem inzwischen in Polizeigefängnis umbenannten KZ Fuhlsbüttel in das Untersuchungsgefängnis Hamburg überstellt wurden. Ihre Adresse auf beiden Haftkarteikarten lautete Schellingstraße 33.
Es wird angenommen, dass die Prozesse gegen das Ehepaar Bruhn und weitere Angehörige der Hamburger Widerstandsorganisation im Frühsommer 1943 beginnen sollten. Doch dazu kam es nicht. Elisabeth und Gustav Bruhn saßen während der verheerenden Luftangriffe der englischen Luftwaffe Ende Juli 1943 im Untersuchungsgefängnis an der Straße Holstenglacis. Durch diese als "Aktion Gomorrha" bezeichnete Luftoffensive, die große Teile Hamburgs Ende Juli/Anfang August 1943 in Schutt und Asche legte, entstand auch in den staatlichen Sicherheitsorganen ein Chaos. Das Stadthaus, die Hamburger Gestapozentrale, wurde zerstört. Die Gestapo und der Justizapparat waren vorübergehend nicht arbeitsfähig. Unter dem Eindruck der Verwüstungen beschloss die Hamburger Staatsanwaltschaft, etwa 2000 Hamburger Untersuchungshäftlingen Haftverschonung zu gewähren. Rund 70 Mitglieder der Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe erhielten zwei Monate Hafturlaub vom 31. Juli 1943 bis 1. Oktober 1943, verbunden mit der Auflage, keine "Verbindung mit Tatgenossen" aufzunehmen. Gustav Bruhn kam am 2. August 1943 frei. Er hatte seinen Genossen noch vor der Entlassung vorgegeben, sich in den nächsten Tagen zu einer Beratung über die neue Situation zusammenzufinden. Etwa 20 der Beurlaubten beschlossen dabei, sich nach Ablauf der Frist nicht wieder verhaften zu lassen, sondern sich bis zum Kriegsende verborgen zu halten.
Gustav und Elisabeth Bruhn tauchten unter und wechselten fortlaufend die Quartiere. Gustav Bruhn wohnte illegal bei Käthe und Richard Tennigkeit (siehe: Tennigkeitweg, in diesem Band) in Hamburg-Berne, die ihren Widerstand gegen die NS-Diktatur mit dem Leben bezahlten. Adolph Kummernuß, der spätere ÖTV-Vorsitzende, berichtete nach dem Kriege, er habe Gustav Bruhn ein- oder zweimal bei Tennigkeits getroffen. Gustav Bruhn nahm die illegale politische Arbeit wieder auf, u. a. mit seinen kommunistischen Freunden Walter Bohne und Hans Hornberger. Walter Bohne wurde bei seiner Verhaftung am 5. Januar 1944 von Gestapobeamten erschossen.
Zwischen Ende September und Ende Oktober 1943 hielt sich Gustav Bruhn in Hannover auf. Zurück in Hamburg wohnte er zunächst bei dem Kommunisten Friedrich (Fiete) Löhn in der Kanalstraße 33, den er durch Adolf Schröder, einen illegal bei Klara Dworznick in der Bogenstraße 23 lebenden Kommunisten, kennengelernt hatte. Bei Fiete Löhn wurde Gustav Bruhn mit dem verdeckt arbeitenden früheren Kommunisten, Spanienkämpfer und späteren Gestapo-Agenten Alfons Pannek bekannt. Dieses Zusammentreffen sollte ihm schließlich zum Verhängnis werden.
Elisabeth Bruhn fand Unterschlupf bei ihrer Freundin, der Kommunistin Klara Dworznick in der Bogenstraße 23 in Hamburg-Eimsbüttel, die sie schon viele Jahre kannte. Auch Gustav Bruhn hielt sich tageweise in der Bogenstraße 23 auf. Alfons Pannek erschlich sich Gustav Bruhns Vertrauen und verschaffte ihm ein Quartier in seiner und Else Panneks Wohnung im Eppendorfer Weg 256. Hier glaubte Gustav Bruhn, sicher zu sein. Sein Vertrauen in Pannek ging so weit, dass er ihn und seine Frau mehrmals in die Wohnung von Klara Dworznik mitnahm.
Im Dezember 1943 wollte Gustav Bruhn ganz nach Hannover übersiedeln und dort untertauchen. Pannek hatte ihm falsche Papiere beschafft. Als Gustav Bruhn Hamburg am Abend des 13. Dezember 1943 mit dem Zug verlassen wollte, wurde er bei einer scheinbar zufälligen Fahrkarten- und Ausweiskontrolle verhaftet. Gustav Bruhns Haftkarteikarte im Untersuchungsgefängnis enthält die Notiz "15.12.43 18.00 vom Urlaub zurück".
Am 3. Februar 1944 wurde auch Elisabeth Bruhn verhaftet und zwar zusammen mit Rudolf Steinfatt und Klara Dworznick in deren Wohnung in der Bogenstraße 23 sowie mit dem am 6. Januar 1945 im KZ Neuengamme umgekommenen Adolf Schröder. Der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof Berlin hatte ungeachtet des Untertauchens von Mitgliedern der Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe bereits am 1. November 1943 eine Anklageschrift gegen Bernhard Bästlein, Oskar Reincke, Robert Abshagen, Walter Bohne und Gustav Bruhn fertig gestellt.
Bevor der Strafprozess gegen Gustav Bruhn stattfinden konnte, veranlasste der Gestapomann Henry Helms seine Liquidierung. Dies geschah auf Betreiben von Alfons Pannek, dessen Tätigkeit als Gestapo-Spitzel bei der Verhaftung von Gustav Bruhn aufgedeckt worden war. Pannek wollte offenbar durch Gustav Bruhns Tod seine Rolle als Gestapo-Spitzel sichern. Am 14. Februar 1944 wurden Elisabeth und Gustav Bruhn in das KZ Neuengamme verschleppt und ohne Gerichtsurteil gehenkt. Über die Geschehnisse dort schrieb Alfred Baumbach, ein Freund der Familie Bruhn: "Als wir am 14. Februar 1944 morgens in den Transportwagen stiegen, der uns von Fuhlsbüttel nach Neuengamme brachte, sah ich, wie Gustav und Lisbeth Bruhn und einige andere Häftlinge in einem schrecklichen Zustand von begleitender SS und den Gestapomännern Helms und Litzow in den Wagen getrieben wurden. Ich ahnte, dass etwas Furchtbares bevorstand. Im Wagen versuchte ich, neben Lisbeth zu gelangen, um ihr durch eine freundliche Geste mein Mitgefühl auszudrücken. Sie war vollkommen verstört. Beim Aussteigen in Neuengamme wollte Gustav sich neben uns stellen. Er wurde von Helms und den anderen SS-Männern mit höhnischen Bemerkungen: ‚Das könnte euch so passen!' und durch Faustschläge und Fußtritte von uns getrennt. Die Gruppe Gustav und Lisbeth Bruhn, Hans Hornberger und Kurt Schill, den Fünften kannten wir nicht, wurde dann von der SS abgeführt. Helms und Litzow gingen mit. Am gleichen Abend wussten schon alle Genossen im Lager, dass die fünf im Bunker gehängt worden waren."
Die Morde an Elisabeth und Gustav Bruhn, Hans Hornberger, Kurt Schill und Walter Bohne wurden sofort an den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei gemeldet. Von dort wurde der Reichsjustizminister unterrichtet.
Im Ehrenhain Hamburger Widerstandskämpfer auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf liegt ein Gedenkstein für Elisabeth und Gustav Bruhn.
Die Namen von Elisabeth und Gustav Bruhn finden sich auch auf der Gedenkmauer des Zentralfriedhofs in Berlin-Friedrichsfelde.
In Angermünde trägt eine Grundschule den Namen von Gustav Bruhn.
Text: Ingo Wille
Quellen:?
Bundesarchiv SAPMO Ry 1/I3/16/36; Gedenkstätte deutscher Widerstand, Anklageschrift des Oberrechtsanwalts beim Volksgerichtshof vom 1. November 1943 gegen Bästlein, Reincke, Abshagen, Bohne und Bruhn (10 J 423/43g); Gedenkstätte Ernst Thälmann - Archiv; Gedenkstätte Sachsenhausen, Archiv, Haftdaten Gustav Bruhn im KZ Sachsenhausen;?Hamburger Adressbücher; Bästlein, Klaus: "Hitlers Niederlage ist nicht unsere Niederlage, sondern unser Sieg!" Die Bästlein-Organisation. Zum Widerstand aus der Arbeiterbewegung in Hamburg und Nordwestdeutschland während des Krieges (1939-1945). In: Beate Meyer (Hrsg.): Vom Zweifeln und Weitermachen. Fragmente der Hamburger KPD-Geschichte. Festschrift für Helmuth Warnke zum 80. Geburtstag. Hamburg 1988, S. 44ff.; Gerchen, Georg, Vom Heider Marktplatz bis zum KZ Neuengamme, Heide 1993; Hochmuth, Ursel, Niemand und nichts wird vergessen, Hamburg 2005, S. 43ff.; Hochmuth, Ursel/ Meyer, Gertrud, Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933-1945, Frankfurt/M. 1980, S. 344f., S. 369ff.; Knappe, Meuterei im Jugendgefängnis in: Zorn, Gerda/Meyer, Gertrud, Frauen gegen Hitler, Frankfurt/M. 1974, S. 41ff.; Meyer, Gertrud, Die Frau mit den grünen Haaren, Hamburg 1978, S. 114ff.; Meyer, Gertrud, Nacht über Hamburg, Frankfurt/M. 1971, S. 92f.; Puls, Ursula, Die Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe, Berlin 1959; Thomsen, Johann Wilhelm, Landleben in der Weimarer Republik, Heide 1989, S. 19f.; VAN-Totenliste S. 18f.; Weber, Hermann, Herbst, Andreas, Deutsche Kommunisten, Berlin 2004, S. 128f.; Pfeil, Ulrich, Die KPD im ländlichen Raum - Die Geschichte der Heider KPD 1920-1935 in: Demokratische Geschichte X - Jahrbuch zur Arbeiterbewegung und Demokratie in Schleswig-Holstein, Bd. 10, (1996), S. 171-206; Wadle, Anni, Mutti, warum lachst du nie? Erinnerungen an Zeiten der Verfolgung und des Krieges, Drensteinfurt 1988; Diercks,Herbert, Der Einsatz von V-Leuten im Sachgebiet "Kommunismus" der Hamburger Gestapo, in: Polizei, Verfolgung und Gesellschaft im Nationalsozialismus, Bremen 2013,S. 124; http://www.bildung-brandenburg.de/schulportraets/index.php?id=stammdaten&schulnr=100638 (Zugriff 11.9.2012); http://www.preussen-chronik.de/begriff_jsp/key=begriff_schutzhaft.html (Zugriff 8.5.2012).
|
|
 |
 |
 |
| Elisabeth Campe, geb. Hoffmann |
 |
 |
| 12.6.1786 Hamburg - 27.2.1873 Hamburg |
| Biographin, Verlegertochter und -ehefrau |
Hamburgischer Gedächtnisfriedhof:
Ohlsdorfer Friedhof, Althamburgischer Gedächtnisfriedhof, Grabplatte "Verleger und Drucker"
"Wenn ich des Gegenstandes wegen auch nicht für nöthig halte, daß ich genannt werde, und keinen Werth darauf lege, so bin ich mit 72 Jahren doch alt genug, um kein zimperliches Incognito bewahren zu wollen." 1) Die hier einwilligt, öffentlich als Verfasserin einer Schrift genannt zu werden, ist Elisabeth Campe geb. Hoffmann. Hoffmann und Campe, diese beiden Namen trägt der renommierte Hamburger Verlag bis zum heutigen Tag, und der Anlass für die Fusion war Elisabeth - Tochter von Benjamin Gottlob Hoffmann und Ehefrau von Franz August Gottlob Campe, beide Verleger und Buchhändler.
|
Elisabeth Campes eigenständige Bedeutung für die Verlagsgeschichte aber liegt auf einem anderen Gebiet, auf dem der Autorschaft. Mit ihren Briefen aus der Zeit der zweiten Besetzung Hamburgs durch die Franzosen wollte nach deren Abzug der Verlag ihres Mannes, der damals noch nicht mit dem ihres Vaters zusammengelegt war, seine Arbeit wieder aufnehmen. Die Briefe waren eigentlich für Johann Nicolas Böhl von Faber bestimmt gewesen, der sich wieder findet in der Figur des Johannes in Joachim Heinrich Campes berühmtem Roman "Robinson der Jüngere". Der erfolgreiche Kaufmann, Liebhaber und Kenner spanischer Poesie und mittelhochdeutscher Literatur, Herausgeber einer Liedersammlung aus des "Knaben Wunderhorn" hatte Hamburg kurz nach dem Einzug der russischen Befreier verlassen müssen, um beim Rückmarsch der Franzosen aus Pommern auf seinem Gut Görslow in Mecklenburg anwesend zu sein. Elisabeth Campe hatte dem Freund beim Abschied versprochen, ihn über die Veränderungen nach der Befreiung von den Franzosen auf dem Laufenden zu halten. Doch noch ehe sie den ersten Brief abgeschickt hatte, waren die Franzosen wieder in der Stadt. Sie berichtete von allen großen und kleinen Vorfällen, wusste die Briefe aber nicht zuzusenden, weil der Freund sein Gut verlassen hatte und nach Spanien zurückgegangen war. Eben diese Briefe wurden auf inständiges Bitten und Drängen von Vater und Ehemann im Juli 1814 unter dem Titel "Darstellung von Hamburgs außerordentlichen Begebenheiten in den Jahren 1813 und 1814" anonym veröffentlicht. Elisabeth Campe hatte erst nach langem Zögern und nur unter der Einschränkung zugestimmt, dass ihr Name nicht genannt werde. Inwieweit bei dieser Bedingung auch anerzogene Zurückhaltung mitspielte, da es für Frauen als unschicklich galt, an die Öffentlichkeit zu treten, und Schriften von Frauen allein aufgrund der Tatsache, dass sie von Frauen geschrieben waren, zumeist herablassend und unsachlich rezensiert wurden, mag dahingestellt sein. Fest steht, dass die geistreiche und lebendige Elisabeth Campe von großer persönlicher Bescheidenheit war.
Geboren wurde sie am 12.Juni 1786. Ihre Mutter war eine geborene Ruperti. Die Eltern ließen ihrer ältesten Tochter, die ihnen als einziges von drei Kindern erhalten blieb, eine gründliche Erziehung angedeihen. Elisabeth Campe besuchte die französische Schule bei Madame Mollinier, bewegte sich bald mit großer Selbstverständlichkeit in den ersten Hamburger Kreisen, die in ihrem Elternhaus verkehrten, und begleitete die Eltern auf ihren Reisen. Besonders liebte sie die Fahrten zur Leipziger Messe, wo sie Gelegenheit hatte, Menschen kennen zu lernen und Freundschaften zu schließen. Am 6. Dezember 1806 heiratete sie den Verleger und Buchhändler Franz August Gottlob Campe, der im Jahre 1800 aus Braunschweig nach Hamburg gekommen war und hier eine Buchhandelung eröffnet hatte. Der Anfang war ihm dadurch erleichtert worden, dass er von den Hamburger Freunden seines Onkels Joachim Heinrich Campe, in dessen Schulbuchhandlung er in Braunschweig gelernt hatte, - Klopstock, Reimarus, Sieveking und Hoffmann -, freundlich aufgenommen wurde. Von der Heirat schreibt Elisabeth Campe in ihrem Nekrolog auf ihren Mann: "Seine Ansprüche waren immer nur auf ein bescheidenes Lebensglück gerichtet und hierin fand er die vollste Übereinstimmung der Gesinnungen, als er im J. 1806 die einzige Tochter seines älteren Collegen B. G. Hoffmann zur Lebensgefährtin wählte." 2) Was sie unter einem "bescheidenen Lebensglück" verstand, zeigt eine Art Vermächtnis, das sie im März 1840 für Elise Friederike Reclam schrieb. Das Ehepaar Campe, das selbst kinderlos blieb, hatte die siebenjährige Nichte Elisabeth im Herbst 1818 als Pflegekind bei sich aufgenommen: "Erhalte Dein Herz weich", heißt es da, "freundlich und liebevoll gegen alle Menschen, dann stehst Du nie allein; der Beruf Andere zu beglücken ist an keinen Stand, an kein Verhältnis gebunden, Gottes Reich ist überall, und die Liebe macht alles gleich! Sieh nicht auf das Aeußere. Du findest Menschen in den beschränktesten Lebensverhältnissen, deren innerer Reichtum bei weitem den Glanz dieser Welt überragt. Ist aber Dein geistiges Leben dem Himmel, wie der Erde zugewandt, so wird es Dir immer leichter werden in Anderen das Gleiche zu erkennen; da nur schließe Dich an, ohne jedoch zu vergessen, dass es auch Pflicht und Beruf ist, Gottes Reich zu fördern, und die Segnungen, die es uns gebracht, in froher Verkündigung denen mitzutheilen, welchen Morgenröthe noch nicht erschienen ist! … Du kennst die Nachtheile des Alleinlebens; davor sei ernstlich gewarnt. Unabhängigkeit und Freiheit sind Hirngespinste; Niemand ist unabhängig und frei zu nennen, als wer alles Ernstes Herr seiner Fehler und Leidenschaft geworden; nach dieser Freiheit des Geistes dürfen wir allein ringen. Kannst Du Dich hier, in Deiner zweiten Vaterstadt, guten Menschen anschließen, Dir mit den Mitteln, die Gott Dir gegeben, eine zweckmäßige Thätigkeit schaffen, ohne der Eitelkeit nach Außen Raum zu geben, so bleibe in Gottes Namen hier und erhalte das Andenken beider würdigen Männer, Deines und meines Vaters, deren Thätigkeit Du diese Mittel dankst, bei den Zeitgenossen im Segen! - Gutes wirken kannst Du allenthalben; fühlst Du Dich in Braunschweig oder Leipzig glücklicher, heimischer, zufriedener, so folgt Dir unser Segen allenthalben, wohin Du dich wendest! - " 1) .
Ein Leben in und für die Gemeinschaft Gleichgesinnter also, wie sie selbst es führte als Mittelpunkt eines großen literarisch interessierten Freundeskreises. Zu ihm gehörten neben Böhl von Faber, dem Adressaten ihrer Briefe aus der Franzosenzeit, der Biograph des Schauspieldirektors Friedrich Ludwig Schröder, Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer aus Bramstedt, und der Dichter Johann Diederich Gries, der vor allem als Übersetzer von Tasso und Calderon bekannt geworden ist. Ihnen allen sollte Elisabeth Campe ein schriftliches Denkmal setzen, und der Beweggrund war immer derselbe: die Freunde in ihrer wahren Persönlichkeit darzustellen und sie vor dem Vergessenwerden zu bewahren.
Nach dem Tod von Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer verfasste Elisabeth Campe für seine Erben, die von ihrem Gönner kaum etwas wussten, einen "Abriß seines Lebens". Später ergänzte sie ihn durch eine Auswahl von Briefen - von Bürger, Forster, Göckingh, Gotter, Herder, Heyne, Schröder u.a. - und versah sie mit einleitenden Bemerkungen. So entstand ein zweibändiges Werk. Professor Wurm charakterisierte die Lebensskizze im Vorwort als "… einer leichten Federzeichnung zu vergleichen, die in unscheinbaren Umrissen die ganze Persönlichkeit zusammensetzt, und keinen andern Anspruch macht, als dem Leser das Interesse abzugewinnen, von dem Manne, den sie bezeichnet, mehr zu erfahren." 3)
Das "Leben von Johann Diedrich Gries" wurde nur als Handschrift gedruckt. Es entstand vor dem Hintergrund, dass der Dichter Gries durch seine lange Abwesenheit aus Hamburg der jüngeren Generation kaum bekannt war, und, als er schließlich als schwerkranker Mann 1837 nach Hamburg zurückkehrte, sich auch nicht mehr ins rechte Licht setzen konnte. Das tat Elisabeth Campe so weh, dass sie seine Lebensgeschichte aufschrieb und eine Reihe von Briefen berühmter Männer an Gries hinzufügte.
Auch das dritte Portrait wurde nur als Handschrift gedruckt. Als im Jahr 1850 der Verein für Hamburgische Geschichte beschloss, ein Lexikon Hamburgischer Schriftsteller herauszugeben, machte Elisabeth Campe auf Böhl von Faber aufmerksam, der 1813 zuletzt in Hamburg gewesen und fast vergessen war. Ihr Artikel für das Lexikon wurde aber so lang, dass er zwar benutzt wurde, in vollem Umfang aber in den "kritischen und litterarischen Blättern" der Börsenhalle erschien. Varnhagen von Enses Interesse an Böhl von Faber ermunterte sie, die Skizze weiter auszuführen, und so entstand1858 ihre letzte Abhandlung, bei der sie nicht mehr auf Wahrung des Incognito bestand.
Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit, die eng mit der Realität verknüpft war, Begebenheiten und Menschen ihrer Umgebung zum Gegenstand hatte, griff Elisabeth Campe auch unmittelbar ins Tagesgeschehen ein. Als 1813 die Bürgergarde gegründet worden war, weil man eine Rückkehr der eben abgezogenen Franzosen fürchtete, und ihr Mann sich sofort als Freiwilliger meldete, tat Elisabeth Campe sich mit Freundinnen zusammen, und gemeinsam stickten sie eine Fahne, die nach Übergabe an die Bürgergarde unter Anwesenheit der Frauen in der Michaeliskirche geweiht wurde. Zudem gründeten die Frauen einen Verein, der sich zur Aufgabe machte, die kämpfenden Männer zu unterstützen. Als dazu keine Notwendigkeit mehr bestand, löste sich der Verein nicht auf, sondern die Frauen errichteten eine Schule für die Ausbildung armer Mädchen zu Dienstboten, in der Elisabeth Campe als Pflegerin tätig war und unterrichtete.
Auch im Alter blieb Elisabeth Campe voller Schaffenskraft. Als sie 74jährig vollständig erblindete - die Sehkraft des einen Auges hatte sie schon früher verloren -, suchte sie sich durch Stickereien für Hilfsbedürftige und die innere Mission zu beschäftigen. "Welch' ein Segen für mein Geschlecht ist doch die Handarbeit", 1) pflegte sie zu sagen. Sie, die sich so gerne schriftlich mitteilte, ersann auch bald eine eigene Vorrichtung, um ihre Gedanken aufschreiben zu können. Aber auch an persönlichem Kontakt fehlte es ihr nicht, obwohl sie keine nahen Angehörigen mehr hatte; ihr Mann, August Campe, war bereits 1836 verstorben, die Nichte Elise Reclam 1861.
Pastor C. Mönckeberg rühmt die alte Elisabeth Campe: "Es war auch ein Genuß, mit der edlen Frau sich zu unterhalten. Die Anmuth ihrer Erscheinung, die gewinnende Freundlichkeit, mit der sie Jedem entgegentrat, ihre feine, gebildete, ohne Ziererei doch immer das rechte Wort findende Sprache, die von Wahrheit durchdrungene Ausdrucksweise, ihre leichte und doch so gehaltvolle Art der Unterhaltung, die Fähigkeit zu erzählen, die sie auf liebliche Art besaß, mit lebendiger Erinnerung vergangener Stunden und frischer Darstellung des vor langer Zeit Erlebten, dabei die Leichtigkeit und Klarheit in Auffassung neuer Erscheinungen, das bestimmte, gesunde und doch so milde Urtheil, - Alles vereinte sich, die Stunden bei ihr schnell vergehen zu lassen, wenn sie sich nur erträglich wohl fand. Rührend war es aber auch, wenn sie ihres Schmerzes nicht Herr werden konnte und die aufsteigenden unzufriedenen Gedanken nicht ganz zu unterdrücken vermochte; da kämpfte sie mit Anstrengung, ohne eine Spur von Bitterkeit kund zu geben. Ihr festes Gottvertrauen läuterte ihre Seele immer mehr und mehr; und immer mehr zog sie sich in ihren Gott zurück." 1)
Es entspricht ganz ihrem Wesen, wenn Elisabeth Campe bestimmte, dass sie so einfach wie möglich begraben werde und das dadurch ersparte Geld dem Turmbau der Nicolaikirche zukomme. Ihren Freunden und Bekannten hinterließ sie folgende Lebensbilanz: "Unser Leben währet 70 Jahre und, wenn es hoch kommt, so sind es 80, und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es doch Mühe und Arbeit! Die Wahrheit dieses Wortes habe ich an mir selber erfahren. Denn wohl kann ich mein langes Leben als köstlich bezeichnen, und zwar durch die Gnade des Herrn, der mich in Verbindung mit so vielen vorzüglichen und edlen Menschen gebracht, deren Einfluß auf mich ich mir noch jetzt bewußt bin. Doch gab es auch viel Mühe und Arbeit, sowohl in den Irrgärten des Lebens, als auch im Kampfe mit bösen Neigungen, Selbstliebe und Eitelkeit, die dem reinsten Streben nur zu oft störend und hinderlich entgegentraten. Viele meiner liebsten Freunde und Zeitgenossen sind bereits heimgegangen, und da mir Gott auch alle meine nächsten Angehörigen nahm, darf ich wohl fragen: Hüter, ist die Nacht bald hin? Aber nah und fern sind mir noch so viele liebe Freunde, Verwandte und Bekannte geblieben, die sich mir in meinen letzten dunkeln Lebenstagen so freundlich, hülf- und trostreich erwiesen haben, daß ich allen, allen - wenn ich an meine Scheidestunde denke, - ein dankbares Lebewohl zurufen muß! Möge Gott sie dafür segnen, im Alter in ihren Kindern, und das jüngere Geschlecht behüten und bewahren! - Und nun noch eine letzte Bitte, - ist sie vielleicht auch kleinlich und bezeichnend im Festhalten am Irdischen, -:so erfüllt sie! Verschmähet nicht ein Andenken von mir; wählet aus meinem bescheidenen Nachlaß irgend eine Kleinigkeit, die dann zuweilen mein Gedächtnis in euch zurückrufen könnte! Mag dann der Gedanke laut werden: Sie war nicht frei von Fehlern, doch falsch und treulos war sie nicht! - Nun mein letztes Lebewohl bis zum Wiedersehen dort Oben, wo der Erlöser alle, die ihn lieben, um sich vereiniget!" 1)
Text: Brita Reimers
Quellen:
1) C. Mönckeberg: Frau Elisabeth Campe, geb. Hoffmann. Hamburg 1874.
2) Elise Campe: Franz August Gottlob Campe, in: Neuer Nekrolog der Deutschen. Teil 2. Jg. 14. 1836. Weimar 1838.
3) Zur Erinnerung an F. L. W. Meyer, den Biographen Schröder's, 2 Theile. Braunschweig 1847.
|
|
 |
 |
 |

Photo: Staatsarchiv Hamburg |
 |
Marta Damkowski |
| 16.3.1911 Stade - 11.8.1982 Hamburg |
| Bürgerschaftsabgeordnete (SPD), Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime |
Ohlsdorfer Friedhof, Geschwister-Scholl-Stiftung, Grab Nr. 73, 342
Marta-Damkowski-Kehre, Bergedorf, seit 1986, benannt nach Marta Damkowski
Marta Damkowski entstammte einer sozialdemokratischen Arbeiterfamilie. Im Alter von zwölf Jahren trat sie den "Kinderfreunden" bei, später wurde sie Mitglied der Sozialistischen Arbeiter Jugend (SAJ) und trat mit etwa siebzehn Jahren (1928) dort wieder aus, weil sie sich an der Belegung der Kredite für den Panzerkreuzer A (später "Deutschland" genannt) nicht beteiligen wollte.
Als Folge einer früheren Begegnung mit dem sozialistischen Philosophen Leonhard Nelson trat sie 1925 dem Internationalen Sozialistischen Kampfbund (ISK) bei, der die "Anpassungspolitik" der SPD ablehnte. Von 1929 bis 1932 war Marta Damkowski Hörerin an der Philosophisch-Politischen Akademie des ISK in Melsungen. Ab 1933 steuerte der ISK seine Arbeit zunächst vom Ausland aus. Marta blieb in Deutschland und arbeitete in der Illegalität.
|
Sie musste in diesen Jahren viel reisen und innerhalb Deutschlands oft umziehen - von einer illegalen Anlaufstelle zur nächsten.
Damit ihre Arbeit nicht aufflog, musste sie der Gestapo jeden politischen Freund als ihren neuesten Liebhaber ausgeben. Deshalb galt sie dort als Hure und wurde später während ihrer Haftzeit oft unflätig beschimpft.
1937/38 initiierten die Nationalsozialisten eine große Verhaftungswelle. Trotz einer verschlüsselten Warnung konnte Marta Damkowski, die sich damals in Bremen aufhielt, nicht mehr rechtzeitig fliehen. Sie, ihr Bruder und auch ihr späterer Mann - beide Männer gehörten der SAJ an - wurden verhaftet. Der Volksgerichtshof verurteilte Marta Damkowski 1938 zu einer einjährigen Gefängnisstrafe wegen "Vorbereitung zum Hochverrat". Da sie keine Aussagen machte, wurde sie wochenlang in Dunkelhaft gehalten. 1940, gleich nachdem Marta Damkowski und ihr Freund aus der Haft entlassen worden waren, heirateten sie. 1941 kam ihr Sohn zur Welt. Ihr Mann wurde 1944 als Soldat getötet. Nach Kriegsende trat Marta Damkowski der SPD bei. Von 1946 bis 1949 arbeitete sie als Frauensekretärin der Hamburger Landesorganisation der SPD. Später war sie als Verwaltungsangestellte der Gefängnisbehörde tätig und leitete bis 1958 die Frauenstrafanstalt Hamburg. Sie war auch wesentlich am Aufbau von "pro familia" und dem Referat "Familienförderung" in der Sozialbehörde beteiligt und arbeitete in der Arbeitsgemeinschaft Hamburger Frauenorganisationen mit. Von November 1946 bis Oktober 1953 gehörte sie der Hamburgischen Bürgerschaft an und setzte sich dort immer wieder für eine grundlegende Reform des Paragraphen 218 ein. Auch stritt sie im Nachkriegsparlament für eine bessere Nahrungszuteilung für Säuglinge. Neben ihrer parlamentarischen Arbeit war Marta Damkowski in der Zeit von 1947 bis 1953 Mitglied im Bundesfrauenausschuss, im Parteirat der SPD und arbeitete mit am Godesberger Programm (Frau und Familie). Noch im Alter war Marta Damkowski im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Altona, im Distriksvorstand Sülldorf-Rissen und im Landesverband der Arbeiterwohlfahrt Hamburg tätig.
Text: Rita Bake
Quellen:
Frauen im Faschismus. Frauen im Widerstand, Hamburger Sozialdemokratinnen berichten. Hrsg. von der AsF Hamburg o. J.
|
|
 |
 |
 |
| Sophie Dethleffs |
 |
 |
| 10.2.1809 Heide - 13.3.1864 Hamburg |
| Niederdeutsche Dichterin/Schriftstellerin |
Ohlsdorfer Friedhof, Althamburgischer Gedächtnisfriedhof, Grabplatte "Dichter und Schriftsteller"
Dethlefstwiete, Bergedorf/Lohbrügge, seit 1948, benannt nach Sophie Auguste Dethlefs
"Der Ruhm der ersten plattdeutschen Dichterin von Bedeutung gebührt Sophie Dethlefs", schrieb Albrecht Janssen am 7. Oktober 1925 in seinem Artikel "Plattdeutsche Dichterinnen" im "Hamburger Fremdenblatt", und Klaus Groth, der neben Fritz Reuter und John Brinckmann als Begründer der neuniederdeutschen Lyrik gilt, sah in Sophie Dethlefs seine bedeutendste Wegbereiterin.
|
Nicht nur, weil die begeisterte Aufnahme ihres Gedichtes "De Fahrt na de Isenbahn" ihn darin bestärkte, dass die plattdeutsche Sprache doch noch nicht vergessen und die Tradition der plattdeutschen Dichtung wieder zu beleben war, sondern besonders deshalb, weil Sophie Dethlefs einen anderen Ton anschlug als die Kollegen, die sich nur über die Dummheit der Bauern lustig machten: "... dar weer wat Smucks in dat Gedicht, de Welt, de se beschreev, weer doch lebenswert." 2) Einen tiefer gehenden Einfluss auf sein eigenes Schaffen weist er jedoch zurück: Als Sophie Dethlefs erster Gedichtband erschien, sei sein zwei Jahre später veröffentlichter "Quickborn", mit dem er seinen Ruhm als neuniederdeutscher Dichter begründete, schon sehr weit fortgeschritten gewesen, schreibt er in seinem Aufsatz "Sophie Dethlefs un ik". Was aus der Distanz so sachlich vorgetragen ist, hat zur Zeit des Erscheinens des "Quickborn" eine ganz andere Heftigkeit. In einem Brief an E. F. Chr. Griebel heißt es: "Schon öfter habe ich den Vergleich mit der Dethlefs ertragen müssen. Ich will aber mein Buch sogleich verbrennen, wenn ich mit ihr auf gleicher Linie stehe. Ihre Sachen sind durchaus Dilettantenarbeit. Sie hat keinen Vers mit Kunstbewußtsein geschrieben. Plattdeutsch versteht sie nicht; einige läppische Worte wie Petzen und Detzen sind noch kein Plattdeutsch. Ihre ‚Fahrt na de Isenbahn' empört mich. Harms sagt mit Recht davon, daß sie eigentlich etwas auf die Finger haben müßte, weil sie das Volk so erbärmlich ansehe, so erbärmlich zeichne. Denn das ist eben der Grundmangel: Achtung vor dem Volke! Und darum kann sie keine feste Konzeption fassen und harmonisch, ohne Abschweifung, zu Ende führen. Ich verlange natürlich nicht, daß sie gegen die Dethleffs polemisieren sollen. Allein ich könnte es nicht ertragen, wenn meine Arbeit als Dilettantenwerk dargestellt würde." 3)
Sophie Dethlefs teilte den Ehrgeiz und das Konkurrenzdenken Klaus Groths in keiner Weise. Nach der Lektüre des "Quickborn" schickte sie ihm ein rührendes Widmungsgedicht.
Sophie Dethlefs wurde am 10. Februar 1809 in Heide geboren, wo auch der um zehn Jahre jüngere Klaus Groth aufwuchs. Trotz der Gemeinsamkeiten kam es nie zu einer ernsthaften Annäherung zwischen den beiden. Sophie Dethlefs und Klaus Groth sprachen in Heide nur ein einziges Mal miteinander, etwa im Jahre 1845 auf einem Polterabend, auf dem sie plattdeutsche und er hochdeutsche Gedichte vortrug. Dieses Ausbleiben eines näheren Kontaktes war wohl nicht nur im Altersunterschied begründet, sondern vor allem in einem Standesunterschied, denn Sophie Dethlefs gehörte den so genannten besseren Kreisen an. Sophie war die Tochter des Branddirektors Dethlefs. Die Mutter starb bei ihrer Geburt. Der Vater engagierte eine Haushälterin und lebte mit seinen drei Töchtern und dem Sohn sehr zurückgezogen in einem schönen Haus mit großem Garten. Nur manchmal gingen die Schwestern auf dem Dorfplatz spazieren. Klaus Groth erinnert sich: "Oewer den groten Plaats voer min Vaderhus in de Heid spazeern mitto gegen Abend, wen't warm un still Wedder weer, twee öllerhafte Mädens, ‚Mamselln' war wul seggt, denn se hören nich recht to de Handwarkers, Arbeiders, lütt Hüerslüd un wat dar sunst um den Lüttenheid, as de grot Gemeenplaats het, wahn (...). Wenn de beiden Mamselln achter rutgungn, so blev en lütten oln Mann torügg un mak de Port wedder to." 2) Noch deutlicher wird der Abstand, den Klaus Groth empfindet, wenn er lapidar formuliert: "Dat awer Glück un Freden dar ok nich blot regeer, dat keem mi al glik to Ohrn, as man mit Schrecken vertell, Branddirektor Dethlefs weer afsett. Sin Kaß weer in Unordnung, sin lütt Gehalt harr nich reckt voer de Familje. Hus un Garn warn verkofft. Wat war ut de armen Lüd? Se verswunn voer uns Börgerslüd, dat weer allns." 2)
Das war im Jahre 1835, Sophie war 26 Jahre alt. Nach der Entlassung ging der Vater zu seinem Sohn, der Kirchspielvogt in Delve war. Sophie musste alleine zurechtkommen. Dazu kam noch das Unglück einer unerfüllten Liebe. Eine höhere Schul- oder gar eine Ausbildung hat sie vermutlich nie genossen. Den Mädchen wurde laut Heider Schulordnung eine "zweckmäßige Ausbildung für das häusliche Leben" zuteil. Sophie fand eine Stellung im Haus des Justizrats Paulsen. Das Ehepaar Paulsen war kinderlos, und da Frau Paulsen ebenso gerne las wie Sophie Dethlefs, freundeten die beiden sich an. Sie "weer mehr er Fründin as er Herrschaft". 2) Sophie Dethlefs machte Gelegenheitsgedichte, "oft drullig un nich ahn en beten dristen Humor". 2) Wenn es in Heide ein Fest gab, holte man sie. Sie trug Widmungsgedichte vor und gestaltete die Auftritte der Gratulanten zu kleinen Theaterrollen, indem sie veranlasste, sich als Zigeuner, Fischersfrau u. ä. zu verkleiden. Manchmal entwarf sie ganze Szenarien. Für einen Polterabend ließ sie in einem Lokal einen ganzen Jahrmarkt aufbauen.
Mit ihrem Gedicht "De Fahrt na de Isenbahn" wurde sie, für sie selbst offenbar ganz überraschend, mit einem Schlag in ganz Schleswig-Holstein bekannt. Das Gedicht ging von Mund zu Mund und von Hand zu Hand, bevor es in Karl Biernatzkis "Volksbuch auf das Jahr 1850 für Schleswig, Holstein und Lauenburg", in dem Theodor Storms (siehe: Theodor-Storm-Straße, in Bd. 3 online) "Immensee" zu finden war, zum ersten Mal gedruckt wurde. Damit war ihr der Schritt von der dilettierenden Verseschmiede in die literarische Öffentlichkeit gelungen. Durch den Zuspruch von Freunden ermuntert, ließ sie im selben Jahr den Band "Gedichte" drucken. Die erste Auflage war so schnell vergriffen, dass schon 1851 die zweite erschien und 1857 eine dritte. Die vierte erweiterte Auflage (1861) trug den Titel "Gedichte in hochdeutscher und plattdeutscher Mundart". Die Gedichtbände enthalten neben der "Fahrt na de Isenbahn" weitere epische Gedichte, die auch von den Menschen ihrer Heimat erzählen, lyrische Klagen über das erfahrene Liebesleid und patriotische Gedichte, die Sophie Dethlefs 1848 während des Krieges zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark verfasst hatte. Die fünfte, mit einem Vorwort und einem Lebensabriss versehene Auflage gab Klaus Groth im Jahre 1878 heraus. Nun, nachdem er seines eigenen Ruhmes längst sicher war, konnte er entspannt mit dem Werk Sophie Dethlefs umgehen. Im Vorwort nannte er "De Fahrt an de Isenbahn" ihr Hauptwerk, mit dem sie ihren Ruf begründet habe: "Das Idyll erwarb sich allein durch seinen inneren Wert seine zahlreichen Freunde und der Verfasserin einen Namen, der nicht ausgelöscht werden kann, so lange eine plattdeutsche Literatur und Sprache bestehen." 3)
Der Herausgeber des 1989 erschienenen Bandes "Sophie Dethleffs Gedichte", Michael Töteberg, beurteilt ihr Werk folgendermaßen: "Mit Kunstbewußtsein hat Sophie Dethleffs keinen Vers geschrieben. Sie war eine naive Poetin. Doch finden sich in ihrem Gedichtband nicht bloß Juxgedichte für Polterabend, Taufe und Konfirmation. Die ernsten und wehmütigen Töne sind unüberhörbar; häufig wiederkehrende Motive sind soziale Not und unerfüllte Liebe - Weiberthemen nach damaligem Verständnis. Das Stichwort Frauenlyrik ist bereits gefallen, es hat einen abfälligen Beiklang. Mit männlicher Arroganz wurde den in den Gedichten zum Ausdruck kommenden Empfindungen und Gefühlen höherer Wert abgesprochen. Sophie Dethleffs war privates Glück versagt geblieben; in ihren Versen flüchtete sie oft ins Sentiment oder setzte als Schlußmoralität christliches Gottvertrauen.
Gewiß ist manches, was sie zu Papier brachte, lediglich konventionelle Erbauungsliteratur, wirkt weder originell noch sonderlich inspiriert. Sie konnte eine alte Tasse, ein ausgedientes Kleid oder das erste Stiefmütterchen andichten; es gibt unfreiwillig komische Wendungen, so daß man manchmal denkt, hier sei eine plattdeutsche Friederike Kempner am Wirken. Und doch ist es ihr gelungen, in schwermütigen Versen individuelles Schicksal zu artikulieren. Ein unruhiges Herz, einsam und traurig, spricht sich hier aus." 3)
Zu dem privaten Elend kam die Bedrängnis durch den Krieg gegen Dänemark. Auch wenn Sophie Dethlefs' patriotische Gedichte häufig recht plakativ sind, ist ihr politisches Engagement doch bemerkenswert, zumal sich die allgemeine Begeisterung für die Befreiungskriege in Dithmarschen sich in Grenzen hielt.
Nach dem Tode des Justizrats Paulsen im Jahre 1849 wurden Sophie Dethlefs' Lebensverhältnisse immer drückender. Pastor Rehhoff von der Hamburger Michaeliskirche nahm sich ihrer an und brachte sie 1853 zusammen mit ihrer blinden Schwester Annette Dorothea im neu eröffneten Schröder-Stift in Hamburg unter (siehe: Schröderstiftstraße, in Bd. 3 online), das sein Erbauer, der Kaufmann und Freiherr Schröder, ausdrücklich für "Hilfsbedürftige aus besseren Ständen" bestimmt hatte. Die Wohnung war mietfrei, und jeder Bewohner erhielt 120 Mark im Jahr für den Lebensunterhalt.
Klaus Groth hat Sophie Dethlefs 1857 dort besucht: "Ik söch er in Hamborg int Schröderstift op, wo se ja wenigstens mit er Swester Opnahm un Pfleg funn harr. Dat harrn er Gedichte makt. Awer trurig, möd in sik, eensam, as man seggt, dalknickt, seet se dar mit er blinde Swester. Klag' weer de Anfang. Klag' weer allns, wat ik to hörn kreeg. All min Trost weer as Waterdrippens op en hitten Stehn. Wer will er't oewelnehm? Wo weer de Welt, wo wi na opkeken harrn as na en Märkenwelt, wo se in levt harr? Kaspelvagt, Landvagt, Landschriwer, Pennmeister, - wo weern se?" 2) In seiner Bitterkeit gegenüber den sogenannten Honorationskreisen übersieht Klaus Groth ganz offenbar, dass die Lebensverhältnisse der Sophie Dethlefs niemals märchenhafte Züge getragen hatten. Es ist geradezu folgerichtig, wenn dieses einsame und dürftige Leben in der anonymen Großstadt unter fremden Menschen endete. "Vor nur wenigen Wochen ist eine Holsteinische Dichterin, Sophie Dethlefs, verschieden, und unsere Tagesblätter sind mit zwei Zeilen flüchtig darüber hingegangen", schrieben die Itzehoer Nachrichten am 4. April 1864. Sophie Dethlefs wurde auf dem Friedhof St. Katharinen beigesetzt.
Text: Brita Reimers
Quellen:
1) Die Schreibweise des Namens ist unterschiedlich. In einem in der Handschriftenabteilung der Staats- und Universitätsbibliothek aufbewahrten Brief unterschreibt sie selbst mit ff.
2) Klaus Groth: Sophie Dethlefs un ik, in: Sämtliche Werke. Hrsg. von Ivo Braak und Richard Mehlem. Bd. 4. Heide/Holstein 1981.
3) Zitiert nach: Sophie Dethleffs Gedichte. Hrsg. von Michael Töteberg. Heide/Holstein 1989. (Der Band enthält ein Werkverzeichnis.)
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Klara Dworznik, geb. Metzler |
| 24. 12.1910 - 4.7.1991 |
| kommunistische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus |
|
Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bn 73, 378
Die Weißnäherin Klara Metzler kam durch den kommunistischen Arbeiter Hugo Dworznik, den sie um 1930 kennengelernt hatte und der in der Hamburger Neustadt lebte zur KPD, der sie 1929 beitrat.1930 wurde sie Mitglied des KJVD. Auch war sie Mitglied der Roten Hilfe. 1932 wurde sie zum ersten Mal angeklagt und 1933 wegen illegaler Arbeit in der KPD verhaftet und zu fünf Monaten Haft verurteilt. Während der Haft heiratete sie 1933 Hugo Dworznik, der ebenfalls in Haft saß und gebar im Untersuchungsgefängnis den gemeinsamen Sohn Rolf. Ein Jahr später wurde Klara Dworznik amnestiert.
|
In der Zeit des Nationalsozialismus war sie in der Widerstandsgruppe "Bästlein-Jacob-Abshagen" aktiv. Nachdem 1942 ca. 200 Mitglieder der Widerstandsgruppe festgenommen worden waren und viele von ihnen nach einem Bombenangriff im Herbst 1942 befristeten Hafturlaub bekommen hatten, weil ihren Zellen zerstört waren, versuchten einige von ihnen unterzutauchen, um sich somit einer erneuten Haft zu entziehen. Klara Dworznik nahm Elisabeth Bruhn und Adolf Schröder (SPd) bei sich auf. Doch die Gestapo erfuhr durch Verrat von diesem Versteck. Am 3. 2. 1944 wurden Elisabeth Bruhn, Klara Dworznik und Adolf Schröder verhaftet. Klara Dworznik kam ins KZ Fuhlsbüttel. Dort wurde sie am 5. Mai 1945 durch die Engländer befreit.
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus war sie weiterhin in der KPD aktiv sowie in der VVN Hamburg-Eimsbüttel.
Quelle:
Ursel Hochmuth: Niemand und nichts wird vergessen. Biogramme und Briefe Hamburger Widerstandskämpfer 1933-1945. Eine Ehrenhain-Dokumentation, hrsg. von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten e.V. Land Hamburg, Hamburg 2005.
|
|
 |
 |
 |
| Ida Ehre, verh. Heyde |
 |
 |
| 9.7.1900 Prerau/Mähren - 16.2.1989 Hamburg |
Schauspielerin, Regisseurin, Prinzipalin der Hamburger Kammerspiele in der Hartungstraße
|
Ohlsdorfer Friedhof, Grab Nr. 0 6,6 (Ehrengrab des Hamburger Senats)
Ida-Ehre-Platz, Altstadt, ab Mitte 2000. Umbenennung des Teils des Gerhart-Hauptmann-Platzes, welcher von der Mönckebergstraße zur Steinstraße führt.
Ida Ehre wuchs mit fünf Geschwistern auf und musste durch den frühen Tod ihres Vaters, einem Oberkantor, "äußeren" Mangel erfahren. Ihre Mutter Berta Ehre versuchte mit Nähen den Lebensunterhalt zu verdienen. Eine Wiederverheiratung kam für sie nicht in Frage, sie wollte ihren Kindern keinen zweiten Vater geben.
Die Mutter verstand es, ihre Kinder mit Einfühlungsvermögen, Herzenswärme und Toleranz zu freien Menschen zu erziehen und ihnen "viele, viele Tugenden" zu vermitteln, um deren Erhalt Ida Ehre sich zeitlebens bemühte. Besonders wurde ihr der Satz zum Leitfaden, den ihr die Mutter am Abend vor ihrem Abtransport nach Theresienstadt, als sie schon in einer Schule interniert war, durchs Fenster zugerufen hatte: "Mein geliebtes Kind, die Welt kann nur miteinander leben, wenn das Wort Liebe großgeschrieben ist. Liebe und Toleranz - nicht hassen, nur lieben."
|
Die Mutter und eine Schwester wurden im KZ ermordet.
Die Mutter war es auch, die Ida Ehres schauspielerische Begabung, die schon in der Schulzeit auffiel, ernst nahm.
Ida Ehre erhielt in Wien, wohin die Mutter mit ihren Kindern gezogen war, ein Stipendium an der K. u. K.-Akademie für Musik und darstellende Kunst. Nach der dreijährigen Ausbildung und den folgenden vielen Aufenthalten an verschiedenen Bühnen kam Ida Ehre 1931 nach Berlin, wo sie für den Rundfunk arbeitete und einen Filmvertrag erhielt. Doch der Film wurde nicht mehr gedreht. Mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten erhielt Ida Ehre Berufsverbot.
Ihr Mann, der Arzt Dr. Bernhard Heyde, den sie geheiratet hatte, als die gemeinsame Tochter Ruth (geb. 1928) unterwegs war, kündigte seine Stellung als Oberarzt. Gemeinsam ging die Familie nach Böblingen und eröffnete dort eine Praxis. Doch die NS-Ideologie machte auch vor dem Privatleben des Paares nicht halt. Als überzeugter Deutschnationaler erklärte Bernhard Heyde seiner Frau 1934, er werde zwar sie und die Tochter nicht verlassen, als deutscher Mann könne er aber nicht mehr mit ihr intim sein. Er erwarte von ihr keine Treue, und wenn sie schwanger werden sollte, so würde er das Kind als das seine akzeptieren.
Ida Ehre lernte Wolfgang (der Nachname ist nicht bekannt) kennen. Und es begann ein Dreier- bzw. Vierecksverhältnis, denn auch Bernhard Heyde ging eine außereheliche Liebesbeziehung ein.
Während Bernhard Heyde als "wehruntüchtig" galt, da er sich zum Schutze seiner Frau weigerte, sich scheiden zu lassen, und so die Familie mit Praxisvertretungen über Wasser halten konnte, wurde Wolfgang als Soldat eingezogen. Als ihn sein Bruder unter Druck setzte, das Verhältnis mit einer Jüdin aufzugeben, verließ Wolfgang seine Geliebte und heiratete die Freundin Bernhard Heydes, Maria, um, wie er sagte, bei der Rückkehr von der Front, jemanden zu haben, mit dem er reden könne.
1943 kam Ida Ehre für sechs Wochen ins KZ Fuhlsbüttel.
Nach dem Krieg, 1948, tauchte Wolfgang wieder in Hamburg auf, das Verhältnis begann von neuem. Siebzehn Jahre lang lebten Bernhard Heyde, Ida und Wolfgang in einer gemeinsamen Wohnung in der Hallerstraße. Dann stellte Wolfgang ein Ultimatum. Ida Ehre bat ihren Mann, sie gehen zu lassen. Er jedoch weigerte sich mit der Begründung, wer so lange verheiratet sei wie sie beide, solle sich nicht mehr trennen. Ida Ehre blieb aus Nibelungentreue.
1945 gründete Ida Ehre die Kammerspiele in der Hartungstraße. Das Haus hatte ihr der damalige britische Theateroffizier John Olden, später verheiratet mit der Schauspielerin Inge Meysel, verschafft. Ein Jahr später fand hier die legendäre Uraufführung von Wolfgang Borcherts "Draußen vor der Tür" statt. "Bei der Verwirklichung des Programms, das sich die Prinzipalin vorstellte, standen ihr zwei wunderbare, unbezahlbare Helfershelfer zur Seite. Der britische Theateroffizier John Olden, der sie schon bei der Erteilung der Theaterlizenz unterstützt hatte, und, etwas später, Hugh Carlton Greene, der 1946 Chief-Controller des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) wurde. John Olden liebte das Theater, und er öffnete Ida Ehre immer wieder neue Türen auf ihrer Suche nach den Stücken, die während des Dritten Reiches in Deutschland nicht gespielt werden durften.
Mindestens ebenso wichtig als Gesprächspartner, Helfer und Freund war für Ida Ehre Hugh Carlton Greene, der später, in den sechziger Jahren, als Generaldirektor der BBC zum Sir geadelt wurde. (…)"1) Und auch Bürgermeister Max Brauer unterstütze Ida Ehre und "sorgte auf Drängen Ida Ehres dafür, daß das Haus in der Hartungstraße von der Stadt angekauft und der Prinzipalin zur Verfügung gestellt wurde". 2)
Einer ihrer Kinderdarsteller war der spätere Schriftsteller Hubert Fichte. Er war damals zwölf Jahre alt und "war gleich bei den ersten Aufführungen dabei. ‚Wie sollten wir leben ohne das Geld, das ich dazuverdiente?' Der Kinderdarsteller sauste zwischen Schule und Theater hin und her (…)." 3)
"Ida Ehre war von 1946 bis 1948 Vizepräsidentin des Deutschen Bühnenvereins." 4) Als dessen Vertreterin saß sie auch im Entnazifizierungs-Komitee, das sich mit der NS-Belastung von SchauspielerInnen beschäftigte. In diesem Komitee wurde am 25. August 1945 entschieden, dass u. a. Heidi Kabel und ihr Mann Hans Mahler eine zwölf monate Auftrittsperre bekamen.
Ida Ehre "gehörte von 1948 bis 1952 dem Hauptausschuß des Nordwestdeutschen Rundfunks an, war 13 Jahre Mitglied des Verwaltungsrates des Norddeutschen Rundfunks. Sie setzte sich mit all der Kraft, die ihr zur Verfügung stand, jahrelang für die Interessen sämtlicher Privattheater in Hamburg ein. (…) Sie hatte zwei Weltkriege durchlitten, Und sie hatte daraus gelernt, sich einzumischen. Laut zu schreien gegen den Krieg, für den Frieden, für Freiheit, für Toleranz, nicht opportunistisch zu handeln, sondern mutig und gradlinig." 4)
Für ihre Verdienste um den kulturellen Wiederaufbau der Stadt erhielt sie 1970 die Medaille für Kunst und Wissenschaft, 1975 den Professorentitel, 1983 das große Bundesverdienstkreuz und 1985 die Ehrenbürgerschaft Hamburgs.
Text im wesentlichen: Brita Reimers
Quellen:
1) Anna Brenken: Ida Ehre. Hamburg 2002, S. 51. (Hamburger Köpfe. Hrsg. von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius)
2) Anna Brenken, a. a. O., S. 53.
3) Anna Brenken, a. a.O., S. 57.
4) Anna Brenken, a. a. O., S. 11.
Vgl: Ida Ehre: Gott hat einen größeren Kopf, mein Kind … 5. Aufl. München, Hamburg 1989.
|
|
 |
 |
 |

Photo aus: Ulrich Bauche u. a. (Hrsg.): Wir sind die Kraft. Arbeiterbewegung in Hamburg von den Anfängen bis 1945. Hamburg 1988. |
 |
Erika Etter, geb. Schulz |
| 22.9. 1922 - 22.4.1945 gehenkt im KZ Neuengamme |
| Hausfrau. Mitglied der Widerstandsgruppe Etter-Rose-Hampel |
Ohlsdorfer Friedhof, Ehrenhain der Widerstandskämpfer 1933-1945, Grab Nr. L5, 256-310
Erika-Etter-Kehre, Bergedorf, seit 1985, benannt nach Erika Ilse Etter, geb. Schulz.
Stolpersteine vor dem Wohnhaus Alsterdorfer Straße 40.
Während des Zweiten Weltkrieges gehörte Erika Etter, die Hausfrau aus der Alsterdorfer Straße 40, mit ihrem Mann Werner Etter einer Hamburger Widerstandsorganisation an, die nach Kriegsende als Gruppe Etter-Rose-Hampel bezeichnet wurde (Etter: Werner Etter; Rose: Elisabeth (Liesbeth) Rose; Hampel: Ernst Hampel).
|
"Erika Schulz entstammte einer sozialdemokratischen Familie aus Barmbek, der Vater Adolf war Tischler, die Mutter Charlotte Hausfrau. Erika besuchte die Versuchsschule Tieloh und die Mädchenschule Langenfort und war Mitglied im Sportverein USC Paloma. Nach dem hauswirtschaftlichen ‚Pflichtjahr' absolvierte sie eine Lehre als Verkäuferin. Beim Sport lernte sie den neun Jahre älteren Orthopädie-Mechaniker Werner Etter kennen und lieben. Dieser gehörte nach 1933 zur illegalen Leitung des KJVD-Unterbezirks Uhlenhorst-Winterhude und wurde deshalb 1935 zu zwei Jahren Haft verurteilt.
Erika Schulz und Werner Etter heirateten im September 1941 und zogen in die Alsterdorfer Straße 40. Gemeinsam arbeiteten sie in der Widerstandgruppe ‚Etter-Rose-Hampel' gegen die Nationalsozialisten.
Nach der Bombardierung Hamburgs 1943 verließ Erika Etter die Stadt und brachte am 8. März 1944 im Mütterheim Wittenburg ihren Sohn Jan zur Welt, am gleichen Tag erhielt sie auch Besuch von ihrer Mutter und Werner Etter. Ebenfalls am 8. März wurde in Hamburg ihr Vater verhaftet und nach Fuhlsbüttel gebracht. Am 21. März 1944 wurden ihre Mutter und ihr Ehemann inhaftiert.
Erika Etter kehrte daraufhin nach Hamburg zurück und erfuhr, dass man ihren Eltern und ihrem Mann vorwarf, den (ehemals zur Gruppe um Werner Etter gehörigen und jetzt zu Spitzeldiensten erpressten) Wehrmachtsdeserteur Herbert Lübbers beherbergt zu haben. In den letzten Märztagen wurden auch ihr Bruder Erich Schulz und seine Verlobte Lotte Becher festgenommen. Erika Etter war nun jedes menschlichen und wohl auch materiellen Rückhalts beraubt. Als ihr erst wenige Wochen altes Kind an Diphterie erkrankte, schrieb sie einen Brief an die Gestapo, und bat um Haftunterbrechung für ihren Mann. Das Kind starb am 7. Mai 1944, ohne dass sein Vater es noch einmal gesehen hatte.
Am 17. Mai suchte Erika Etter das Ziviljustizgebäude auf, um sich für ihre Verwandten zu verwenden. Dort traf sie zufällig auf den Verräter Lübbers und fuhr ihn unbedacht an: ‚Du hast meine Familie auf dem Gewissen!' Sie wurde auf der Stelle festgenommen und nach Fuhlsbüttel gebracht. Sie blieb ohne Prozess und ohne Anklage in Haft. Als Hamburg kurz vor der Übergabe an die Engländer stand, wurde ihr ihre Verlegung angekündigt und sie glaubte an ihre baldige Freilassung. Tatsächlich stand sie mit 12 weiteren Frauen und 58 Männern auf einer Liste von Häftlingen, die noch vor der Kapitulation exekutiert werden sollten. Sie wurde mit ihren Leidensgefährten nach Neuengamme gebracht. Über das, was dort folgte schreibt Gertrud Meyer: ‚Aus den Aussagen von Beteiligten geht folgendes hervor: Die Morde fanden in den Nächten zwischen dem 21. und 24. April 1945 statt. Die Frauen waren die ersten Opfer. Sie mussten sich völlig entkleiden. Dann wurden sie in zwei Gruppen, je sechs nebeneinander, gehängt. Erika Etter, die jüngste, war noch übriggeblieben, da für sie kein Haken mehr frei war. [Es gelang ihr zunächst, sich unter einer Bank zu verstecken.]
Die Männer wußten, was ihnen bevorstand. Sie verbarrikadierten die Bunkertüren und setzten sich zur Wehr, als die Türen gewaltsam von der SS geöffnet wurden. [...] Die SS warf schließlich Handgranaten durch die Bunkerfenster [...] Dann fand man Erika Etter, deren Fuß unter Mauerstücken hervorragte. Man zerrte sie heraus. Erika Etter lebte noch. Mit einem Steinbrocken wurde sie erschlagen.'
Nach dem Krieg wurde die Urne mit der Asche Erika Etters im Ehrenhain der Widerstandskämpfer auf dem Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt.
Werner Etter wurde in Hamburg geboren. Sein Vater fiel 1915 in Frankreich, die Mutter zog ihn und seinen Bruder Ewald allein auf. Er erlernte den Beruf des Orthopädie-Mechanikers, schloss sich dem Kommunistischen Jugendverband Deutschland (KJVD) an und wurde in Arbeitersportvereinen aktiv. Nach 1933 leitete er zusammen mit Werner Stender den illegalen KJVD-Unterbezirk Uhlenhorst-Winterhude. Er wurde deshalb am 16. Juni 1934 verhaftet und im Januar 1935 zu zwei Jahren Haft verurteilt, die er im Jugendgefängnis auf Hahnöfersand absaß. Nach seiner Entlassung nahm er wieder Kontakt zu seinen Freunden auf, u. a. Willy Haase, Max Kristeller, Ernst Hampel, Lisbeth Rose (‚Gruppe Etter-Rose-Hampel'). Man traf sich im Sportclub USC Paloma oder auf Wanderungen. In dieser Zeit lernte er auch seine spätere Frau Erika Schulz kennen. Überlebende der Gruppe beschrieben ihn später als frohe, starke Persönlichkeit mit klaren politischen Vorstellungen und Führungsqualitäten. Die Gruppenmitglieder schulten sich politisch und entwickelten Strategien, wie mit Einberufungen zum Kriegsdienst umzugehen sei: ‚Wenn sich ‚Soldatsein' nicht mehr vermeiden lässt, ist die Truppe unser politischer Arbeitsplatz.' Ziel der Gruppe war eine möglichst schnelle Beendigung des Krieges und der Sturz des Hitler-Regimes.
Im September 1941 heirateten Werner Etter und Erika Schulz. Sie bezogen eine Wohnung in der Alsterdorfer Straße 40. Werner wurde im Februar 1943 als Sanitäter zur Wehrmacht einberufen, aber bald wieder freigestellt, weil er in seinem Zivilberuf als Prothesenbauer gebraucht wurde. Er unterstützte seine Schwiegereltern, als diese Erwin Ebhardt, ein Mitglied der Gruppe Bästlein-Jakob-Abshagen, versteckten und ahnungslos den von der Gestapo ‚umgedrehten' Herbert Lübbers aufnahmen. Am 21. März 1944, kurz nach der Geburt seines Sohnes (8. März) wurde Werner Etter aufgrund von Lübbers' Denunziation gemeinsam mit Willy Haase und seiner Schwiegermutter Charlotte Schulz festgenommen und ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel eingeliefert. Am 31. Mai 1944 wurde er ins KZ Neuengamme überstellt, im Dezember 1944 befand er sich im Landgerichtsgefängnis Potsdam. Der Prozess gegen Werner Etter, Ernst Hampel und Lisbeth Rose endete für alle Angeklagten mit dem Todesurteil. Am 19. Februar 1945 wurde Werner Etter im Zuchthaus Brandenburg-Görden enthauptet."
Text: Ulrike Sparr aus der Datenbank: stolpersteine-hamburg.de
Quellen:
AfW (Amt für Wiedergutmachung) 220184; Rita Bake u. Brita Reimers: Stadt der toten Frauen, Hamburg 1997, S. 309f; Herbert Diercks: Gedenkbuch Kola-Fu, Hamburg, 1987; Ursel Hochmuth: Niemand und nichts wird vergessen, Biogramme und Briefe Hamburger Widerstandskämpfer 1933-1945, Hamburg 2005; Ursel Hochmuth u. Gertrud Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933-1945 Frankfurt 1980, S. 422ff; Gertrud Meyer: Nacht über Hamburg, Berichte und Dokumente 1933-1945, Frankfurt 1971, S. 106; Totenliste Hamburger Widerstandskämpfer und Verfolgter 1933-1945, Hamburg 1968.
|
|
 |
 |
 |
| Charlotte Frohn, verheiratete Anno |
 |

Photo: Hamburger Theatersammlung, Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky. Portrait von Isidor Poppe |
| 14.9.1840 1) Hamburg - 26.3.1888 Berlin |
| Schauspielerin am Hamburger Stadttheater von 1862 bis 1865 |
Ohlsdorfer Friedhof, Althamburgischer Gedächtnisfriedhof: Grabplatte "Stadttheater"
Charlotte Frohn wird auf dem Althamburgischen Gedächtnisfriedhof als Mitglied des Stadttheaters geehrt, obwohl sie dem Ensemble nur wenige Jahre lang, von 1862 bis 1865, angehörte. Das hat vermutlich damit zu tun, dass das Stadttheater zu ihrer Zeit längst nicht mehr auf der Höhe war, die es unter Friedrich Ludwig Schröder und seinen Nachfolgern erreicht hatte, so dass ein Talent wie Charlotte Frohn, auch wenn sie nur drei Jahre blieb, aus dem lückenhaften und ungenügenden Personal herausragen musste.
Charlotte Frohn, Tochter eines Schauspielerehepaares am Hamburger Stadttheater, wuchs unter einfachen, aber frohen Verhältnissen auf. Aufgrund eigener Neigung erhielt sie Unterricht bei dem Schauspieler Johann Christof Gloy und trat zum ersten Mal Mitte der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Altona auf die Bühne.
|
Nach einem kurzen Engagement in Danzig als jugendliche Liebhaberin ging sie ans Friedrich Wilhelmstädtische Theater nach Berlin, wo sie zwar nur kleine Rollen, dafür aber Unterricht bei Adele Peroni-Glasbrenner bekam. Ein dreijähriges Engagement am Hamburger Stadttheater, wo sie sich als tragisch-sentimentale Liebhaberin schnell die Gunst des Publikums erwarb, folgte. 1865 ging sie ans Hoftheater in St. Petersburg und vervollkommnete ihren Ruhm. Nach drei Jahren musste sie die geliebte Stadt jedoch aufgrund ihrer geschwächten Gesundheit verlassen. Von 1868 bis 1870 war sie am Hoftheater in Darmstadt. Die folgenden Jahre verbrachte sie ihr festes Engagement auf Gastspielreisen nach Reval, Königsberg, Hamburg, München. Darmstadt, Augsburg, Bremen, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Amsterdam, Rotterdam, Leyden, Köln, Düsseldorf, Aachen, Krefeld, Würzburg, Detmold und Graz. Nach einem sensationellen Erfolg im Wiener Carltheater als Clotilde in "Fernande von Sardou" gab sie ein längeres Gastspiel am deutschen Theater in Pest u.a. als Maria Stuart und als Gretchen. 1873 ging sie zurück nach Petersburg, wo sie 1878 ihren Kollegen Anton Anno heiratete. Nach einem gemeinsamen Aufenthalt in Dresden von 1880 bis 1884 zog das Paar nach Berlin, wie Anton Anno die Direktion des Residenz-Theaters übernahm. Seine Frau wurde nicht nur Mitglied des Ensembles, sondern auch seine Beraterin. Am 26. März 1888 verstarb sie infolge einer geringfügigen Verletzung am Finger überraschend an einer Blutvergiftung. Ihre Leiche wurde nach Hamburg in das Familiengrab überführt.
Text: Brita Reimers
Quellen:
¹ In der Literatur werden auch folgende Lebensdaten genannt:
14.12.1844 - 23.3.1888.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Luise Gabriely, geb. Zobel |
| 8.5.1911 - 9.8.2002 |
| Näherin, Kindermädchen, Diät-Köchin |
Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bn 73, 197
Die aus einer sozialdemokratischen Familie stammende Luise Gabriely besuchte die Volksschule und absolvierte von 1927 bis 1932 eine Lehre als Näherin und Kindermädchen. In ihrer Freizeit war sie im Internationalen Sozialistischen Kampfbund (ISK) aktiv.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten setzte Luise Gabriely ihr politisches Engagement fort. Sie hielt Kontakt zu ihren Genossen und arbeitete seit 1936 als Diät-Köchin in der vegetarischen Gaststätte des ISK [Internationaler Sozialistischer Kampfbund] an der Börsenbrücke in Hamburg. Am 17. Dezember 1936 wurde Luise Gabriely im Rahmen einer größeren Verhaftungsaktion festgenommen.
|
Die Geheime Staatspolizei verdächtigte sie, anti-nationalsozialistische Flugblätter verteilt zu haben, und brachte sie nach Fuhlsbüttel. Hier musste sie für einen Monat in Untersuchungshaft sitzen. Wieder in Freiheit, wurde die körperlich stark angeschlagene Luise Gabriely von der Gestapo wiederholt in Cafés, Läden oder auf der Straße abgepasst, um sie für Spitzeldienste zu gewinnen. Bei einer in diesen Tagen durchgeführten Hausdurchsuchung konfiszierten die Nationalsozialisten eine Reihe von Büchern sowie mehrere Schallplatten. Am 17. Januar 1938 wurde Luise Gabriely abermals verhaftet. Sie kam gemeinsam mit ihrer Freundin Emmi Kalbitzer in das Gefängnis an der Barnimstraße in Berlin. Der Verdacht lautete: Vorbereitung zum Hochverrat. Allerdings wurde kein Verfahren gegen Luise Gabriely eröffnet, so dass sie nach ihrer Entlassung am 14. November 1938 nach Hamburg zurückkehren konnte.
Beruflich hatte es die Regimegegnerin nach ihrer zweiten Haftentlassung schwer. Eine Wiederaufnahme der Beschäftigung in der als konspirativer Treffpunkt fungierenden Gaststätte war zu gefährlich. Zudem wurde Luise Gabriely, die ihre Wohnung auf gerichtliche Anweisung verlor, vom Arbeitsamt nur mit Auflagen vermittelt und hatte immense finanzielle Einbußen hinzunehmen. Ihre Eltern unterstützten sie nach Kräften. Wesentlich tief greifender war der gesundheitliche Schaden, den Luise Gabriely in den Gefängnissen nahm. Sie hatte während einer längeren Vernehmung einen Nervenzusammenbruch erlitten und musste ständig Herzattacken fürchten. Mehrere, teils aus eigener Tasche bezahlte Kuraufenthalte bewirkten nicht die erhoffte Besserung. Im November 1939 heiratete Luise Gabriely einen Genossen, der ebenfalls mehrfach verhaftet worden war und vermutlich 1943 an der Front bei Stalingrad ums Leben kam.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges engagierte sich Luise Gabriely, deren Gesundheit dauerhaft geschädigt blieb, im SPD-Distrikt Bramfeld- Nord. Sie nahm bis zu ihrem Tod am Parteileben teil.
Text: Meik Woyke
Quellen:
Für Freiheit und Demokratie. Hamburger Sozialdemokratinnen und Sozialdemokrfaten in Verfolgung und Widerstand 1933-1945. Hamburg 2003, S. 60.
|
|
 |
 |
 |
| Agnes Gierck, geb. Höhne |
 |
 |
| 28.2.1886 Weimar - 12.11.1944 Hamburg |
| Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, Langenhorner Hausfrau |
Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bn 73, 351
1997 wurde nach ihr in Langenhorn-Nord der Agnes-Gierck-Weg benannt. Vorher hieß diese Straße Peter-Mühlens-Weg. Sie wurde umbenannt wegen der nationalsozialistischen Vergangenhiet von Peter Mühlens.
Besuchte in Hamburg die Volksschule bis zur Selekta und arbeitete anschließend als Hausangestellte und Plätterin. 1909 Heirat mit dem Arbeiter Karl Gierck, bekam drei Kinder. In den 1920er-Jahren Eintritt des Ehepaares in die KPD. In der Zeit des Nationalsozialismus sammelte Agnes Gierck Spenden für Familien von Verfolgten, kassierte Parteibeiträge und stand Schmiere.
|
|
Sie wurde am 1. Oktober 1934 von der Gestapo verhaftet und im April 1935 wegen Volksverhetzung und Vorbereitung zum Hochverrat zu zwei Jahren Zuchthaus - ihr Mann, ihr Sohn und ihr Schwiegersohn zu je anderthalb Jahren Kerker - verurteilt. Nach ihrer Entlassung Wiederaufnahm der illegalen Widerstandstätigkeit. Durch die Jahre der Verfolgung und Haft sowie den Kummer über den Tod beider Söhne erlebte Agnes Gierck das Kriegsende nicht mehr. Sie starb 1944 nach langer Krankheit.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Charlotte Gross, geb. Behr |
| 6.3.1905 Samter bei Posen - 20.4.1999 Hamburg |
| Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus |
|
Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bn 73, 223
Geboren in Samter als Tochter eines Tischlermeisters zog Charlotte Gross 1911 mit ihren Eltern nach Berlin. Hier besuchte sie die Volksschule. Nach dem Schulabschluss und dem frühen Tod ihrer Mutter führte sie drei Jahre lang den Haushalt ihres Vaters, bis dieser 1923 erneut heiratete. Seit 1923 arbeitete Charlotte Gross als Fabrikarbeiterin in einem Berliner Metallbetrieb und war dort als Betriebsrätin aktiv. Zuerst war Charlotte Gross Mitglied des CVJM, dann bei den Naturfreunden; 1924 Eintritt in den kommunistischen Jugendverband. Sie wurde Mitglied der IAH und ab 1926 der KPD, sowie Leiterin des Roten Frauen- und Mädchenbunds.
|
Charlotte Gross war die Lebensgefährtin von Otto Wahls aus Hamburg, Mitglied des ZK der KPD, der nach 1933 ins Ausland ging. 1929 war das Paar, das sich 1927 kennen gelernt hatte, von Berlin nach Essen gezogen. Ende 1932 trennte sich das Paar und Charlotte Gross zog nach Hamburg. Hier führte sie bis 1935 dem Vater von Otto Wals den Haushalt und arbeitete dann wieder als Fabrikarbeiterin. 1936 lernte Charlotte Gross ihren späteren Ehemann Walter Gross, Dreher und ebenfalls Mitglied der KPD kennen. 1939 heiratete das Paar. 1) Das Paar wohnte in der Dettmerstraße 19 in Hamburg Barmbek.
Walter Gross wurde 1944 als Soldat an der Ostfront getötet. Charlotte Gross beteiligte sich 1935/36 an der Arbeit der KPD-Frauengruppe um Thea Saefkow und Rosa Thälmann und kam deshalb in sogenannte Schutzhaft in die Konzentrationslager Fuhlsbüttel und Lichtenburg. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs war Charlotte Gross fünfmal in Haft. Ihr zweites Kind gebar Charlotte Gross 1937 im Frauengefängnis Berlin/Barnimstraße. 1938 bis 1939 war sie im KZ Lichtenburg inhaftiert.
In den Jahren 1943/44 brachte sie als Kurierin Charlotte Gross der KPD-Widerstandsgruppe Bästlein-Jacob-Abshagen "in kleiner Anzahl illegale Schriften von Berlin nach Hamburg, vor allem NKFD-[Nationalkomitee Freies Deutschland, Zusammenschluss von kriegsgefangenen deutschen Soldaten] Materialien." 2) Als im Frühjahr 1944 die "Hamburger Kommunistenprozesse" gegen 47 Widerstandskämpfer in 12 Prozessen verhandelt wurden, fuhr Charlotte Gross "in jenen Wochen mehrmals nach Berlin, um Franz Jacob und Anton Saefkow über den Verlauf der Prozesse Bericht zu erstatten. In ihrer Anklageschrift vom 22. August 1944 heißt es dazu: ‚ … die Angeschuldigte Gross (überbrachte) dem Jacob widerholt Nachrichten über den Ausgang von Hamburger Kommunistenprozessen, teils unter Mitteilung der Namen von Verurteilten, die sie im wesentlichen von Katharina Jacob erfuhr.' [Charlotte Groß und Katharina Jacob waren befreundet]. Von einer dieser Reisen brachte sie auch von Franz Jacob verfaßte Flugblätter mit, die sich mit der Terrorjustiz in den Hamburger Prozessen auseinandersetzten. Ihre letzte Zusammenkunft mit Jacob hatte Charlotte Gross am 16. Juni 1944 in Berlin. Von dieser Kurierfahrt brachte sie außer einer Reihe NKFD-Schriften und Flugblättern auch ein Exemplar einer parteiinternen Niederschrift Saefkows und Jacobs mit, die bis zum Ende der Hitlerherrschaft sicher aufgehoben werden sollte." 3)
"Im Zusammenhang mit den Anfang Juli 1944 in Berlin erfolgten Festnahmen Anton Saefkows, Franz Jacobs, Otto Marquardts u. a. wurden auch Katharina Jacob und Charlotte Gross sowie Hanna Marquardt festgenommen. Während Hanna Marquardt in Hamburg in Haft verblieb, wurden Katharina Jacob und Charlotte Gross nach Berlin gebracht. Beide Frauen wurden vor dem Volksgerichtshof in der Prozeß-Serie gegen die Berliner KPD abgeurteilt. In der Verhandlung am 20. September 1944 beantragte der Staatsanwalt gegen Charlotte Gross die Todesstrafe, der Richter entschied auf 10 Jahre Zuchthaus." 4)
Am 20.4.1945 konnte sie beim Evakuierungsmarsch aus dem Frauenzuchthaus Jauer entfliehen. Charlotte Gross machte sich über diesen Evakuierungsmarsch Notizen: "Evakuierung Frauenzuchthaus Jauer. Todesmarsch am 26.1.45 [an anderer Stelle: Sonntag 28.1.45] morgens 5 ½ Uhr unter SS Bewachung 950 Frauen ohne Pause bis abends 18 Uhr [an anderer Stelle: 17 ½ Uhr]. Wer zusammenbrach wurde erschossen." 5)
Die Frauen mussten 27 Kilometer ohne Rast an diesem Tag gehen, als "Proviant: 1/3 Brot, 30 (Gr.) Margarine und 100 Gr. Wurst. Wetter: Schnee, Sturm. Gelaufen bis Goldberg, Ziegelei, 2 Tage Rast. Verpflegung: Montag: ¾ Ltr. Grütze. Dienstag: ½ Ltr. Kohlrüben.
Mittwoch 31.1.: Morgens ½ Ltr. Grütze, 1 Stück Brot, ¼ Harzer. Gelaufen bis Pilgramsdorf, 12 Klm., Scheune.
Donnerstag 1.2. Keine Verpflegung, gefahren bis Löwenberg, Greifenberg 25 Klm. Wetter sehr schlecht, Schnee und Regen. Scheune sehr eng, große Prügelei.
Freitag 2.2. Morgens ein Teil der Frauen Kartoffelsuppe. Verpflegung: 1 Stück Brot. Marsch nach Welkersdorf: 15 Klm. (Gefahren.) Sonnabend Verpflegung: Brot, ½ Ltr. Kartoffelsuppe. Sonntag 4.2. Verpflegung: Brot, Abmarsch nach Lauban, 14 Klm. Verpflegung: ½ Ltr. Mehlsuppe (gelaufen)
Montag 5.2. Verpflegung: Ganz groß, Brot, Margarine, 1 Löffel Hackfleisch. Nach Görlitz 24 Klm., sehr kalt und windig (gefahren.) Männergefängnis. Normale Verpflegung und Behandlung. Viele Erfrierungen und Krankheiten, 1 x Ruhr. Alle sehr erschöpft. Begleitmannschaft: SS-Scharführer Laub (Laug?) Litzmannstadt. Noch 1 SS-Mann, 5 SS-Frauen, alles Deutsch-Russen. 3 Beamtinnen von Jauer. 680 Frauen in Görlitz angekommen." 6)
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus war Charlotte Gross weiter politisch aktiv, so in der VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) und in der KPD/DKP. Während des Verbots der Hamburger VVN setzte sie ihre antifaschistische Tätigkeit in der neugebildeten "Freien Beratungsstelle für die Opfer des Faschismus" fort. Später war sie Mitglied des Präsidiums der VVN-BdA. Außerdem war sie bereits in den 1950er Jahren im Erholungsheim "Heideruh" Buchholz Ahornweg 45 tätig, einem Erholungsheim für die im antifaschistischen Widerstand aktiv gewesenen Kameradinnen und Kameraden. Sie wurde auch Vorsitzende des Ferienheimes.
Charlotte Gross fungierte auch als Schriftführerin im Kuratorium Ehrenhain Hamburger Widerstandskämpfer (Ohlsdorfer Friedhof),
Text: Rita Bake
Quellen:
1) Anklageschrift (Abschrift): Der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof 8 J 180/44 g. Berlin, 22. August 1944. Aus: Archiv/Sammlung: Gedenkstätte E. Thälmann Hamburg.
2) Ursel Hochmuth, Gertrud Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933-1945. Frankfurt a. M. 1969, S. 372.
3) Ursel Hochmuth, Gertrud Meyer, a. a. O., S. 377.
4) Ursel Hochmuth, Getrud Meyer, a. a. O., S. 379.
5) Abschrift vom 30.12.2003 der von Charlotte Gross in Sütterlin mit Bleistift verfassten Notizen. Archiv/Sammlung Gedenkstätte E. Thälmann Hamburg.
6) Ebenda.
|
|
 |
 |
 |
| Betty Heine, geb. van Geldern |
 |

Bildquelle: Wikipedia |
| 27.11.1771 Düsseldorf - 3.9.1859 Hamburg |
| Mutter des Dichters Heinrich Heine |
Jüdischer Friedhof Ilandkoppel, Grab Nr: ZX 12
Heinrich Heine wies seiner Mutter Betty (Peira) die Hauptrolle in seiner Entwicklung zu, dem Vater Samson Heine, einem jüdischen Kaufmann für Luxusgüter, bekannte er seine Liebe.
Peira van Geldern, die ihren Vornamen später in Betty umwandelte, stammte aus einer prominenten jüdischen Familie von Hoffaktoren und Ärzten in Düsseldorf. Sie besaß die damals für Frauen höherer Schichten übliche Bildung, beherrschte das Lateinische, Französische und Englische so weit, dass sie die Literatur in der jeweiligen Originalsprache lesen konnte, und spielte Flöte. Rousseau und Goethe waren die Lieblingsautoren der dem aufklärerischen Gedankengut verpflichteten jungen Frau.
|
Ihr Sohn Heinrich Heine schreibt über sie: "Ihr Glauben war ein strenger Deismus, der ihrer vorwaltenden Vernunftrichtung ganz angemessen. Sie war eine Schülerin Rousseaus, hatten dessen ‚Emile' gelesen, säugte selbst ihre Kinder, und Erziehungswesen war ihr Steckenpferd. Sie selbst hatte eine gelehrte Erziehung genossen und war die Studiengefährtin eines Bruders gewesen, der ein ausgezeichneter Arzt ward, aber früh starb. Schon als ganz junges Mädchen musste sie ihrem Vater die lateinischen Dissertationen und sonstige gelehrte Schriften vorlesen, wobei sie oft den Alten durch ihre Fragen in Erstaunen setzte." (Heinrich Heine: Werke und Briefe in zehn Bänden. Hrsg. von Hans Kaufmann. Bd. 7. Berlin, 1980.)
Das in ihrer Zeit weit verbreitete empfindsame Schwärmertum lehnte sie ab. Auch war sie nicht bereit, sich Konventionen zu fügen, wenn diese gegen ihre Überzeugung standen. Auch politisch bezog sie eine eigene Position. Ihre Kinder warnte sie aufgrund der zerrütteten Verhältnisse im damaligen Deutschland vor der Misere der Kleinstaaterei. Eine aufgeweckte, gebildete und freidenkerische junge Frau also, deren eigenständige Entfaltungsmöglichkeiten allerdings "durch die streng patriarchalische Struktur der jüdischen Gesellschaft, die den Lebenstraum der Frauen auf Familie und Familienhaus begrenzt". 1) Auch Heinrich Heines Haltung zu Frauen war - "trotz seiner frühen Distanzierung vom Judentum - [von dieser gesellschaftlichen Struktur] geprägt. Die jüdische Tradition stützt und legitimiert Heines unverhohlen patriarchalisches Auftreten gegenüber den ihm nahe stehenden Frauen". 1)
Ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit hatte die junge Betty unter Beweis gestellt, als im Sommer 1796 der zweiunddreißigjährige Samson Heine in Düsseldorf auftauchte. Betty verliebte sich in den schönen, sanften jüdischen Kaufmann, der mit Luxusgütern handelte. Er befreite sie aus einer tiefen seelischen Krise, in der sie seit dem rasch aufeinanderfolgenden Tod von Vater und Bruder steckte.
Als die jüdische Gemeinde dem von auswärts kommenden Samson Heine die Heirats- und Niederlassungserlaubnis verweigerte, setzte Betty Himmel und Hölle in Bewegung und erreichte schließlich ihr Ziel: Die Hochzeit fand am 1. Februar 1797 in Düsseldorf statt. Betty Heine ließ sich fortan in der jüdischen Gemeinde kaum noch sehen. Sie erzog ihre Kinder nicht orthodox, sondern aufklärerisch-liberal und schickte sie aufs Lyzeum bzw. Gymnasium, wo sie die einzigen Juden Düsseldorfs auf einer höheren Schule waren.
Während Betty Heine, sich hauptsächlich um die Erziehung der Kinder kümmerte, baute Samson Heine sein Geschäft auf, was sich zunächst ganz erfolgreich anließ, wie auch die zunehmend komfortablen Wohnverhältnisse der Familie zeigen. Bettys Verdienst am Wohlstand lag darin, dass sie ihren verschwenderischen Mann in seinen Herren- und Militärallüren bremste.
In der Erziehung ihrer Kinder hatte sich Betty Heine vorgenommen, ihren Kindern den Weg zur Assimilierung und Nobilitierung zu ebnen, was bei dreien von ihnen auch nach ihren Vorstellungen gelang. Die einzige Tochter, Charlotte (geb. 1800), heiratete den angesehenen Hamburger Kaufmann Moritz Embden und wohnte mit ihm in der Esplanade. Maximilian (geb. 1806) wurde Militärarzt im russischen Dienst, heiratete eine russische Adlige und wurde in den persönlichen Adel erhoben. Nur der älteste Sohn, Heinrich (geb. 1797), widersetzte sich ihren Plänen. Statt eine Laufbahn als Höfling Napoleons, Bankier oder Jurist einzuschlagen, wählte er den Weg, den sie am meisten als brotlose Kunst fürchtete, den des Poeten. Da hatte es auch nichts genützt, dass die ökonomisch denkende Betty Heine jegliche, Begegnung ihres Sohnes mit der Welt der Poesie zu unterbinden gesucht hatte. Dazu schreibt Heinrich Heine: "Ihre [Betty Heines] Vernunft und ihre Empfindung war die Gesundheit selbst, und nicht von ihr erbte ich den Sinn für das Phantastische und die Romantik. Sie hatte, (…) eine Angst vor Poesie, entriß mir jeden Roman, den sie in meinen Händen fand, erlaubte mir keinen Besuch des Schauspiels, versagte mir alle Teilnahme an Volksspielen, überwachte meinen Umgang, schalt die Mägde, welche in meiner Gegenwart Gespenstergeschichten erzählten, kurz, sie tat alles Mögliche, um Aberglauben und Poesie von mir zu entfernen. (…)
Sie war überhaupt nicht damit zufrieden, daß ich Verse machen lernte, und seien es auch nur französische. Sie hatte nämlich damals die größte Angst, daß ich ein Dichter werden möchte; das wäre das Schlimmste, sagte sie immer, was mir passieren könne. Die Begriffe, die man damals mit dem Namen Dichter verknüpfte, waren nämlich nicht sehr ehrenhaft, und ein Poet war ein zerlumpter, armer Teufel, der für ein paar Taler ein Gelegenheitsgedicht verfertigt und am Ende im Hospital stirbt.
Meine Mutter aber hatte große, hochfliegende Dinge mit mir im Sinn, und alle Erziehungspläne zielten darauf hin. Sie spielte die Hauptrolle in meiner Entwicklungsgeschichte, sie machte die Programme aller meiner Studien, und schon vor meiner Geburt begannen ihre Erziehungspläne. Ich folgte gehorsam ihren ausgesprochenen Wünschen, jedoch gestehe ich, daß sie schuld war an der Unfruchtbarkeit meiner meisten Versuche und Bestrebungen in bürgerlichen Stellen, da dieselben niemals meinem Naturell entsprachen (…)." 2)
Trotz dieser Kritik an seiner Mutter, lobte er ihre Freigebigkeit und war gerührt von ihrer Aufopferung. "Welche Aufopferung bewies sie dem Sohne, dem sie in schwieriger Zeit nicht bloß das Programm seiner Studien, sondern auch die Mittel dazu lieferte! Als ich die Universität bezog, waren die Geschäfte meines Vaters in sehr traurigem Zustand, und meine Mutter verkaufte ihren Schmuck, Halsband und Ohrringe von großem Werte, um mir das Auskommen für die vier ersten Universitätsjahre zu sichern." (Heinrich Heine: Werke und Briefe in zehn Bänden. Hrsg. von Hans Kaufmann. Bd. 7. Berlin, 1980.)
Die Differenzen bezüglich der beruflichen Laufbahn führten zu keiner Trübung des Verhältnisses zwischen Mutter und Sohn.
Der späte Briefwechsel mit dem Sohn, von dem aufgrund einer Vernichtungsaktion Heines leider nur noch wenige Briefe der Mutter erhalten sind, zeugt von einer starken emotionalen Bindung zwischen Mutter und Sohn, nicht aber von einer intellektuellen Teilhabe Betty Heines an seinem Denken und Schaffen. Sie durfte, während er in Paris war, allenfalls kleine Besorgungen bei seinem Verleger Campe in Hamburg erledigen oder ihm aus einer örtlichen Leihbibliothek Bücher zusenden. Er bedankte sich mit Geschenken aus Paris, z. B. mit einem modischen Seidenkleid.
Welchen Einfluss die emotionale Bindung an die Mutter hatte, darüber bestehen in der Forschung Meinungsverschiedenheiten. Ob das Verhältnis im Bereich einer starken, eher positiven Mutter-Sohn-Beziehung anzusiedeln ist oder sich auf die fatale Einstellung des Sohnes zu Frauen auswirkte, der die Frauen in der Kunst stilisierte und sublimierte, im Leben aber nur Prostituierte und Grisetten begehren konnte, ist ohne eine differenzierte Beschäftigung mit dem Leben und Werk Heinrich Heines nicht zu beurteilen.
An seinem Lebensende diagnostizierte Heine "die Folgen seiner letztlich unaufgelösten Bindung an die Mutter. Und er stellt einen unmittelbaren Zusammenhang her zwischen ihr und seinen Frauen- und Liebesbeziehungen. Die ‚Pocken des Herzens', die stigmatisierenden Verletzungen also, die er daraus davongetragen hat, versteht er als Folge der mütterlichen Liebe und als Preis, den er für diese überstarke Bindung zu zahlen hat.
Der Preis ist hoch, Harry bleibt - trotz äußerer Trennung und Abgrenzung von den mütterlichen Lebenszielen - von der Mutter lebenslang emotional abhängig. Letztlich hält er fest an der Rolle des Sohnes, des Kindes. So kann er Mutters Liebling bleiben, auch ihr unartiger Liebling, eine Rolle, die ihr Pendant in Heines literarischem Image als unartiger Liebling der Grazien hat, und von der es nicht weit ist in die anarchistische Freiheit des Narren. Dies sind die Rollen, die Betty bereits von ihrem Bruder Simon kennt, schon bei Harrys Vater toleriert hat und die der Sohn von beiden übernimmt", 3) schreibt die Literaturwissenschaftlerin Edda Ziegler in ihrem Buch über "Heinrich Heine. Der Dichter und die Frauen".
Betty Heines weiterer Lebensweg war von dem wirtschaftlichen Bankrott ihres Mannes überschattet. Der Handel mit Luxusgütern war ein Geschäft, das gegen Wirtschaftskrisen empfindlich war; zudem hatte der lebenslustige Samson Heine keinen rechten Kaufmannssinn. Im Frühjahr 1819 musste er Bankrott anmelden - der Anfang vom Ende für ihn. Betty Heine folgte ihrem Mann im März 1820 über Hamburg nach Oldesloe, 1821 oder 22 nach Lüneburg und schließlich 1828 nach Hamburg, wo Samson Heine am 2. Dezember 1828 starb. Der Bankier Salomon Heine, der die Familie seines Bruders schon seit dem Bankrott finanziell unterstützt hatte, setzte seiner Schwägerin eine Rente von 1.000 Mark jährlich aus. Betty Heine starb am 3. September 1859, dreieinhalb Jahre nach ihrem Sohn Heinrich Heine.
Quellen:
Wesentliches von Brita Reimers
1) Edda Ziegler: Heinrich Heine. Der Dichter und die Frauen. Düsseldorf 2005, S. 9.
2) Heinrich Heine: Werke und Briefe in zehn Bänden. Hrsg. von Hans Kaufmann. Bd.7. Berlin, Weimar 1980.
3) Edda Ziegler, a. a. O., S. 36f.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Louise Johanna Helene Hell, geb. Lutteroth, gesch. von Legat |
| 19.5.1829 Hamburg - 15.11.1904 Hamburg |
| "Wilhelm und Helene Hell Stiftung" |
Ohlsdorfer Friedhof Grab,AA 10, 75-84
Das Grab wurde in Patenschaft gegeben
Louise Johanna Helene Hell wurde am 19. Mai 1829 als jüngste Tochter des Hamburger Bürgermeisters Ascan Wilhelm Lutteroth und seiner Frau Juliane Friderike Charlotte geb. von Legat geboren und wuchs mit ihren vier Schwestern und vier Brüdern in dem großbürgerlichen Landhaus ihrer Eltern im Eimsbüttler Park auf.
Einen Tag vor ihrem 21.Gebrurtstag heiratete Louise ihren Vetter Erhard Wilhelm Egbert von Legat. Die Ehe wurde später geschieden.
|
Im Stammbaum der Lutteroths, der sich im Staatsarchiv Hamburg befindet, ist Helene bis zu ihrer Generation die einzige, die geschieden wurde. Fast vier Jahre danach heiratete Helene zum zweiten Mal. Ihr zweiter Ehemann hieß Daniel Wilhelm Hell. Er war ein Hamburger Kaufmann und Besitzer der chemischen Fabrik "Hell & Sthamer" in Billwerder bei Hamburg. Die zweite Ehe blieb genau wie die erste kinderlos. Das Ehepaar Hell wohnte am Havesterhuderweg 21, wo Helene Hell auch als Witwe weiterlebte. Das Testament, welches sich ebenfalls im Hamburger Staatsarchiv befindet, weist auf ein wohlhabendes Leben der Hells hin.
Verwandte und Hausangestellte wurden mit großzügigen finanziellen Nachlässen bedacht. Außerdem sah das Testament eine umfangreiche Alterversorgung für Helene vor. Dadurch sollte sie nach dem Tod ihres Gatten - er starb am 20. September 1894 - den gewohnten großzügigen Lebensstil weiterführen können.
Einen weiteren Schwerpunkt des Testamentes bildete die Idee einer "Wilhelm und Helene Hell Stiftung": "Der Zweck dieser Stiftung soll die Erziehung und Ausbildung verwaister und vermögensloser Kinder, deren Eltern eine gehobene Lebensstellung eingenommen hatten, sein. … Die nähere Einrichtung der Stiftung überlassen wir unseren Testamentsvollstreckern in Gemeinschaft mit einem von ihnen für die Mitverwaltung zu erbittenden Mitglied des Hohen Senats oder des Hanseatischen Oberlandesgerichts. Wir selbst sprechen nur den Wunsch aus, daß der Charakter der Stiftung stets so erhalten werde, daß den Kindern möglichst die Annehmlichkeiten eines eigenen Heims und die Wohltat einer allerbesten Erziehung gewährt werden, und sie vor den Folgen bewahrt bleiben mögen, welche der Mangel jener wichtigsten Güter eines Kindes oft für dessen ganzes Leben im Gefolge hat." (Gemeinschaftliches Testament der Eheleute Daniel Wilhelm Hell und Frau Helene Luise Johanna geb. Lutteroth vom 11. Februar 1892, 7). 1895 wurde die heute noch existierende Stiftung gegründet.
Auch Helene Hells eigenes Testament, welches am 23. November 1904 eröffnet wurde, zeigt Helenes Großzügigkeit und Fürsorglichkeit. Mit großer Sorgfalt bedachte sie all ihre Bediensteten, ihre Gesellschafterin, ihren Kutscher, ihren Gärtner, ihr Dienstmädchen und ihre Köchin mit finanziellen Nachlässen.
Text: Steffani Schilling
|
|
 |
 |
 |
| Julie Herrmann (Juliane Caroline Louise Hermann verh. Lutze) |
 |
 |
| 19.2.1823 Hamburg - 25.8.1889 Hamburg |
| Schauspielerin |
|
Althamburgischer Gedächtnisfriedhof Grabplatte "Thalia"
Als am 9. November 1843 Hamburgs zweite große Bühne, das Thalia-Theater eröffnet wurde, war die junge Schauspielerin Julie Herrmann in umfangreichem Maße an der Eröffnungsvorstellung beteiligt. Zusammen mit Carl Meixner sprach sie den von A. E. Wohlheim gedichteten Prolog "Alt und Neu", ein humoristisches Zwiegespräch, das die Verbindung von alter und neuer Zeit herstellte und das von solcher Naivität war, dass die junge Schauspielerin den Publikumserfolg für sich verbuchen konnte. Begeisterten Beifall erntete sie auch in einem der sich anschließenden Theaterstücke, in der Vaudeville-Posse "Köck und Guste", die in den folgenden Jahren mehrfach wiederholt wurde.
|
Als älteste Tochter des Schriftstellers und Direktors des Hamburger Stadttheaters, Anton Herrmann, am 19. Februar 1823 geboren, debütierte Julie Hermann am 1. Februar 1840, knapp 17jährig, auf der Bühne ihres Vaters als Gretchen in "Vorsatz".
Bei der Eröffnung des Thalia-Theaters ging sie an das neue Haus, das nur deshalb hatte gegründet werden können, weil die Witwe Handje für das Winkeltheater, das sie in ihrem Gasthof "Hotel de Rome" am Valentinskamp betrieb, im Jahre 1809 eine reguläre Theaterkonzession erhalten hatte, die bei ihrem Tod auf ihren Direktor, Chéri Maurice, übergegangen war, mit der Auflage, eine neue Spielstätte auf einem freien Platz zu gründen. Im Übrigen blieben theatralische Darbietungen aller Art bis zur Einführung der Gewerbefreiheit im Jahre 1869 innerhalb des Stadtgebietes aus Konkurrenzgründen verboten. Als das neu errichtete Haus am Pferdemarkt (heute Gerhart-Hauptmann-Platz) sich schnell zu einer beliebten Bühne entwickelte, die dem Stadttheater empfindlich Konkurrenz machte, erweiterte der Senat seine ursprüngliche Auflage, nur Lustspiele zur Aufführung zu bringen, dahingehend, dass sie höchstens zwei Akte haben durften., Diese Verordnung wurde 1861 wieder aufgehoben.
Am Erfolg des Thalia-Theaters war Julie Herrmann, die als erste Liebhaberin und Soubrette schnell zum Publikumsliebling avancierte, sicherlich nicht unbeteiligt. 1849 gab sie ihre Bühnenlaufbahn jedoch auf, als sie den Kaufmann H. A. Lutze heiratete. Eine bürgerliche Existenz war damals mit der einer Schauspielerin kaum zu vereinbaren. So suchte Julie Herrmann die Möglichkeit, durch kleine literarische Arbeiten und Verfassen von Kompositionen mit dem Theater verbunden zu bleiben. Am 22. März 1873 wurde zu Kaiser Wilhelms Geburtstag auf der Bühne des Stadttheaters ein dramatisches Festgedicht von ihr aufgeführt: "Ein Sechsundsiebziger". Als Chéri Maurice am 29. Mai 1885, zwei Tage vor Übergabe der Bühne an seinen Sohn, seinen 80sten Geburtstag mit einem Festakt im Theater feierte, saß auch Julie Herrmann in einer der Logen "und war ebenso gerührt wie der Jubilar". 1)
Text: Brita Reimers
Quelle:
1. Erich August Greeven: 110 Jahre Thalia-Theater. Hamburg 1843-1953. Eine kleine Chronik. Hrsg. Von Willy Maertens. Hamburg 1953.
|
|
 |
 |
 |

Photo: Hamburger Theatersammlung, Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky. |
 |
Caroline Herzfeld (Louise Amalie Herzfeld geb. Stegmann) |
| 1776 Königsberg - 20.9.1812 Hamburg |
| Schauspielerin und Sängerin am Hamburger Stadttheater von 1792 bis 1812 |
Ohlsdorfer Friedhof, Althamburgischer Gedächtnisfriedhof:
Grabplatte "Stadttheater"
Caroline Herzfeld war die Tochter und Schülerin des Schauspielers, Sängers und Komponisten Karl David Stegmann, der von 1798 bis 1811, nach der zweiten Direktionsperiode Friedrich Ludwig Schröders, Mitdirektor des Hamburger Stadttheaters war. Ihre Mutter war die Schauspielerin Caroline Johanne Eleonore Linzen. Auch die jüngere Schwester, Wilhelmine, ging zur Bühne. 1792 erhielt Caroline Herzfeld zusammen mit ihr und ihren Eltern, die bereits früher am Stadttheater gespielt hatten, ebenda ein Engagement als Schauspielerin und Sängerin.
Am 10. Dezember debütierte die 16jährige in einer Opernrolle, der Lina im "Rothen Käppchen" von Dittersdorf.
|
Im selben Jahr war auch der Freund und Schüler Friedrich Ludwig Schröders, Jacob Herzfeld, der wie Karl David Stegmann 1798 Mitdirektor wurde und ab 1815 das Haus zusammen mit Friedrich Ludwig Schmidt leitete, ans Stadttheater gekommen. Ihn heiratete die junge Schauspielerin am 26. November 1796, nachdem er zur christlichen Religion übergetreten war. Das Paar bekam sieben Kinder, der im Jahre 1800 geborene Sohn Adolf wurde auch ein bekannter Schauspieler.
Caroline Herzfeld trat bis zu ihrem Tode im Jahre 1812 in zahlreichen Rollen in klassischen Dramen, bürgerlichen Schauspielen und in Opern auf. Die Titelrolle in der Hamburger Erstaufführung der "Maria Stuart" (16.10.1801) war einer der Höhepunkte ihrer Kunst. "Schön und vollkommen",¹ nannte der Rezensent in den "Annalen des Theaters" ihre Darstellung; ihre Johanna in der Hamburger Erstaufführung der "Jungfrau von Orleans" (15.12.1801) blieb für ihn dahinter zurück. Ein Gedicht, das ebenfalls in den "Annalen" erschien, rühmt sie dagegen:
"An Madame Herzfeld, als Jungfrau von Orleans.
Hohen Preises würdig ist, die im weiblichen Busen,
Mit dem zarteren Sinn Vollkraft des Mannes vereint;
Und des begeisterten Dichters Gebild mit gleicher Begeisterung
Von der Bühne herab zeiget dem staunenden Volk!
Deine Töne, sie drangen erschütternd ins Innere des Herzens;
Füllten mit Staunen den Geist, füllten mit Wehmut die Brust.
Wähnend, es spräche der Gottbeseeligten eine, verstummte
Rings die Menge; doch schnell mächtigen Klanges, erscholl
Unermeßlicher Ausbruch der gränzenlosesten Freude:
Schaffender Geisteskraft einzig beglückender Lohn.
Darum achtet die Künstlerin gleich dem höheren Wesen,
Das vom olympischen Sitz niederes Thun überschaut,
Und sich bald in freundlicher Milde des Tages verkündet,
Bald in Wettern der Nacht Staunen und Ehrfurcht gebeut!"¹
Carl August Lebrun widmete der Kollegin einen Passus in seiner Geschichte des Stadttheaters. Neben ihren künstlerischen Fähigkeiten hob er besonders ihre bürgerlichen Tugenden hervor, die ihr die Akzeptanz bürgerlicher Kreise und den Zugang zu ihnen ermöglichte. "Es ist hier wohl an der Stelle, der großen Verdienste dieser Künstlerin besonders zu gedenken, die in der Oper wie im recitierenden Schauspiele als eine der ersten Stützen des Repertoires mit unermüdlicher Thätigkeit wirkte. Von der so gerechten als wohlerworbenen Gunst des Publikums getragen, entfaltete Mad. Herzfeld so viele Liebenswürdigkeit als Talent, und ihre Maria Stuart, Jungfrau von Orleans leben noch im Gedächtnisse vieler Theaterfreunde, während die häuslichen Tugenden der Künstlerin sie zu einer der geachtetsten Mitbürgerinnen Hamburgs erhoben. Im Kreise ihrer Kunstgenossen war sie selbst von denen geschätzt, die nicht ohne einigen Neid auf ihre Stellung hinblickten, und eine alles besiegende Verehrung schien so kleinliche Gefühle gewaltsam unterdrücken zu können." - "Seltne Herzensgüte, Talent, Anspruchslosigkeit, strengste Ausübung der Gatten-, Mutter- und Hausfrauenpflichten, und freundliches, liebevolles Benehmen hatten ihr von jeher die ausschließliche Liebe und Achtung des Hamburger Publikums gesichert."²
Ähnlich würdigte auch der "Orient" Caroline Herzfeld, als sie im Alter von nur 36 Jahren bei der Geburt ihres siebenten Kindes starb: "Frau Caroline Herzfeld geb. Stegmann, starb an den Folgen einer zu frühzeitigen Entbindung am 20sten September, morgens um 8½ Uhr. Sie ward Mutter von sieben sie überlebenden, noch unmündigen Kindern. - Sie, als Künstlerin der Stolz unserer Bühne, war das Glück ihres sie unendlich liebenden Gatten im vollen Sinne des Wortes. Wer sie kannte, weiß, daß auf ihrem unbeschreiblich sanften Antlitz die ganze Seelengüte lächelte, womit sie jeden, der sie sah, freundlich erheiterte. Sie, die Frau des Direktors, sie der Liebling des alten Schröders, der mit so vielen um sie Thränen der Wehmut weint, war ganz frei von aller Kabale, von jeder Sucht zu glänzen, war so ganz Resignation, daß sie jedes Talent, was in ihrem Fache glänzte, mit innigem Wohlbehagen glänzen sah. In Rücksicht eines unbestechlichen, tugendhaften Wandels war sie nicht allein allen dramatischen Künstlerinnen, sondern auch vielen andern Damen ein gar erbauliches Muster. - Ruhe sanft, du Gute! Am Throne der Herrlichkeit harret rein die Palme; Du bist vollendet, wir trauern! Blicke sanft lächelnd herab, und segne uns mit der Seelenruhe, womit Dich hienieden Gott lohnte."³ Bei aller Sympathie für die Kollegin beurteilte Friedrich Ludwig Schröder ihr Talent nicht so positiv, vermutlich ein Ausdruck der Differenz zwischen Schröders Ansprüchen und denen seines Publikums, was während seiner Direktionszeit auch immer wieder zu Querelen führte: In einem Brief an Herzfelds Mitdirektor Friedrich Ludwig Schmidt anlässlich des Todes von Caroline Herzfeld heißt es: "So großen Theil ich auch an dem Tode der braven, als Schauspielerin freilich leicht zu ersetzenden Frau nehme, so kam er mir, nach der schweren Krankheit, die sie hatte, doch nicht unerwartet."4 Das Theater ehrte Caroline Herzfeld am 23. September, ihrem Beerdigungstag, mit einer Gedächtnisfeier auf der Bühne. "Gedächtnisfeyer der verewigten Caroline Herzfeld gewidmet von Friedrich Ludwig Schmidt (Gehalten am 23.sten September, am Begräbnistage der Entschlafenen. Die Bühne war schwarz ausgeschlagen, Madame Schröder, in tiefe Trauer gehüllt, sprach folgende Stanzen:)
Ein ernst Geschäft führt mich in dieser Stunde
Auf diesen Schauplatz, sonst dem Spiel geweiht.
Vernehmet sie, die fürchterliche Kunde:
Sie ist nicht mehr, die hier euch oft erfreut!
Ein unerbittlich Schicksal schlug die Wunde,
Versenkte euch wie uns in tiefes Leid.
Drum wählt' ich euch zu Zeugen unsrer Schmerzen,
Ihr trugt, wie wir, die Holde ja im Herzen.
So wollen wir dann miteinander klagen,
Und laut bekennen unseren Verlust,
Ihn gegenseitig fühlen und ertragen -
Ach! Mittheilung erleichtert ja die Brust.
Der Rede Schmuck bedarf's nicht, um zu sagen,
Wie Allen hier ihr hoher Wert bewust
In ihrem frommen kindlichen Gemüthe
Vereinte sich das Bild der Lieb' und Güte.
Drum möge die Erinn'rung jetzt erneuern
Was sie, die Unvergeßliche, uns war.
Talent und Tugend im Vereine feiern
Ihr Angedenken hier auf immerdar.
Ihr sahet in der nun verklärten Theuren
Der Tugend Bild seit Jahren hell und klar;
Saht sie im Frühling ihres schönen Lebens,
Und waret Zeuge ihres höhern Strebens.
Damals, in jener gold'nen Zeit erfreute
Das zarte Mädchen hier euch wundersam;
Und Deutschlands Garrick, unser Schröder, weihte
Zu ihrem Bildner sich auf ihrer Bahn.
Thaliens Spiel, des Lebens heitrer Seite,
War sie in jenen Zeiten zugethan.
Wir seh'n sie noch, die lieblichen Gestalten,
vor unsern Augen schöpferisch entfalten.
Und als Sie sich zur ernsten Muse wandte -
Wen rührte nicht ihr sanfter Ton und Blick?
In Schottlands Königin - O wer erkannte
In ihr nicht jener Dulderin Geschick!
Wie sie das Kreuz andächtiglich umspannte -
Wer ruft nicht ihre Worte sich zurück:
Wohl sprach sie war: ‚Sie hat nichts mehr auf Erden!
Im bessern Leben nur kann Lohn ihr werden?
Doch haben wir dem künstlerischen Streben
Der Theuren unsern Zoll hier dargebracht,
Sey auch der Gattin und der Mutter Leben
Ein ewig Angedenken angefacht. -
O mög' ihr Geist die Waisen stets umschweben!
Und eine höhere allgüt'ge Macht,
Dem Gatten und den früh verwais'ten Kindern,
Den Schmerz, den unaussprechlichen, bald lindern.
So ruhe Sie den sanft, die Engelreine,
Die alle wir geehrt und wahr geliebt.
In ihrer Nähe lebte Keiner, Keine,
Die sie durch eine Miene nur betrübt.
Ihr Tod - ihr Tod nur ist das einzig Eine,
Wodurch sie Kummer an uns hat verübt.
Drum stimmt ein in unsre tiefe Klage,
Die jetzt ertönt an ihrem Sarkophage.
(Hier wandte sich die Rednerin nach dem Hintergrund, der sich erhob, und die Aussicht in ein tieferes schwarzes Zimmer gewährte. Dort erblickte man den erhöhten Sarcophag mit dem Namen der verewigten und mit Blumen umwunden. Am Fuße desselben stand der Todesengel mit umgekehrter Fackel; rechts sämmtliche Damen und links sämmtliche Herren des Theaters, schwarz gekleidet. Ein feierlicher Chor, vom Doctor Romberg componiert, ertönte.)
Chor
Flüchtig sind des Menschen Freuden,
Traum nur ist sein Glück.
Werden, Blühen, Welken, Scheiden,
Das ist sein Geschick.
(Folgende Strophen hatte der Verfasser aus Schillers
Glocke entlehnt und Madame Becker sang sie solo)
Ach! die Gattin ist?s die Theure,
Ach! es ist die treue Mutter,
Die der schwarze Fürst der Schatten
Wegnahm aus dem Arm des Gatten,
Aus der zarten Kinder Schaar,
Die sie an der treuen Brust
Wachsen sah mit Mutterlust -
Ach! des Hauses zarte Bande
Sind gelöst auf immerdar,
Denn sie wohnt im Schattenlande.
Die des Hauses Mutter war.
Chor
Doch wer fromm hier ausgesäet,
Endet froh den Lauf.
Sturm und Regenzeit vergehet,
Seine Saat keimt auf.
(Hier wand sich der Vorhang sanft herab.)
Dr. Rombergs himmlische Musik, von ihm selbst dirigiert, die alle Herzen tiefergreifende Rede unserer Schröder; das sichtbare und unerkünstelte Leidwesen der Leidtragenden, und jene empfindungsvolle Poesie selbst, vollendeten einen Eindruck, der Verklärten und unseres Publikums würdig, welches mit andächtiger Stille die Worte aus dem Herzen vernahm; ja viele Damen und Herren in den Logen waren schwarz erschienen, alle waren auf das tieffste gerührt. Eine schöne Vorstellung von Leisewitz Julius von Tarent beschloß diese höchst anständige Gedächtnisfeier. -"³
Text: Brita Reimers
Quellen:
¹ Zitiert nach: Johannes Hoffmann: Schillers ‚Maria Stuart' und ‚Jungfrau von Orleans' auf der Hamburger Bühne in den Jahren 1801-1848. Greifswald 1906.
² Carl August Lebrun: Jahrbuch für Theater und Theaterfreunde.
Jg. 1 o. O. 1841.
³ Orient oder Hamburgisches Morgenblatt Nr. 191.
4 Zitiert nach: Hermann Uhde (Hrsg.): Denkwürdigkeiten des Schauspielers, Schauspieldichters und Schauspieldirectors Friedrich Ludwig Schmidt 1772-1841. Hamburg 1875.
|
|
 |
 |
 |
| Thusnelda von Hess, geb. Hudtwalcker |
 |
 |
| 8.7.1781 Hamburg - 2.5.1866 Hamburg |
| Ehefrau des Schriftstellers, Topographen, Politikers und Aufklärers Jonas Ludwig von Hess (1756-1823) |
|
Althamburgischer Gedächtnisfriedhof. Grabplatte: "Freiheitskämpfer"
Thusnelda von Hess, das sechste Kind von Elisabeth Hudtwalcker (siehe Grab Nr.: W 21, 64-84 und Portrait auf dieser Seite), ist auf dem Althamburgischen Gedächtnisfriedhof auf der Grabplatte "Freiheitskämpfer 1813, 1814, 1815" als Ehefrau von Dr. Jonas Ludwig von Hess verewigt. Dieser wurde nach seinem Tode auf einem der Dammtorfriedhöfe bestattet. Sein Grabstein steht heute im Heckengartenmuseum. Die Grabplatte "Freiheitskämpfer" auf dem Althamburgischen Gedächtnisfriedhofs wurde zu Ehren von Jonas Ludwig von Hess und anderen errichtet.
|
Am 25. November 1805 heiratete Thusnelda Hudtwalcker den 25 Jahren älteren Gelehrten, nachdem sie zuvor lange Zeit einer unerwiderten Liebe nachgetrauert hatte. Im Jahre 1800 hatte die damals 19 Jährige den späteren berühmten Hamburger Juristen Ferdinand Beneke kennen gelernt. Es entwickelte sich eine Freundschaft, aus der bei Thusnelda Liebe wurde. Sie glaubte, dass ihre Liebe erwidert würde, Ferdinand Beneke war jedoch in eine andere - wenn auch unglücklich - verliebt.
Als 1802 ein anderer Mann in Liebe zu Thusnelda entbrannte, nutzte sie diese Gelegenheit, um Ferdinand Beneke zaghafte Liebessignale zu geben. In der Hoffnung, er würde angesichts eines ernsthaften Heiratskandidaten und damit potentiellen Konkurrenten die Initiative ergreifen und ihr endlich seine Liebe erklären, zog sie ihn ins Vertrauen und bat um seinen freundschaftlichen Rat. Gleichzeitig gab sie ihm, wie Ferdinand Beneke in seinen Tagebuchaufzeichnungen schreibt, einen "ungewöhnlichen Händedruck", so dass er bemerken musste, "daß sie einen andern (..) vorzieht - u. wenn die Eitelkeit mich nicht verblendet, so bin ich dieser Andre gar!" 1)
Thusneldas Rechnung ging jedoch nicht auf, Ferdinand Beneke riet der Freundin, den anderen zu heiraten. In ihrer Enttäuschung erklärte Thusnelda ihren Eltern, den potentiellen Heiratskandidaten nicht heiraten zu wollen.
In den folgenden Jahren litt Thusnelda still vor sich hin und liebte Ferdinand Beneke, der sich nach diesem Vorfall von Thusnelda zurückgezogen hatte, im innersten ihres Herzens weiter. Andere Männer sah sie in dieser Zeit nicht an - bis sie plötzlich 1805 den "50jährigen, kränkl. zus. geschrumpften, häßlich geformdten H." 2) v. Heß heiratete. Beneke äußerte sich dazu: "Aber welch innerer Zustand kann ein junges Mädchen a. d. großen Welt in die Arme des H. v. Heß, d. h. ins Kloster treiben? Weibliches romantisches Donquixotterie, Schwärmerey? Aber was kann den rechtschaffenen Heß entschuldigen? Sie muß um ihn angehalten haben. Anders ist es nicht möglich." 3)
Wie tief muss Thusnelda Hudtwalckers Verunsicherung gewesen sein, dass sie drei Jahre, nachdem ihr zaghafter Versuch gescheitert war, einem Mann ihre Liebe zu zeigen, nun einen ungeliebten Mann heiratete? Bei Ludwig von Heß hatte sie wenigstens die Gewähr, dass er sie nicht ablehnen würde, was ihrem angeschlagenen Selbstbewusstsein gut tat.
Quellen:
1) Staatsarchiv Hamburg: Fa. Beneke. Zit. nach: Anne-Charlott Trepp: "Denn das ist gerade meine Wonne …, daß Du mich wie ein kluges, denkendes Wesen behandelst". Frauen und Männer im Hamburger Bürgertum zwischen 1770 und 1840 - Fragestellungen und Ergebnisse. In: Hamburger Arbeitskreis für Regionalgeschichte. Mitteilungen 29. November 1996.
2) Ebenda.
3) Ebenda.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Margarethe Hoefer |
| 17.4.1896 Hamburg -28.2.1983 Hamburg |
| Lehrerin an der Schule Schottmüllerstraße. Mitglied der Bästlein-Jacob-Abshagen-Widerstandsgruppe |
Ohlsdorfer Friedhof, Geschwister-Scholl-Stiftung, Grab-Nr.: Bo 73, 8
Gretel - wie sie genannt wurde - lebte mit ihren Eltern und ihren vier Geschwistern im 4. Stock der Eppendorfer Landstraße 74.
Ihr Vater Hermann Hoefer (geb. 1868), ein Volksschullehrer, war 1892 vom Hamburger Senat für seine Verdienste im Kampf gegen die Choleraepidemie geehrt worden. Von 1928 bis 1931 war er Mitglied (KPD) der Hamburgischen Bürgerschaft gewesen und vertrat dort in der Schulpolitik die Ideen der pädagogischen Reformbewegung.
|
Kurz nachdem die Nazis die Macht ergriffen hatten, wurde Hermann Hoefer ohne Pension entlassen. Seine Frau Nina schrieb daraufhin in einem Brief an die Landesunterrichtsbehörde: "Ich habe wirklich geglaubt, als mein Mann vor ungefähr 2 Jahren ein Dokument vom Hamburger Staat erhielt, eine Anerkennung für 41jährige treue Pflichterfüllung, daß wir jetzt ganz geborgen seien. Die Entziehung des Ruhegehalts bedeutet für uns beiden Alten eine Zeit der Not und des Elends." 1
Die Tochter, Margarethe Hoefer, konnte ihre Eltern finanziell nicht unterstützen. Ihr, deren Vorbild stets der Vater gewesen und die deshalb Lehrerin und Mitglied der KPD geworden war, erlitt ein ähnliches Schicksal wie ihr Vater. Sie wurde am 19.4.1933 von den Nazis ohne Pensionsansprüche aus dem Schuldienst entlassen. Bis dahin hatte sie 12 Jahre als Lehrerin an der Schule Schottmüllerstraße gearbeitet.
Der ebenfalls seines Amtes enthobene Direktor der Volkshochschule, Dr. Kurt Adam, bot Margarethe Hoefer eine Tätigkeit in seinem Kaffeehandel an. Nun vertrieb Margarethe Hoefer Kaffee und nutzte diese Arbeit, um Flugblätter und anderes illegales politisches Material an Freunde weiterzuleiten.
Im Dezember 1933 wurde Margarethe Hoefer wegen Hochverrats verhaftet und in "Schutzhaft" genommen, aus der sie erst im Februar 1934 wieder entlassen wurde. Margarethe Hoefer leistete trotz alledem weiterhin illegale politische Arbeit, traf sich z.B. 1934 mit der englischen Lehrerin Eleonore Midgley, die sie 1931 in Berlin während eines Kongresses der IOL, einer Interessensgruppe oppositioneller Lehrerinnen und Lehrer, kennengelernt hatte. Am 21.9.1935 wurde Margarethe Hoefer zum zweitenmal in "Schutzhaft" genommen und kam, nachdem sie einen Monat im KZ Fuhlsbüttel gesessen hatte, ins Zuchthaus Lübeck-Lauerhof. Auch ihr Bruder Hermann, ein Jugendfürsorger, war in der Zwischenzeit aus politischen Gründen verhaftet worden.
In einem Brief vom 30.12.1935 aus dem Zuchthaus schrieb sie über ihr politisches Handeln: "Wenn ich in diesen Monaten nachdachte über mich und mein Leben, so habe ich nichts getan, als mich eingesetzt für Menschen, die arm sind, die es nötig hatten, daß ihnen jemand half, das sollte heute bestraft werden? Nein, das ist unmöglich, darum hab ich ein ganz ruhiges Gewissen und dann geht es mir gut." 1 Am 27.9.1937 wurde sie aus dem Zuchthaus entlassen - und ihr illegaler Kampf ging weiter.
Nach dem Ausbruch des Krieges schloß sie sich mit ihrem Vater der Widerstandsgruppe Bästlein-Jacob-Abshagen an, der größten und wichtigsten kommunistischen Widerstandsvereinigung. Bernhard Bästlein und Franz Jacob waren ehemalige Bürgerschaftsabgeordnete gewesen, zu ihnen kam noch Robert Abshagen. Die Organisation, die aus kleineren Zusammenschlüssen von Kommunistinnen und Kommunisten (75% der Mitglieder) und Nazigegnerinnen und -gegnern bestand, umfaßte ca. 300 Personen, die vor 1933 fast alle gewerkschaftlich organisiert gewesen waren und hauptsächlich aus der Arbeiterschicht kamen. Die Mitglieder der Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe verteilte unter ihren Arbeitskollegen und -kolleginnen Flugblätter, in denen über die wahren Kriegsereignisse aufklärt wurde. Auch versuchten die Widerständler durch Sabotageaktionen, die Rüstungsindustrie zu schwächen und nahmen Kontakt zu ausländischen Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern und Kriegsgefangenen auf, um ihnen ihre Solidarität zu bekunden und eine Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitssituation zu erreichen, aber auch um mit ihnen gemeinsame Sabotageaktionen in Rüstungs- und Großbetrieben durchzuführen. 1942 wurden 110 Mitglieder der damals ca. 210 Personen umfassenden Widerstandsgruppe von der Gestapo festgenommen. Die Widerstandsgruppe arbeitete dennoch weiter. Zwischen 1943 bis 1945 stießen weitere Gegner und Gegnerinnen des Nazi-Regimes zu der Gruppe, so daß sich ca. 300 Menschen in dieser Widerstandsgruppe zusammengeschlossen hatten.
1943 versteckte die Familie Hoefer zwei NS-Verfolgte in ihrem Holzhäuschen am Rande des Sachsenwaldes in Dassendorf. Am 7.6.1944 wurden Vater und Tochter Hoefer durch einen V-Mann verraten und verhaftet, die verstecktgehaltenen NS-Verfolgten wurden jedoch nicht entdeckt. Margarethe Hoefer kam nach Cottbus und dann zur Verhandlung vor den Volksgerichtshof nach Potsdam. Sie wurde gefoltert, um den Aufenthaltsort der von ihr Versteckten preiszugeben. Margarethe Hoefer hielt durch. Welche seelischen Qualen, neben den physischen sie ertragen mußte, machen die Zeilen vom 11.1.1945 an ihren Bruder Hermann deutlich: " ... nach allem, was man hier hört, besteht die Möglichkeit, daß gegen mich die höchste Strafe beantragt wird. Furchtbar und unausdenkbar". 1 Margarethe Hoefer wurde zu sieben Jahren, ihr Vater zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt. Beide kamen in verschiedene Lager. Am 23.4.1945 wurden sie befreit. Margarethe Hoefer machte sich sofort auf die Suche nach ihrem Vater - und fand ihn todkrank. Unter mühseligen Bedingungen transportierte sie ihn nach Hamburg. Margarethe Hoefer Vaters starb wenige Monate später am 13.12.1945.
Am 30.4.1949 wurde Margarethe Hoefer vom Hamburger Senat erneut verbeamtet und kehrte als Haushaltslehrerin an die Schule Schottmüllerstraße zurück. Politisch engagierte sie sich gegen die Wiederaufrüstung und beteiligte sich an den Ostermärschen. Sie wohnte zuletzt an der Borsteler Chaussee 301 im Stadtteil Groß Borstel.
Text: Rita Bake
Quellen:
1) Dietrich Rothenberg: Margarethe Hoefer. "Du stehst nicht allein." In: Hans-Peter De Lorent: Schule unterm Hakenkreuz. Hamburg 1985.
|
|
 |
 |
 |
| Clara Horn (Clara Maria Amalie Horn) |
 |

Photo: Hamburger Theatersammlung, Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky. |
| 6.11.1852 Berlin - 3.7.1884 Hamburg |
| Schauspielerin am Thalia-Theater von 1875 bis 1884 |
Ohlsdorfer Friedhof, Althamburgischer Gedächtnisfriedhof:
Grabplatte "Thalia"
"Mein erster Schritt oder Sprung auf die Bretter geschah in der Rolle eines kleinen Grenadiers in dem Ballett ‚Der Geburtstag'. Es ‚schwebt'‚ mir noch lebhaft vor, wie Se. Excellenz der Herr General-Indentant von Hülsen in wirklich höchsteigener Person uns achtundzwanzig kleinen ‚Ratten' wie, zu meinem größten Bedauern, der technische Ausdruck lautet, mit eiserner Strenge den Grenadiermarsch einstudirte. Man denke!
Achtundzwanzig Rat- das Wort will nicht über die Feder, sagen wir Rangen, das klingt weicher. Wieviel Geduld braucht man nicht oft schon im Verkehr mit einer einzigen solchen Naturerscheinung, und nun gar 28!
Indeß, Herr von Hülsen hat diese, wie seitdem gewiß noch manche andere Geduldprobe glücklich überstanden, - und auch ich bin mit heiler Haut davon gekommen, trotzdem mein linkes Nebenmädchen mir jedes Mal beim Präsentiren des Gewehres mit
|
demselben einen Schlag auf die Schulter versetzte, so daß mir das Exercitium nachgerade höchst ungemütlich wurde. Zum Glück wurde sie von der angestrebten Carriere sehr bald wieder aufgegeben, so daß weiteres Unglück verhütet wurde; ich aber marschirte und hüpfte lustig weiter, bis ich eines Tages den kühnen Sprung vom Tanzboden auf den Boden des Schauspiels executirte."¹
Mit viel Humor erzählt Clara Horn hier von den Anfängen ihrer Theaterlaufbahn. Der Besuch einer Kindervorstellung mit Tanz brachte alles ins Rollen. Seitdem wollte die Neunjährige unbedingt tanzen lernen. Die Eltern, bürgerliche Leute, Inhaber einer Mobilienhandlung in der Friedrichstraße in Berlin, gaben dem Drängen der Tochter nach und ließen sie auf der Königlichen Ballettschule ausbilden. Bereits nach einem Jahr wurde die kleine Clara ins Kinderballett aufgenommen. Doch dann lockte das Schauspiel. Clara Horn erhielt Unterricht bei der Schauspielerin Minona Frieb-Blumauer und hatte 1873 ihren ersten Auftritt im Königlichen Schauspielhaus. Da der Anfängerin hier jedoch nur kleine Rollen angeboten wurden, ging sie für ein Jahr nach Danzig, um ein wenig Routine zu bekommen. Danach verschaffte die Empfehlung ihrer Lehrerin ihr zunächst ein Gastspiel, dann ein Engagement am Thalia-Theater in Hamburg. Die folgende kleine Anekdote zeigt, wie sehr Clara Horn damals noch der Übung und Erfahrung bedurfte: Als sie sich kurz vor ihrem Gastspiel mit Fieber ins Bett legte, schickte man den Arzt Dr. Engel-Reimers zu ihr. Ein Blick genügte: "Sie haben wirklich Fieber, mein Fräulein, aber es ist nur ein unschuldiges Lampenfieber, für das freilich kein Kräutlein gewachsen ist. Sie müssen sich einfach tüchtig zusammennehmen."¹
Clara Horn folgte seinem Rat und bestand mit ihrer kleinen Rolle vor Publikum und Kritikern. Ihren ersten echten Erfolg hatte sie als Fifi in dem Lustspiel "Die Augen der Liebe" von Wilhelmine von Hillern, der Tochter der damals überall gespielten Charlotte Birch-Pfeiffer. Über Nacht war der Name Clara Horn bzw. Fifi, wie ihre Kolleginnen und Kollegen sie fortan nannten, in Hamburg in aller Munde. Schnell avancierte sie zum Publikumsliebling schlechthin.
Einer ihrer Verehrer, Harbert Harberts, schrieb in einem biographischen Abriss, mit dem er der flüchtigen Kunst der Schauspielerin ein Denkmal setzen wollte: "Wenn auf der Bühne der Frohsinn sein rosenrotes Scepter schwang, dann concentrirte sich zumeist unser Interesse auf eine Gestalt und sie war der Magnet, dem die Herzen zuflogen. Der Magnet hieß Clara Horn. Jedes Wort, das in so gewinnender Schalkhaftigkeit, in so köstlichem Mutwillen von ihren Lippen perlte; die reizende Natürlichkeit, mit der sie jede Bewegung, jede Geste ihres Spiels ausführte, nahm uns gefangen und sicherte Stürme des Beifalls, die sie allabendlich zu ernten pflegte. Sie war im besten und schönsten Sinne des Wortes unser Liebling."¹ Aber nicht nur das Publikum, auch die Kritiker waren bezaubert von der jungen Schauspielerin. Ein Journal rühmte: "Man darf kühnlich behaupten, daß Clara Horn in ihrem Genre unerreicht dasteht. Ihr Lachen und Weinen ist unübertrefflich und von bezaubernder Wahrheit, ihr eigenthümlich trockener und doch so liebenswürdiger Humor übt eine magische Wirkung auf die Zuschauer aus; Alles an ihren Leistungen athmet Anmuth und Heiterkeit, nirgendwo lässt sich eine Absichtlichkeit, ein Haschen nach gewöhnlichem Theatereffekt entdecken, mit einem Worte: Clara Horn ist eine echte Künstlerin, die mit Recht die reichen Ovationen verdient, welche ihr von allen Seiten dargebracht werden, ein echtes Kind der heiteren Muse Thalia, deren Schwestern die Wiege des Pathchens mit herrlichen Gaben überschütteten"¹
Als Clara Horn sich ins ernste Fach vorwagte, scheiterte sie. Ihre Domäne war der Backfisch, der ins Weibliche übersetzte dumme Junge, der damals in zahlreichen Lustspielen und Possen vorkam, und sie war nach einigen missglückten Versuchen klug genug, ihre Grenzen nicht mehr zu überschreiten.
Das Jahr 1882 war für Clara Horn in doppelter Hinsicht ein ganz besonderes. In diesem Jahr begegnete sie den zwei Männern, die wenig gemein, aber für sie und ihr Leben ein große Bedeutung hatten: dem Kaiser und ihrem künftigen Bräutigam.
Kaiser Wilhelm II. hatte Clara Horn schon als kleines Kind verehrt. Sein Bild, das der Bruder des Kaisers der kleinen Ballettrange geschenkt hatte, hing gerahmt in ihrem Zimmer. Zum Kaisergeburtstag beschloss die Zwölfjährige zusammen mit ihrer älteren Schwester Julie, ihn bei seiner Spazierfahrt durch den Tiergarten zu erwarten und ihm ein Blumenbouquet in die Kutsche zu werfen. Da der Kaiser an diesem Tag jedoch einen neuen Weg für seine Ausfahrt gewählt hatte, warteten die beiden Mädchen vergeblich, und es blieb ihnen nichts anderes übrig, als das Bouquet durch einen Dienstmann in Schloss schicken zu lassen. Am nächsten Tag erschien der Kaiser persönlich im Theater, bedankte sich bei Clara und bat scherzend um ein neues Bouquet. Fortan schickte Clara Horn dem Kaiser zu jedem Geburtstag Blumen und illuminierte ihre Fenster. Nun, im Sommer 1882, sollte sie ihm bei einem Gastspiel in Bad Ems erneut begegnen. Er zeigte sich entzückt von ihrem Spiel und ließ ihr ein kostbares Armband überbringen. Als man sich am nächsten Tag auf der Promenade traf, plauderte man angeregt.
Dem zweiten bedeuteten Mann ihres Lebens begegnete sie auf der Insel Norderney. Hier traf Clara Horn, die äußerst beliebt war und in Kreisen verkehrte, die sonst über ihresgleichen die Nase rümpften, den begüterten Guts- und Mühlenbesitzer Josef Daubeck aus der Umgebung von Brünlitz in Böhmen. Die beiden verliebten sich ineinander, zu Ostern 1884 fand die offizielle Verlobung statt, im Mai, bei Saisonende, wollte Clara Horn ihren Abschied von der Bühne nehmen und im Monat darauf ihren Bräutigam heiraten. Doch es kam anders.
Am 13. Mai 1884 brach Clara Horn nach Schluss der Vorstellung zusammen. Die offizielle Diagnose: Gelenkrheumatismus. Die ganze Stadt nahm rührenden Anteil an dem Schicksal der jungen Schauspielerin. Täglich brachten die Zeitungen Meldungen über ihr Befinden, die Menschen strömten in ihr Haus am Pferdemarkt (heute Gerhart-Hauptmann-Platz), um sich selbst nach ihrem Zustand zu erkundigen. Als sie sieben Wochen nach diesem Zusammenbruch starb, blieb die offizielle Version eines Gelenkleidens bestehen. Dass die wahre Todesursache wohl im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes stand, zeigt ein Eintrag in das Ohlsdorfer Grabregister, wo der Tod eines Sohnes der Schauspielerin Clara Horn am 17. Juni 1884 nach nur einer Stunde Lebenszeit vermerkt ist.
Nach einer Trauerfeier, die einer Fürstin zur Ehre gereicht hätte, wurde Clara Horn auf dem Jakobi-Friedhof beigesetzt. Josef Daubeck ließ einen großen Grabstein mit einem Bronzerelief anfertigen, das einen Engel mit umgedrehter Fackel zeigt. Er ist heute noch an der alten Stelle zu finden, obwohl der Friedhof längst aufgelassen ist - im öffentlich zugänglichen Jakobipark. In seinem Haus umgab sich Josef Daubeck mit allen verfügbaren Bildern von seiner Braut, die er in Lebensgröße hatte ausführen lassen.
Text: Brita Reimers
Quellen:
¹ Harbert Harberts: Clara Horn. Ein Charakterbild ihres Lebens und Wirkens. Mit einer Sammlung Porträts nach Original-Photographien.
In: Hamburger Familiengeschichten.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Mirjam Horwitz, verheiratete Ziegel-Horwitz |
| 15.6.1882 Berlin - 26.9.1967 Lütjensee |
| Schauspielerin, Regisseurin und Prinzipalin der Hamburger Kammerspiele am Besenbinderhof |
| Ohlsdorfer Friedhof, Grab Nr. P 7, 13
"Mein ganzes Leben war Theater" konstatierte Mirjam Horwitz rückblickend, wobei für sie und ihren Mann Erich Ziegel Theater nicht die abgesicherte Existenz der pensionsberechtigten Staatsschauspielerin oder des pensionsberechtigten Staatsschauspielers bedeutete, sondern ein Leben in bedingungslosem Einsatz für die Sache: "Und wenn ich uns nun rückblickend betrachte, so muß ich feststellen: nie lag uns etwas an der Sicherheit. Immer aber daran, so zu leben, wie es für uns richtig war. Die letzten 30 Jahre waren ja immer und immer wieder ein mutiges Einsetzen für eine Sache und nie für die Bequemlichkeit des Alters."¹
|
Begonnen hatte für Mirjam Horwitz alles in Berlin als Schauspielschülerin von Max Reinhardt, der einen nie erlöschenden Einfluss auf ihr Werden und Wirken hatte. Er war es auch, der das junge Mädchen eines Tages mit ins Café"Monopol" am Bahnhof Friedrichstraße nahm und sie damit in die Berliner Boheme einführte, in der sie bald so heimisch werden sollte, dass sie sich aktiv an deren Leben beteiligte: "Da ich ja etwas singen gelernt hatte, zog mich auch das Kabarett sehr an. Zunächst waren es ja richtige Bohemeniederlassungen. Wenn man gerade die nicht großen Auslagen ersetzt bekam, genügte es einem vollkommen. Fast an allen Tischen hatte man Bekannte sitzen, es war reizend. Man sprang auf das Podium und sang sich und den Zuschauern eins. Nicht etwa geschminkt oder köstlich gekleidet, i Gott bewahre. … Maler, die sangen, Bildhauer, die rezitierten, waren keine Seltenheit - damals. Auch verirrte sich hie und da ein richtiger Dichter zu uns. Der kletterte dann auf das Nudelbrett, zog ein Packen zerknitterter Papiere aus der Tasche. Ein Bündel Gedichte sozusagen. Und las einige davon vor. Rückblickend ist immer wieder etwas Besonderes für die damalige Zeit bezeichnend: Es gab keine wie immer geartete, na sagen wir: Unanständigkeiten. Es war alles heiter-harmlos, und auch die Politik hatte wenig Raum.
Wolzigen mit etwas müder Locke, in Biedermeier, rezitierte. Die Gattin Elsa Laura sang Volkslieder zur Laute, und man sollte es nicht für möglich halten: der verruchte, damals wirklich schöne Mann, Hans-Heinz Ewers, trat auf, auch im Biedermeier-Frack. Und sprach seine Verse. Die Dichter: Otto Julius Bierbaum, Wolzogen, Rideamus, Brennert, sie alle tauchten auf und wieder unter. In einer Ecke saß eine merkwürdige junge Frau. Ganz verspielt, mit irgendwelchen kleinen Dingen beschäftigt, Perlen, Steinchen, Muscheln, bunte geschliffene Glasstückchen. Damit unterhielt sie sich und baute sich dort wohl ihre bunte Welt. Else Lasker-Schüler.
Die Frau eines damals berühmten Hautarztes und die Schwägerin des Schachweltmeisters! - Natürlich sprach man auch über ihre Dichtungen. Und dann. Peter Hille, Der Zarteste der Zarten. Der wirklich ganz in sich versponnen war und sich um Geld und wie diese unangenehmen Dinge sonst noch heißen mögen nicht kümmerte. So konnte es geschehen, daß er tot auf einer Bank auf einer Vorortstation gefunden wurde! Der ewige Wanderer - der nur die menschliche Seele suchte, und sie wohl nie fand! -"¹
Mirjam Horwitz musste diese bunte Welt verlassen, als sie ein erstes Engagement in Lüneburg erhielt. Aber auch hier ging das heitere, verrückte Leben weiter. Ihr Eindruck der sechs Lüneburger Monate: "Jugend! Das bedeutete Begeisterung, Überschwang, Arbeitslust, aber auch Ausgelassenheit, Übermut, Lausbübereien! Oh was haben wir für Unfug getrieben, wie haben wir die Stadt auf den Kopf gestellt und die Bürger erschreckt, nach altem Muster: épatez le bourgeois!"¹ Ein Engagement am Schillertheater in Berlin, wo sie auch ihren späteren Mann, Erich Ziegel, kennen lernte, schloss sich an. Als der ebenfalls am Schillertheater verpflichteten Liesl Gussmann wegen ihres angegriffenen Gesundheitszustandes Schonung verordnet wurde, kündigten die beiden kurzerhand ihre Verträge und fuhren nach Bukow in die Mark Brandenburg. Erich Ziegel und der Freund Liesl Gussmanns mieteten sich in der Nähe ein. "Oh - wie konnten wir lachen - singen - fröhlich - ja sogar sehr verrückt sein."¹ Liesl Gussmann war es auch, die Mirjam Horwitz nach Wien einlud, wo sie wieder in Künstlerkreisen landete. Sie lernte die Schriftsteller Egon Friedell, Alfred Polgar, Peter Altenberg, Karl Kraus, Hugo von Hofmannsthal, Richard Beer-Hofmann und Hermann Bahr kennen. Am meisten aber beeindruckte sie die Begegnung mit Arthur Schnitzler: "Wie bereichert fuhr ich damals von Wien heim. Meine Augen blickten anders in die Welt, meine Ohren vernahmen neue Töne. Ich hatte durch ihn die Stille entdeckt. … Das Wort aus seinem köstlichen Einakter ,Der Puppenspieler' geht mir oft durch den Sinn, wenn ich meine Mitstreiter in dem Lebenskampf betrachte: ?Wir spielen Alle, wer es weiß, ist klug!'" ¹
Als Erich Ziegler für vier Monate das Breslauer Sommertheater übernahm, weil er dort selbst Regie führen und moderne Autoren aufführen konnte, ging Mirjam Horwitz mit. Die Rolle der Nora neben Albert Bassermann zählt sie zu ihren größten Erlebnissen: "Das war wohl die merkwürdigste Probenzeit. Ich ging - ich lief - ich sang - ich sprach - ich wurde Nora. Es waren ja nur wenige Proben mit IHM. Was aber Erich Ziegel da mit mir als Regisseur erarbeitet hat - es ist unvorstellbar." In Breslau übernahm sie auch ihre erste Charakterrolle: die ältliche und häßliche Berta Launhardt: "Die Presse hob mich - etwas überschwenglich - in den Himmel. Gerade weil ich eben so jung und so niedlich war. Es wurde als Opfer gepriesen. Diese Rolle hat mich ein Leben lang begleitet, zuletzt 1950 mit 52 Jahren in Wien. Leider mußte ich keine Maske mehr machen."¹
In den Wintern übernahm Mirjam Horwitz Verpflichtungen in Berlin oder ging auf Tourneen nach Belgien, Holland und Luxemburg. Wenn sie zurückkam, waren "Hund, Gatte, Eltern zufrieden, stellten nur ein wenig klagend fest, daß ich nie genug bekommen konnte. Was damals auch, ich gestehe es ein, der Fall war."¹
1913 ging Erich Ziegel an die Münchner Kammerspiele. Als sich aus dem ursprünglich geplanten Gastspiel die Möglichkeit der Übernahme der Theaterleitung entwickelte, zögerte seine Frau, die in Berlin unter Oskar Meßter Filme drehte, nur kurz. Dann entschied sie sich trotz der Warnung Meßters, dass sie eine große Filmkarriere verspiele, für ihren Mann, ein Entschluss, den sie niemals bereute; vielleicht weil es dem Ehepaar Ziegelzeitlebens gelang, sich gegenseitig zu fördern, sich an dem Erfolg des anderen zu freuen und sich nicht als Konkurrenten zu betrachten. Ein Beispiel für diese Haltung sind Mirjam Horwitz' Worte über Zieglers Eröffnungsvorstellung - Strindbergs "Kameraden" - an den Münchner Kammerspielen: "Es war ein triumphaler Erfolg für ihn. Wir waren obenauf. Ich natürlich nur durch ihn und mit ihm; darüber war ich mir ganz klar. Aber schon als Anfängerin hatte er mir immer Mut gemacht. Dieser feste Glauben an mein Können gab mir Kraft, so daß ich mich an schwierige Aufgaben getraute."¹ Und Erich Ziegel dankte rückblickend öffentlich seiner Frau, "deren unerschütterlicher Glaube an meine Sendung, deren leidenschaftliche, nie erlahmende Kraft mir immer wieder über Perioden der Schwäche und Verzagtheit hinweggeholfen haben."
In der Nähe von München mietete das Ehepaar ein Haus: "Mein erster Garten. Mir Städterin erschloß sich das Glück, das Werden beobachten zu können." Als es jedoch Differenzen um die Gagen gab, der Aufsichtsrat sich weigerte, die bei Kriegsausbruch freiwillig reduzierten Gagen wieder in vollem Umfang zu zahlen, als die Einnahmen es längst erlaubten, kündigten Mirjam Horwitz und Erich Ziegel kurzerhand ihre Verträge auf und gingen im Jahre 1916 nach Hamburg; sie mit einem Vertrag für das Schauspielhaus, er mit einem für das Thalia-Theater, wo er auch als Regisseur arbeiten sollte. Da das Thalia Theater zu jener Zeit mit seinen langjährigen Mitgliedern wie dem Ehepaar Bozenhard und dem Ehepaar Leudesdorff eine so eingespielte Truppe war, dass sich im Grunde nichts entwickeln konnte, wechselte Erich Ziegel nach wenigen Monaten ans Schauspielhaus zu Max Grube. Aber auch hier traf er auf ein festgefügtes Ensemble. Alle Versuche, etwas Neues anzuregen, schlugen fehl, so dass in dem Ehepaar Ziegel-Horwitz die Idee reifte, eine neue Bühne in der Art der Münchner Kammerspiele zu gründen. In der Silvesternacht 1917/18 fassen sie auf dem Heimweg von Freunden auf der Lombardsbrücke den Entschluss, das Unternehmen gegen alle widrigen Umstände wie Krieg und die ungünstige Lage des einzigen in Frage kommenden Theaters, des früheren Tivoli-Theaters am Besenbinderhof, zu wagen. Kurz vor der Eröffnung des Hamburger Kammerspiele veröffentlichte Erich Ziegel den folgenden Text, in dem er seine Beweggründe und Ziele offenlegt: "Die Gründung einer modernen Bühne in dieser Zeit wird nur gerechtfertigt durch das reine Bestreben, gegen Trostlosigkeit und Zerstörung die erweckenden Stimmen neuer Glaubwürdigkeit und Lebensbejahung zu führen. Tiefste Notwendigkeit muß solche Gründung jedem Einsichtsvollen erscheinen, der weiß, nirgends sei Deutschlands Zukunftsberechtigung fester verankert als in dem Geist der heranwachsenden Generation.
Der neuen Kunst, den Baumeistern der Zukunft muß Stätte und Gehör bereitet werden. Das sittliche Verantwortungsgefühl, die brennende Tatbereitschaft, von denen die Besten unserer Zeit befeuert sind, müssen auf die Allgemeinheit überströmen.
Nur eine Bühne, die ohne jedes Zugeständnis an Seichtheit und fades Unterhaltungsbedürfnis in jedem Augenblick ihrer hohen Mission eingedenk bleibt, kann solche Kulturarbeit leisten. Die Hamburger Kammerspiele wollen nach Maßgabe moderner Inszenierungsmöglichkeit der neuen Kunst den adäquaten Ausdruck schaffen. Dekorationen, die sich auf einfache Eindringlichkeit beschränken, eine Regie, die bei leidenschaftlicher Betonung des Wesentlichen das Seelische farbiger entfaltet, eine Darstellungskunst, die nach restloser Gestaltung drängt, kurz, der Versuch, das Geistige rein auszulösen, sollen das Gepräge der Aufführungen bestimmen. In kritischer Sonderung wird der Bühne vor allem jene jugendliche Schauspielkunst dienstbar gemacht werden, die wirklich Instrument ist und Gefäß der Zeit."²
Am 30. August 1918 wurden die Hamburger Kammerspiele mit einer Frank-Wedekind-Woche zum Gedächtnis des am 9.März 1918 verstorbenen Dichters eröffnet: "Keine offizielle Stelle nahm damals von uns Notiz. Nur mein Mann stand da oben, sprach diesen geistreichen, funkelnden Prolog von Arthur Sakheim und unsere Herzen zersprangen beinahe vor Glück, Aufregung, Hoffen und Bangen. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich mehr gelohnt, als wir es je zu hoffen wagten"³, erinnert sich Mirjam Horwitz in einem Brief an den Theaterkritiker Paul Theodor Hoffmann.³ Trotz ständiger Schwierigkeiten und Kämpfe waren die Hamburger Kammerspiele bald eine der lebendigsten und theater- wie geistesgeschichtlich bedeutendsten Bühnen der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Erich Ziegel trieb sich und seine Kollegen an,
nicht einseitig zu werden: Ältere Dramatiker von Ibsen bis Strindberg, von Hauptmann bis Wedekind standen ebenso auf dem Spielplan wie die junge Generation von August Stramm bis Georg Kaiser, von Franz Werfel bis Ernst Barlach. Aber bei aller Bestimmung, sich dem Neuen zu öffnen, wurden auch die Klassiker nicht vernachlässigt.
Man wagte Experimente wie die Aufsehen erregende Aufführung von Schillers "Räubern" in modernem Gewand, die den Geist des Werkes lebendig werden ließ, und spielte Shakespeare. Obwohl die Kammerspiele nur geringe Gagen zahlen konnten, kamen die besten Ensembles und Künstler zu Gast: Elisabeth Bergner, Maria Orska, Rosa Valetti mit ihrem Berliner Kabarett "Die Rampe", Käthe Dorsch, Asta Nielsen, Heinrich George, Tilly Wedekind, Lucie Höflich, Paul Wegener, Ernst Deutsch, Otto Wallburg, Eugen Kloepfer, Max Adalbert, Maria Eis, das Moskauer Künstlertheater und viele andere spielten hier. Gustaf Gründgens war fünf Jahre lang Mitglied des Ensembles und trat unter Mirjam Horwitz zum ersten Mal als Hamlet auf. Neben ihm und ihrem Mann die Rolle der Candida in dem gleichnamigen Stück von Shaw zu spielen, empfand Mirjam Horwitz als ein besonderes Glück: "Diese große Liebeserklärung des Spötters Shaw an die Frau!"¹ "Du bist meine Candida"¹, schrieb Erich Ziegel an seine Frau, als sie als Jüdin aus dem öffentlichen Leben verbannt war. Dieses Wissen gab ihr die Kraft, die Verunglimpfungen zu ertragen.
Als Paul Eger das Deutsche Schauspielhaus verließ, das er seit 1918 geleitet hatte, schlug er Erich Ziegel als seinen Nachfolger vor. Der nahm an, und von 1926 bis 1928 leitete Mirjam Horwitz, die auf keinen Fall mit ans Schauspielhaus wechseln wollte, "das geliebte Kleinkind Kammerspiele"¹. Sie hatte bereits im Jahr zuvor Regie geführt. Durch den Wechsel Ziegels ans Schauspielhaus waren die beiden plötzlich Konkurrenten geworden, doch auch das konnte ihre Loyalität zueinander nicht untergraben." Wir sprachen nie über unsere künstlerischen und geschäftlichen Dinge. Und nur der unnatürliche Zustand trat ein, daß wir uns wechselweise über unsere Erfolge freuten."¹ 1928 mussten die Kammerspiele ihre Pforten schließen, das Haus musste dem Neubau des Gewerkschaftshauses weichen. Es wurde abgerissen. Kurz darauf wurde Erich Ziegel gekündigt. Bei aller Begabung war ihm eine repräsentative Bühne wie das Schauspielhaus wesensfremd geblieben. Mit Hermann Röbbeling, der schon das Thalia-Theater leitete, suchte man sich einen Nachfolger, der ein erfahrender Theaterpraktiker war.
Das Paar sah sich nach einer neuen Spielstätte um und eröffnete am 1. September 1928 die Kammerspiele im Lustspielhaus im ehemaligen Kleinen Lustspielhaus in den Großen Bleichen. 1932 übernahm Erich Ziegel das Thalia-Theater, benannte es in Kammerspiele im Thalia-Theater um und führte es in der Tradition seiner Kammerspiele fort. 1934 musste er die Leitung wegen seiner Ehe mit einer Jüdin abgeben. Das Ehepaar verließ freiwillig-unfreiwillig die Stadt, deren kulturelles Leben es 16 Jahre lang entscheidend geprägt hatte und die ihm zur Heimat geworden war. In einem Abschiedsbrief resümierte Erich Ziegel die Hamburger Zeit: "Als ich am 26. August 1916 - ich weiß das Datum noch, weil es mein Geburtstag war - in Hamburg eintraf, ahnte ich nicht, daß diese damals so wunderschöne Stadt meine, unsere eigentliche Heimat werden sollte. Wir kannten sie nur von flüchtigen Aufenthalten auf der Durchreise nach Helgoland oder Sylt.
Zwei Jahre später - fast auf den gleichen Tag - eröffneten wir die Hamburger Kammerspiele am Besenbinderhof mit einer Frank-Wedekind-Woche zum Gedächtnis des einige Monate vorher verstorbenen Dichters. Der Rahmen war ein bißchen schäbig und ein bißchen romantisch, aber die Vorstellungen durchbrachen bei der geistigen Elite den Bann des Mißtrauens.
Und dann - dann folgten die schönsten, die glücklichsten und, wie ich zu hoffen wage, fruchtbarsten Jahre meines, unseres Lebens und Schaffens.
Bis nach sechzehn Jahren die schwerste, traurigste Zeit kam, die Stunde, in der ich, von Ekel vor der braunen Pest geschüttelt, Hamburg verließ, um nicht wiederzukehren."²
Erich Ziegel fand zunächst bei Gründgens in Berlin ein Unterkommen. 1935 emigrierten Mirjam Horwitz und Erich Ziegel nach Wien. Da Erich Ziegel in Wien keine ausreichenden Arbeitsmöglichkeiten fand, kehrte er 1936 mit Genehmigung der Reichskulturkammer nach Berlin zurück, einige Zeit später durfte dank Gründgens' Intervention auch Mirjam Horwitz nach Berlin kommen, allerdings ohne wieder auftreten zu dürfen. Ab Mitte der 40er Jahre hielt sich das Ehepaar erneut in Wien auf, wo Erich Ziegel Schauspieler und Direktor der Kammerspiele und des Theaters "Die Insel" wurde und wo auch Mirjam Horwitz bis 1951 auf der Bühne stand.
Im Herbst 1949 kamen die beiden erstmals nach Hamburg zurück und gastierten im Thalia-Theater in Gerhart Hauptmanns "Biberpelz". Es kam auch noch zu einigen anderen Aufträgen, aber eigentlich gab es in der Hamburger Kulturlandschaft keinen adäquaten Ort mehr für das Ehepaar Ziegel-Horwitz. Doch ungebrochen in seinen Ideen und seiner Arbeitslust machte Erich Ziegel noch bis kurz vor seinem Tod Pläne, ein neues Theater zu eröffnen. Seine Frau konnte ihn nur mit Mühe davon abhalten. Als Erich Ziegel am 30. November 1950 in München starb, siedelte Mirjam Horwitz nach Hamburg über. Sie sah nur noch eine Aufgabe vor sich: "die Bücher meines Mannes so schön und seiner würdig herauszugeben, wie ich es vermag."³ 1967 starb sie in einem Altenheim in Lütjensee bei Hamburg.
Text: Brita Reimers
Quellen:
¹ Mirjam Horwitz: Plaudereien, Unvollständiges und unveröffentlichtes Rundfunkmanuskript von 1953, Hamburger Theatersammlung, Universität Hamburg.
²Zitiert nach: Paul Möhring: Von Ackermann bis Ziegel, Theater in Hamburg, Hamburg 1970.
³Brief an Paul Theodor Hoffmann vom 29. Januar 1951. Unveröffentlicht, Hamburger Theatersammlung, Universität Hamburg.
|
|
 |
 |
 |
| Elisabeth Hudtwalcker, geb. Moller |
 |

Bild: Hamburger Kunsthalle. Gemälde von Jean Laurent Mosnier |
| 6.7.1752 Hamburg - 22.11.1804 Hamburg |
| Künstlerin und Ehefrau |
| Ohlsdorfer Friedhof, Grab: W 21, 64-84
"Sie war - es ehre sie diese Träne, die auf diese Blätter fällt, und da uns nun Ihr Leben nicht länger lehrt, so lehr uns denn ihr Tod. Das was ich von ihr entworfen, ist mit zitternder Hand gezeichnet. Möge es mit der Sanftheit dargestellt sein, die dem Urbild entspricht. Es soll keine außerordentliche Frau schildern, aber eine, deren Leben lehren kann, zu welch einem hohen Grad an Tugend und Freude es schon hier erhoben werden könne. Stolz, daß sie mein war, mögen diese Blätter bezeugen, daß ich sie zu würdigen gewußt, und wie ich sie geliebt habe, bezeuge sie", schrieb der Hamburger Kaufmann und spätere Senator Johann Michael Hudtwalcker in seiner Biographie ¹ über seine Frau Elisabeth, die er zärtlich Betchen nannte.
Elisabeth wurde dem Hamburger Bürger Vincent Moller und seiner Ehefrau Hedwig geb. Thuun als jüngstes von drei Kindern geboren. Die Familie lebte auf dem Höxter. Zwei Jahre nach Elisabeths Geburt starb ihr Vater im Alter von 31 Jahren an Schwindsucht.
|
Hedwig Moller, eine "treffliche und für ihr Zeitalter sehr gebildete Frau", erzog ihre Kinder allein. Elisabeth erhielt Musik- und Malunterricht. In Sprachen wurde sie allerdings nicht unterrichtet. Diese erlernte sie nur, indem sie während des Französisch- und Lateinunterrichtes ihres Bruders in einer Ecke des Unterrichtszimmers saß und strickte.
Elisabeth Moller hatte, wie Johann Michael schreibt, "Genie" und war "in jeder Rücksicht gebildet". Sie war mit seinen Schwestern bekannt, und auf diese Weise lernten sich die beiden kennen. "Sie war - vielleicht nur mir - schön", sinniert Johann Michael Hudtwalcker. Er verliebte sich in Elisabeth und bewies dabei Phantasie. Er ließ einen fingierten Brief in die Zeitung setzen, in dem er ein junges Mädchen Anspielungen machen ließ, die nur Elisabeth Moller verstehen konnte. Elisabeth wusste, was Johann Michael damit ausdrücken wollte - und der Hochzeit stand nichts mehr im Wege.
Johann Michael Hudtwalckers Eltern nahmen Elisabeth freundlich auf, stammte sie doch aus standesgemäßem Hause. Sie waren allerdings ein wenig besorgt wegen Elisabeths Schwächlichkeit, denn Elisabeth litt schon seit Jahren an schweren Zahnschmerzen. Nachdem ein Arzt jedoch einen "günstigen" Untersuchungsbericht abgegeben hatte, konnte die Hochzeit gefeiert werden. Die 22jährige Elisabeth Moller und der 27jährige Johann Michael Hudtwalcker heirateten am 21. Juni 1775 und wohnten im elterlichen Haus in der Katharinenstraße 83.
Verheiratet und noch nicht Mutter, durfte Elisabeth sich in ihren Mußestunden weiter der Malerei widmen. Sie kopierte Gemälde in Kreide und lernte nach der Natur zu zeichnen. Auf Landpartien und Gesellschaften hatte sie immer ein Skizzenbuch dabei. Ihre liebste Tätigkeit aber war das Portraitieren. Eine Sammlung von Portraits der Familie Hudtwalcker, mit weißer Kreide auf blauem Grund gezeichnet, schenkte sie ihrem Schwager, der in Livorno seinen Geschäften nachging. Aber zufrieden mit ihren Zeichenkünsten war sie nie.
Ein Jahr nach der Hochzeit wurde Elisabeth schwanger. "Nun aber verging ihr der Muth, oder vielmehr sie erhielt Muth zu einem höheren Berufe. Sie fühlte sich davon wie begeistert. Mutter war sie mehr als Künstlerin. Sie gab den Lohn, den man in Erz ihr grübe, für eines Kindes Lächeln hin", so Johann Michael Hudtwalcker über seine verstorbene Frau. Sie selbst bestätigte das. Für sie hatte "die Erfüllung der Mutterpflicht einen höheren Lohn als der Glanz, mit dem sich glänzenden Taten begnügen müssen"¹. Elisabeth Hudtwalcker las Rousseau und Basedow, um sich auf die Kindererziehung vorzubereiten. Am 4. August 1776 wurde ihre erste Tochter, Hedwig Sara Elisabeth, geboren. Ihr zweites Kind, Amalia Thusnelda, kam nach Johann Michael Hudtwalckers Aussage elf Monate später zur Welt. Nach einer später erstellten Stammtafel soll die zweite Tochter jedoch erst 1 ½ Jahre später, am 6. März 1778, geboren worden sein.
Es bedeutete für Elisabeth einen großen Verlust, als ihre zweite Tochter im zarten Alter von zehn Monaten, am 18. Januar 1779, an den Folgen des Zahnens starb. Nach der Geburt des ersten Sohnes, Jakob Hinrich, am 30. Mai 1779 entschlossen sich Elisabeth und Johann Hudtwalcker, ihre Kinder gegen Blattern impfen zu lassen. Doch die Impfung verursachte bei der Tochter Hedwig erhebliche Nebenwirkungen, sie bekam eine Augenkrankheit, die jahrelang andauern sollte. Elisabeth kümmerte sich aufopfernd um die Tochter - wie sie dies bei jedem ihrer Kinder tat. Zwei Jahre nach Jakob Hinrichs Geburt wurde am 28. Mai 1781 ihr Sohn Hermann, im Jahr darauf, am 27. November 1782, Carl geboren. Nun hatte Elisabeth einen großen Haushalt mit vier Kindern zu führen. Sehr sparsam, ordnungsliebend und mit bescheidener Furchtsamkeit ging sie an ihre Aufgaben heran. Aber bald hatte sie den Haushalt so weit organisiert, dass sie "nur" noch das Personal zu beaufsichtigen brauchte. Nun regte sich der alte Wunsch zu malen. Elisabeth nutzte jede Gelegenheit. Doch auch wenn sie ihren Haushalt im Griff hatte, verlangte er ihr soviel Arbeit ab, dass es ihr oft nur durch frühes Aufstehen möglich war, ihrer Malerei nachzugehen. Da sie, um nicht ihre Mutter- und Hausfrauenpflichten zu vernachlässigen, immer mit Unterbrechungen beim Malen rechnen musste, malte Elisabeth kaum noch mit Ölfarben. Sie erhielt Unterricht bei einer Madame Marthes im Malen mit Wasserfarben. Eines ihrer vollendetsten Werke ist eine Zeichnung ihrer sechs Kinder. Aber immer wieder kollidierte ihr Maltätigkeit mit ihrer Arbeit als Hausfrau und Mutter. Ständig befand sie sich in dieser Konfliktsituation. Und so, schreibt ihr Mann, "fing [sie[ bald an einzusehen, dass ihre Lage und höheren Pflichten ihr nicht erlaubten, ihrer Neigung zu folgen. Das Leben einer Frau in Hamburg, die Mutter und Hausmutter ist, und sich von der Gesellschaft, worin zu leben sie auch Beruf hat, weder trennen kann noch darf, kontrahiert zu sehr mit dem eigentlichen Künstlerleben, … daß sie die Staffelei - nicht wegwarf, sondern mit Resignation bei Seite setzte, bis auf ruhigere Zeiten, die ihr aber nicht geworden sind."¹ Ihre häuslichen Pflichten erlaubten es ihr lediglich, zu zeichnen, z.B. mit schwarzer Kreide auf weißem Papier. Zumeist portraitierte sie ihre Freunde, vorzugsweise die Frauen, da sie weibliche Gesichter zu zeichnen schwieriger fand.
Zu den vier Kindern kamen noch weitere vier auf die Welt: Thusnelda, geb. am 7. August 1784, Ernst, geb. am 1. Februar 1786, Caroline, geb. am 18. Juli 1787. Sie wurde nur achtzehn Tage alt und starb am 4. August 1787. Am 14. Juli 1789 brachte Elisabeth im Alter von 37 Jahren ihr letztes Kind zur Welt - eine Tochter, genannt Ernestine. Sie lebte allerdings nur zehn Monate und starb am 6. Mai 1790 - wie schon die zweite Tochter - am Zahnen.
Krankheiten und Schicksalsschläge begleiteten Elisabeth auch weiterhin. Schon bald nach der Ernennung ihres Mannes zum Senator im Jahre 1788 erkrankte Elisabeth am Inflammationsfieber. Als Genesungsurlaub unternahmen Elisabeth und Johann Michael mit ihren ältesten Kindern eine Reise durch Holstein. Doch bald nach der Reise erkrankten die Kinder an Masern.
Eine weitere Reise unternahmen sie, um sich über den schmerzlichen Verlust des letzten Kindes ein wenig hinwegzutrösten. Die Reise ging über Leipzig, Dresden und Freyberg nach Berlin. Die Familie kehrte nach sechs Wochen über Braunschweig und Wolfenbüttel nach Hamburg zurück. Auf der Reise hatten die Hudtwalckers Freunde besucht und Künstler wie Schadow, Zingg, Oeser, Graff und Chodowiecki kennen gelernt, von denen Elisabeth Aufmunterung für Ihre Arbeit erhielt. In jeder Stadt besichtigte Elisabeth die Kunstgalerien. Bis zur völligen Erschöpfung studierte sie in den Bildergalerien Dresdens und Berlins Gemälde, die ihre Erwartungen weit übertrafen. Und doch notierte Elisabeth in ihrem Reisetagebuch: "Was ist Kunst gegen Natur! Erstere geht sogleich nach viel mühsamer Arbeit ihrem Ruin entgegen, die letztere, nur wenig gepflegt, macht sich Tag zu Tag herrlicher, gewährt Gesundheit und Freude mehr und fröhlicher Genuß und nähert uns unserem Schöpfer."¹
Auf der Reise machte Elisabeth ihre schwache Konstitution zunehmend zu schaffen. Sie hatte ihre körperlichen Grenzen sehr schnell erreicht, die Folge waren häufige Ohnmachten. Dennoch wurde für Elisabeth die Fahrt zu einem großen Glück. Ihre größte Freude bestand darin, Menschen zu finden, mit denen sie harmonisierte und Freundschaften aufbauen konnte, und auf dieser Reise hatte sie viele Freunde gefunden.
Elisabeth erkrankte zum dritten Mal am Inflammationsfieber und starb nach siebentätiger Krankheit im Kreise ihrer Familie am 22. November 1804. Die Genesung ihrer ältesten Tochter von deren Augenkrankheit erlebte sie kurz vor ihrem Tode noch mit. Elisabeth Hudtwalckers Portrait, gemalt von Jean Laurent Mosnier, hängt heute in der Hamburger Kunsthalle. An ihrem Grab steht eine Säule mit flacher, kegelförmiger Deckplatte; eine Seite der Säule mit ovalen Schriftplatten, die andere mit vertieften Namensschriften. Unter der Deckplatte steht:
"Formen werden und verwehen
Leben muß Verwesung sehen
und der Strahl zum Urquell gehen."
Text: Anke Schultz
Quellen:
1 Staatsarchiv Hamburg: Fa. Beneke. Zitiert nach: Anne-Charlott Trepp:
"Denn da ist gerade meine Wonne …, daß du mich wie ein kluges,
denkendes Wesen behandelst": Frauen und Männer im Hamburger
Bürgertum zwischen 1770 und 1840 - Fragestellungen und Ergebnisse.
In: Hamburger Arbeitskreis für Regionalgeschichte. Mitteilungen 29.
November 1996.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Katharina Jacob |
| 6.3.1907 - 23.8.1989 |
| Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus. Mitglied der Widerstandsgruppe Bästlein-Jacob-Abshagen. Kaufmännische Angestellte, Lehrerin |
Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bo 73, 71
1992 wurde in Groß Borstel der Katharina-Jacob-Weg nach ihr benannt.
Arbeiterkind. Hätte gern die höhere Schule besucht; die Familie besaß dazu aber nicht die finanziellen Mittel. Katharina Jacob wurde Kontoristin und engagierte sich in der Jugendgruppe der Gewerkschaft der Angestellten (GDA). Wegen politisch linksgerichteter Tendenzen wurde die Jugendgruppe jedoch bald verboten.
|
Katharina Jacob gründete daraufhin mit anderen Jugendlichen die Jugendgruppe "Florian Geyer". 1926 Eintritt in den Kommunistischen Jugendverband Deutschlands und - ab 1927 in Hamburg - 1928 Eintritt in die KPD. Ab 1933 im illegalen Widerstand. 1933, 1939 und 1944/1945 in "Schutzhaft" genommen. Am 20. Dezember 1934 verurteilt zu einem Jahr Gefängnis wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Bis 20. Dezember 1935 in der Haftanstalt Lübeck-Lauerhof, zusammen u. a. mit Lucie Suhling.
1940 begegnete sie ihrem späteren zweiten Ehemann, dem ehemaligen KPD-Bürgerschaftsabgeordneten Franz Jacob, wieder, den sie schon vor 1933 kennen gelernt hatte. Heirat im Dezember 1941. Mit ihm und anderen Genossen führte sie die illegale KPD weiter. In über dreißig Betrieben und Werften entstanden illegale Gruppen, um den Kampf gegen das Nazi-Regime zu führen. Katharina Jacobs Arbeit bestand u. a. darin, Treffs zu vereinbaren, Geld zu sammeln und Geldspenden an die Organisation zu überbringen, mit denen ausländische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene unterstützt wurden.
Nach zwei Jahren illegaler Widerstandstätigkeit wurde Franz Jacob steckbrieflich gesucht. Er tauchte unter und setzte den Widerstand in Berlin fort. Franz Jacob wurde entdeckt und am 4. Juli 1944 verhaftet. Zwei Tage später erfolgte die Verhaftung seiner Frau. Die beiden wurden in der Prozessserie gegen die Berliner KPD vor den Volksgerichtshof gestellt. Franz Jacob wurde am 18. September 1944 hingerichtet. Katharina Jacob wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen, dennoch von der Gestapo als "Schutzhäftling" ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gebracht, wo sie bis zur Befreiung vom Hitlerfaschismus inhaftiert war.
1947 besuchte Katharina Jacob einen Sonderlehrgang bei Anna Siemsen, um Lehrerin zu werden. Ab 1948 unterrichtete sie 25 Jahre lang an der Schule Winterhuder Weg in Hamburg. Außerdem war sie in der Friedensarbeit aktiv, war Vorsitzende des Kuratoriums Ehrenhain Hamburger Widerstandskämpfer, im Landesvorstand der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), Mitglied der DKP und Seniorenvertreterin in der Lehrergewerkschaft GEW.
Text: Rita Bake
|
|
 |
 |
 |
| Anna Jencquel (Anna Elisabeth Jencquel) |
 |
 |
| 31.12.1836 Hamburg - 17.12.1924 Hamburg |
| Ordensträgerin für Verdienste während des Krieges 1870/71 |
| Ohlsdorfer Friedhof, Grab Nr. S 23, 63-72 (Grabstelle Percy Schramm)
Anna Jencquel entstammte dem Großbürgertum und blieb unverheiratet. Was die Auswahl von geeigneten Heiratskandidaten betraf, muss sie sowohl sehr wählerisch als auch sehr voreingenommen gewesen sein, denn Offiziere, Adlige, Schausteller und Juden (!) kamen für Sie nicht in Frage. Sie konnte es sich allerdings auch leisten, wählerisch zu sein, denn es bestand für Anna Jencquel keine Notwendigkeit, eine Versorgungsehe einzugehen.
Sie verfügte über ein beträchtliches väterliches Vermögen, das ihr erlaubte, keiner Erwerbsarbeit nachzugehen. Anna Jencquel hatte viel Zeit. Die verbrachte sie oft auf Reisen. Sie fuhr nach Griechenland und Ägypten, las Heine, rauchte leidenschaftlich gern russische Zigaretten, spielte regelmäßig mit einem Oberkellner, der zu ihr ins Haus kam, auf dem Esszimmertisch Billard - und zeigte niemals Gefühlchen.
|
Stets bewahrte sie Haltung. Ihr zugedachte Zärtlichkeiten, Freundlichkeit und Geschenke wies sie zurück, weil sie befürchtete, in solchen Momenten aus der Rolle zu fallen. Selbst "Tante" wollte sie nicht genannt werden. Diese Bezeichnung erschien ihr zu gefühlsbetont. Stattdessen ließ sie sich "Anna" nennen und wurde so für die Großneffen und - nichten zur Großanna.
Nach dem Tod der Mutter wohnte sie lange Jahre in einer Etagenwohnung am Harvesterhuder Weg, später dann mit zwei Dienstmädchen in einer Acht-Zimmerwohnung in der Alten Rabenstraße. Als sie 69 Jahre alt war, kaufte sie sich ein Haus am Leinpfad mit noch mehr Zimmern und schaffte sich einen Hund an, den sie "Struppi" nannte und den sie verhätschelte und abgöttisch liebte - also doch Gefühle.
Anna Jencquel bezog ihr ungebrochenes Selbstbewusstsein aus ihrem ausgeprägten Standesdünkel: Die Jencquels gehörten nun einmal schon seit ewigen Zeiten zur Hamburger Oberschicht. Und so gab sie stets, egal wo sie war, ihre Meinung gut hörbar kund. Das war ihren Angehörigen oft peinlich, Percy Ernst Schramm schreibt über seine "Großanna": "Aus diesem Selbstgefühl: ‚Ich, Fräulein Jencquel' leitete sie nicht nur das Recht ab, im Familienkreise ihre Urteile zu fällen, sondern sie fühlte sich berechtigt, auch Dritten gegenüber ihre Auffassungen vernehmlich zu machen. Wer sie begleitete, mußte gewärtigen, daß sie das Auftauchen einer parfümierten Dame - ihr ein besonderes Greuel - mit so lauten Bemerkungen begleitete, daß diese es hören mußte. Einladungen zu einer Reise oder zu einem Essen waren auch kein reiner Genuß, da die ‚Großanna' dann das Gefühl der alleinstehenden vermögenden Dame bekam, daß alle Männer das auszunutzen suchten - weshalb sie die Rechnungen mit der Sorgfalt eines Finanzbeamten nachprüfte."¹
Anna Jencquel hatte ganz ihrem Charakter entsprechend weder mit der Kirche noch mit der Armenfürsorge viel im Sinn. Ihr Motor war ein patriotisches Pflichtgefühl, welches sie dazu trieb, während des Krieges 1870/71 den Verwundeten zu helfen. Diese Form des Pflichtgefühls war damals genauso wie das der Nächstenliebe gesellschaftlich opportun. Anna Jencquel half dem "Roten Kreuz" hauptsächlich beim Verpacken des Verbandsstoffes und erhielt für dieses Engagement später ein Kreuz, eine Denkmünze und zum 100. Geburtstag Kaiser Wilhelms eine Gedächtnismedaille.
Als sie mit 87 Jahren starb, bezeugte eine Mullbinde um ihr Handgelenk, dass der Arzt ihrem letzten Wunsch, ihr bei Eintritt des Todes die Pulsadern aufzuschneiden, nachgekommen war. Sie hatte große Furcht, als Scheintote begraben zu werden.
Text: Rita Bake
Quellen:
¹ Percy Ernst Schramm: Gewinn und Verlust. Die Geschichte der Hamburger Senatorenfamilien Jenquel und Luis (16. bis 19.Jahrhundert). Hamburg 1969.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Emily Jenisch |
| 12.12.1839 Hamburg- 24.4.1899 Hamburg |
| Stifterin der Anscharhöhe an der Tarpenbekstraße |
Ohlsdorfer Friedhof, Grab Nr. AH 17, 1-8; AH 17, 1a-8a
Emily Jenisch war die die Nichte von Martin Johann Jenisch, nach dem die Jenischstraße benannt wurde.
Nachdem 1875 ihr Vater Gottlieb Jenisch (Bruder von Martin Johann Jenisch) und 1882 ihre Mutter Caroline Jenisch geb. Freiin von Lützow, Witwe des Grafen von Westphalen-Fürstenberg gestorben waren, bewohnte die älteste der drei Töchter, die ledige Emilie Jenisch das große Haus am Neuen Jungfernstieg, in dem heute der Überseeclub residiert. Sie lebte dort aber nur im Winter. Im Sommer bevorzugte sie das elterliche "Weiße Haus" an der Elbchaussee.
|
Nach ihrem Tod kaufte der Hamburger Kaufmann Gustav Amsinck das Gebäude am Neuen Jungfernstieg, das nach seinem Tod im Jahre 1909 in den Besitz seiner Witwe kam, die das Haus aber nicht bewohnte.
Emilie Jenisch, die krank, verwachsen und taub war, widmete sich ganz der Wohltätigkeit und war in ihrer Zeit eine der wohltätigsten Damen der Hansestadt. 1883 gründete sie das Emilienstift, das zunächst in einer Wohnung in der Eppendorfer Landstraße untergebracht war. Das Stift bot sittlich gefährdeten - aber noch nicht "gefallenen" - konfirmierten, vierzehn bis 21-jährigen Mädchen Unterstützung durch die Ausbildung zur Dienstbotin. 1886 gründete Emilie Jenisch den Stiftskomplex Sankt Anscharhöhe an der Tarpenbekstraße in Hamburg Eppendorf (Stiftung Anscharhöhe), in den das Emilienstift einzog und der heute als Altenheim genutzt wird. Einige alte Stiftsgebäude sind noch erhalten, so z. B. das Haus Emmaus (heute Altenheim), das ehemalige Waschhaus, das Haus Bethanien und die "Kirche zum Guten Hirten".
Text: Rita Bake
|
|
 |
 |
 |
| Juliane Louise Prinzessin von Ostfriesland |
 |
 |
| 16.11.1657 Aurich - in der Nacht zum 30.10.1715 Hamburg |
| Prinzessin von Ostfriesland |
Ohlsdorfer Friedhof, Grab:Bi 56, 577 am Teich
Die älteste Tochter des Fürsten Enno Ludwig zu Ostfriesland, Stedesdorf und Wittmund lebte in einer vor der Öffentlichkeit geheim gehaltenen Ehe mit dem neun Jahre jüngeren Hamburger Pastor Joachim Morgenweck.
Die Prinzessin von Ostfriesland war zwei Jahre alt, als ihr Vater am 4. April 1660 bei einem Sturz vom Pferd tödlich verunglückte. In seinem Testament hatte er seine Frau, die Generalstaaten und Herzog Rudolph August von Braunschweig -Lüneburg zu Vormündern seiner Kinder bestellt.
|
Die Regierungsnachfolge übernahm Enno Ludwigs Bruder Georg Christian. Er war es auch, der seiner Schwägerin befahl, mit ihren zwei Töchtern das Schloss in Aurich zu verlassen und sich auf die einsam gelegene Burg Berum zurückzuziehen.
Als Julianes Mutter 1677 starb, blieben die Waisen noch ein Jahr lang auf Burg Berum und zogen dann zu ihrem Onkel und Vormund Herzog Rudolph August zu Wolfenbüttel. Die wirtschaftliche Situation der Prinzessinnen war desolat, so bekam z. B. Juliane von Georg Christian die ihr rechtmäßig zustehende Apanage nicht in voller Höhe ausgezahlt. Jahrzehntelange Erbstreitigkeiten, die sich selbst über den Tod des Onkels hinaus erstreckten, waren die Folge. Sie sollen auch ein Grund dafür gewesen sein, dass Julianes Hochzeit mit dem Sohn des Herzogs Heinrich von Sachsen-Weißenfels scheiterte.
1686 zogen die beiden Prinzessinnen auf das Plöner Schloss von Herzog Johann Adolf von Holstein. Durch einen rechtlichen Vergleich gelang es, Julianes finanzielle Zukunft zu sichern.
Als Julianes Schwester 1695 in Schlesien den Herzog Christian Ulrich von Württemberg-Oels zu Behrenstadt heiratete, entschloss sich die nun 38jährige Juliane, nach Ottensen, in die Nähe Hamburgs zu ziehen, wo sie bereits einige Jahre zuvor ein Landhaus als Sommersitz gekauft hatte. Dort lebte sie sehr zurückgezogen mit ihrem Hoffräulein Elisabeth von Broberlein und ihrem Patenkind Juliane Luise Jensen, einer holsteinischen Pastorentochter.
Und dort begann auch die Liebesgeschichte zwischen Juliane und dem an der kleinen Kirche des Waisenhauses beschäftigte Pastor Morgenweck. Er wurde Julianes Beichtvater, nachdem 1699 ihr alter Beichtvater gestorben war. Juliane und Pastor Morgenweck verliebten sich ineinander und heirateten heimlich. Niemand erfuhr etwas davon, bis Pastor Morgenwecks Vorgesetztem die enge Verbindung der beiden auffiel und er seinen Untergebenen zur Rede stellte. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit gestand Pastor Morgenweck die Heirat.
Fast fünfzehn Jahre lebte das Paar in heimlicher Ehe. Dann starb Juliane, vermutlich an der Pest. Zwei Wochen zuvor war bereits ihr Hoffräulein an dieser Krankheit gestorben. Auf ihrem Sterbelager hatte Juliane der Maria-Magdalenen-Kirche 3.000 Mark vermacht und bestimmt, dass die Zinserträge zur Aufrechterhaltung ihrer Grabstätte verwendet werden sollten, die sie schon Jahre zuvor für die gleiche Summe im Grabgewölbe unter dem Kirchenaltar für sich und ihr Hoffräulein gekauft hatte. Außerdem hatte Juliane ihrem Mann die lebenslange Nutzung ihres Hauses in Ottensen vermacht. Nach ihrem Tod hätte nun alles nach Julianes Willen geschehen können. Da sie aber schon zu schwach gewesen war, um ihr Testament zu unterschreiben, fochten erbberechtigte Familienangehörige wie z.B. ihre Nichte und der Hof in Aurich es an. Auch äußerten sei Zweifel an Julianes heimlicher Ehe. Fünfzehn Monate dauerten die Erbstreitigkeiten, was die Zahlung der 3.000 Mark verzögerte und dazu führte, dass die Kirche sich weigerte, das Grabgewölbe freizugeben. Solange stand der vergoldete Kupfersarg der Prinzessin in der Diele ihres Hauses am Jungfernstieg, welches sie 1704 zusätzlich zu ihrem Haus in Ottensen erworben hatte. Ende März 1717 konnte endlich die Beisetzung erfolgen.
Neun Monate nach Julianes Tod heiratete Pastor Morgenweck Julianes Haushälterin Juliane Luise Jensen.
Da Prinzessin Juliane bestimmt hatte, dass die Gruft nicht geöffnet werden dürfe "solange der Wind wehet und der Hahn krähet", verfügte der letzte Pastor der Maria-Magdalenen-Kirche, Barthold Nicolaus Krohn, in der Grabkammer neben Julianes beigesetzt zu werden und beide Gewölbe mit einem Gitter zu umschließen. Damit wollte er noch nach seinem Tod das Versprechen der Kirche auf Unversehrtheit der Grabkammer gewährleisten.
Aber schon 1807 wurde die Kirche abgerissen, der Sarg der Prinzessin
und mit ihm der des Pastors Krohn auf den Maria-Magdalenen-Friedhof vor dem Dammtor überführt. 120 Jahre später wurden die sterblichen Reste der drei Toten mit den Grabmalen nach Ohlsdorf umgebettet.
Text: Rita Bake
Quellen:
Vgl.: Helmut Schoenfeld: …solange der Wind wehet und der Hahn krähet". Juliane Louise von Ostfriesland. In: Ostfriesland Magazin 3, 1994.
|
|
 |
 |
 |

Photo: Staatsarchiv Hamburg. |
 |
Magda Langhans, geb. Kelm |
| 16.7.1903 Hamburg - 17.1.1987 Hamburg |
| Politikerin, Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime, Mitglied (KPD) der Hamburgischen Bürgerschaft |
Ohlsdorfer Friedhof, Geschwister-Scholl-Stiftung, Grab-Nr.: BN 73, 388
1934 äußerte sich ein Staatsanwalt über Magda Langhans: "Vor uns steht eine große Frau. Sie ist zwar sehr klein, aber dennoch groß." Magda Langhans' Stärke und Größe lag in ihrem politischen Engagement.
Magda Langhans wuchs mit sechs Geschwistern im Hamburger Arbeiterviertel Hammerbrook auf. Ihr Vater war Kutscher, ihre Mutter Putzfrau. Der Vater starb an TBC, als die Kinder noch klein waren. Schon bald nach seinem Tod heiratete die Mutter einen Hafenarbeiter. Magda Langhans besuchte die Volksschule bis zur Selekta und arbeitete danach drei Jahre als Hausangestellte.
|
Später lernte sie in einer Druckerei den Beruf der Anlegerin. Diese Arbeit übte sie mit längeren Unterbrechungen bis zu ihrer Pensio-nierung aus.
Magda Langhans politische Laufbahn begann als 18jährige bei den freien Gewerkschaften. Durch einen Freund motiviert, trat sie 1927, im Alter von 24 Jahren, der KPD bei. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann, den Dekorationsmaler Hein Langhans, kennen. Die Ehe blieb kinderlos.
1929/30 besuchte Magda Langhans die Parteischule der KPD in Moskau. 1931 wurde sie in die Bezirksleitung der KPD Wasserkante gewählt. Dort arbeitete sie im Bereich "Agitation und Propaganda". Von 1931 bis 1933 war Magda Langhans für die KPD Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft.
Nachdem die NSDAP die Macht übernommen hatte, half Magda Langhans den illegalen Betriebs- und Stadtteilgruppen bei der Herausgabe von Kleinzeitungen und Flugblättern. Außerdem führte sie mit KPD-Funktionären Schulungen in Hamburg und Kopenhagen durch, um anderen Menschen das argumentative Rüstzeug für den politischen Kampf unter dem Hitler-Regime zu vermitteln. Im Mai 1934 wurde sie verhaftet und zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Sie war die erste Frau in Deutschland, gegen die die Nazis einen politischen Prozeß angestrengten. "Vorbereitung zum Hochverrat" lautete die Anklage. Magda Langhans wurde im Gefängnis Lübeck-Lauerhof, wie andere politische Gefangene auch, auf der Station II eingesperrt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als im Februar 1946 die Ernannte Bürgerschaft ihre Tätigkeit aufnahm, wurde Magda Langhans Bürgerschaftsabgeordnete der KPD. Als erste Frau übte sie das Amt der Zweiten Vizepräsidentin des Präsidiums der Hamburgischen Bürgerschaft aus. Die "Welt" vom 15.1. 1949 schrieb über Magda Langhans: "Wegen ihrer geschliffenen Formulierungen und der überzeugenden Art, sie vorzubringen, fiel sie schon vor 1933 im Hamburger Parlament auf. Sie hat heute das Schriftführeramt inne, nachdem sie 1946 auf dem Sessel des Vizepräsidenten gesessen hat."
Während ihrer Amtszeit als Abgeordnete setzte sich Magda Langhans z.B. 1946 dafür ein, daß auch junge Frauen von der Sonderzuteilung für Bohnenkaffee und Süßigkeiten profitieren durften. Magda Langhans verlangte eine gleiche Behandlung der 18-25jährigen Frauen, weil diese in Betrieben und Haushalt nicht weniger Arbeit leisteten als Männer. Wie die Atmosphäre gegenüber Frauen im Parlament war, zeigt die Erwiderung auf Magda Langhans' Forderung. "Besonders gern" stimmte der männliche Redner der SPD dem Antrag von Magda Langhans zu. Es handele sich schließlich um einen Teil der Bevölkerung, der sich gerade bei den Männern einer besonderen Beliebtheit erfreue.
Als 1946 eine Debatte um die hohe Säuglingssterblichkeit und die gestiegene Anzahl von Fehlgeburten geführt wurde, warf Magda Langhans in diesem Zusammenhang die Frage auf, wie viele dieser "totgeborenen Kinder" wohl in Wirklichkeit abgetrieben waren und das oft mit "Hilfe" von Kurpfuschern. Sie forderte eine Lockerung des Pharagraphen 218 und 219 - letzterer bestrafte das öffentliche Anpreisen von Verhütungsmitteln - und verlangte, daß die Verwaltungen empfängnisverhütende Mittel zur Verfügung stellten.
Ein weiteres heikles Thema, welches wohl lieber verschwiegen worden wäre, brachte Magda Langhans im Parlament zur Sprache: Viele junge Mädchen waren in der Nazizeit als "schwererziehbar" in das Heim Farmsen eingeliefert, dort als "unterwertig" eingestuft und zwangssterilisiert worden. Anlaß ihrer Einweisung war bei vielen von ihnen die Weigerung gewesen, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten. Magda Langhans forderte eine Überprüfung dieser Fälle und gegebenenfalls Entschädigung. Der KPD-Antrag wurde ohne Diskussion abgelehnt.
Magda Langhans war bis 1953 Abgeordnete in der Hamburgischen Bürgerschaft. Die einzige Kommunistin der Hamburgischen Bürgerschaft setzte sich intensiv für die Frauen ein. Ihre im Parteistil vorgetragenen Äußerungen für Frieden, Freiheit und Demokratie und ihre antifaschistischen Kampfansagen wurden, trotz aller Anerkennung ihrer persönlichen Leistungen, mit Eskalation des Kalten Krieges im Parlament zunehmend reserviert zur Kenntnis genommen.
Magda Langhans beschäftigte sich aber nicht nur im Palament mit sogenannten Frauenfragen, sie arbeitete nach dem Krieg auch in überparteilichen antifaschisti-schen Frauenausschüssen mit. So war sie von 1946 bis 1952 erste Vorsitzen-de des Frauen-Ausschusses Hamburg e.V und wurde 1948 Beisitzerin im Vor-stand des Hamburger Frauenrings.
Außerdem war sie von 1946 bis zum Verbot der Partei im Jahre 1956 Frauensek-retärin der KPD. Auch ihr Mann arbeitete im Parteibüro der KPD. Als Magda Langhans im Alter von 83 Jahren starb, war sie bereits verwitwet. Sie wohnte zuletzt am Lämmersieth 75 im Stadtteil Barmbek-Nord.
Text: Rita Bake
Quellen:
Vgl. auch: Die erste vor dem Tribunal. In: Die Welt vom 15.1.1949.
|
|
 |
 |
 |
| Caroline Lebrun, geb. Steiger |
 |

Bild: Staatsarchiv Hamburg. |
| 28.4.1800 Hamburg - 23.1.1886 1) Hamburg |
| Schauspielerin am Hamburger Stadttheater von 1803 bis 1851 |
Ohlsdorfer Friedhof, Althamburgischer Gedächtnisfriedhof:
Grabplatte "Stadttheater"
Caroline Lebrun war die Tochter des Regisseurs und Schauspielers Anton Steiger, der bei seinem frühen Tod am 13. April 1809 sieben unversorgte Kinder zurückließ. Da war es ein Glück, dass es damals üblich war, dass Schauspielerkinder schon in früher Jugend auf der Bühne standen. Caroline Lebrun war bereits als Dreijährige, am 24. Juni 1803, in der Rolle der Infantin Clara Eugenia in Schillers "Don Carlos" im Hamburger Stadttheater aufgetreten und fortan dessen Mitglied geblieben. Zunächst spielte sie neben ihren Schwestern Johanna und Antonia und den Töchtern der berühmten Tragödin Sophie Schröder in Komödien, die der Regisseur Friedrich Ludwig Schmidt eigens für die Kinder geschrieben hatte.
|
Sie wuchs dann in das Fach der ersten Liebhaberin, das sie dank ihres jugendlichen Aussehens bis in die vierziger Jahre hinein überzeugend ausfüllte. Danach wechselte sie in das Fach der Anstands- und Charakterrollen. Stets erfreute sie sich dabei der außerordentlichen Gunst des Publikums.
1822 hatte die Zweiundzwanzigjährige den Schauspieler und Theaterschriftsteller Carl August Lebrun, der 1818 ans Hamburger Stadttheater geholt worden war, geheiratete. Im Jahre 1827 übernahm er zusammen mit Friedrich Ludwig Schmidt die Direktion im Neubau am Dammtor. Doch so begabt er als Schauspieler war, so wenig war er geeignet, dem Niedergang des Stadttheaters, das sich aus ökonomischen Gründen dem zunehmend am Vergnügen orientierten Publikumsgeschmack beugte, Einhalt zu gebieten. Sein Alkoholkonsum trug vermutlich mit dazu bei, dass die Achtung von Publikum und Kollegen immer weiter sank. Eine Szene, die sich in ähnlicher Form wiederholte, gibt darüber Auskunft: Als Lebrun in der Rolle des Wallen in "Stille Wasser sind tief" zu sagen hatte: "Bis alles geordnet ist, gehe ich, und trinke ein Gläschen", ertönte eine Stimme aus dem Parkett: "Nicht doch, Sie haben schon genug"² Zunehmend kam es bei Vorstellungen zu turbulenten Auftritten, bei denen das Publikum die Direktion auf die Bühne rief und Rechenschaft über die Leitung des Theaters auf offener Szene verlangte. 1837 war der Zustand nicht länger tragbar, Lebrun musste abtreten, wurde aber bereits im Jahr darauf als Schauspieler zurückgerufen, weil man auf sein Talent nicht verzichten konnte. Erst vor diesem Hintergrund wird die Beschreibung des ersten Bühnenauftritts Caroline Lebruns mit ihren beiden älteren Töchtern, Louise (1822) und Antonie (1823) im Jahre 1839 recht verständlich: "am 5ten Januar machten Dem. Louise und Antoinette Lebrün als Nina und Emmy in dem Lustspiel der Frau von Weissenthurn: ‚Welche ist die Braut?? ihren ersten theatralische Versuch, aber an diesem Abend betrat auch deren Mutter, eine allgemein verehrte Künstlerin, die Bretter wieder, von denen ein beklagenswerther Unfall sie wochenlang entfernt gehalten. Mit lautem Jubel wurde die Gefeierte von dem zahlreich versammelten Publikum begrüsst, die von diesen unverkennbaren Zeichen der Liebe und Achtung tief ergriffen ward. Nachdem während der Vorstellung fast jede Scene der Mad. Lebrün mit lautem Applaus begrüsst worden, ward sie am Schlusse einstimmig gerufen und erschien in der Mitte ihrer beiden liebenswürdigen Töchter. Mit wehmuthsvollen Worten sprach sie ihren Dank aus und empfahl ihre Töchter der ferneren Nachsicht des Publikums. Mad. Lebrün ist noch jetzt eine schöne Frau und ein sehr beliebtes Mitglied des Stadttheaters. Möge sie der Kunst und dem Publikum noch recht lange erhalten bleiben, dies ist gewiss der aufrichtige Wunsch ihrer zahlreichen Verehrer."³
Während zwei der Töchter, Louise und die jüngste, Julinka, sich nach der Heirat vom Theater zurückzogen, stand Caroline Lebrun bis 1851, neun Jahre nach dem Tode ihres Mannes, auf der Bühne. Abgesehen von einigen Gastspielreisen in jüngeren Jahres zusammen mit ihrem Mann nach Bremen, Riga, Berlin und Wien, hatte sie stets am Hamburger Stadttheater und seit 1849 noch kurze Zeit am Thalia-Theater gewirkt, das mit dem Stadttheater vereinigt worden war. Die Fusion der einst führenden Bühne Deutschlands mit dem Thalia-Theater gibt Auskunft über den Zustand des Stadttheaters in jenen Jahren. Daran konnten weder Schröders Zögline Friedrich Ludwig Schmidt und Heinrich Schäfer noch Caroline Lebrun, die als Kind Schröder noch erlebt hatte, etwas ändern.
Wenn auf der Grabplatte "Stadttheater" nicht Caroline Lebrun, sondern der Name Johanna Marianne Lebrun steht, so handelt es sich ganz offenbar um einen Irrtum. Johanna Steiger war die Schwester Carolines, mit der sie als Kind zusammen auf der Bühne gestanden hatte. Geburtsdatum, Ehename und Ehemann aber verweisen darauf, dass hier die sehr viel bekanntere Caroline Lebrun geehrt werden sollte.
Text: Brita Reimers
Quellen:
¹ In der Literatur werden auch der 11.1. und 22.1.1886 als Sterbedaten angegeben.
² Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 18. Berlin 1969.
³ Ludwig Wollrabe's Chronologie sämmtlicher Hamburger Bühnen nebst Angabe der meisten Schauspieler, Sänger, Tänzer und Musiker;
welche seit 1230 bis 1846 an denselben engagiert gewesen und gastiert haben. Hamburg. o.J.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Elise Lensing |
| 14.10.1804 Lenzen - 18.11.1854 Hamburg |
| Langjährige Geliebte und Förderin des Dichters Friedrich Hebbel |
Ohlsdorfer Friedhof, Grab Nr. J 10, 241
Elise-Lensing-Weg,Barmbek-Nord, seit 1948, benannt nach Maria Dorothea Elisabeth Lensing
Ende März 1835 lernte die damals 31-Jährige den 22-jährigen Friedrich Hebbel kennen. Hebbel war von der in Hamburg lebenden Schriftstellerin Amalie Schoppe aus der Enge seiner Heimatstadt Wesselburen in Nord-Dithmarschen nach Hamburg geholt und vor dem Steintor bei Elise Lensing, ihrer Mutter und Elises Stiefvater Ziese untergebracht worden. Elise war die Tochter des Chirurgen Johann Friedrich Arnold Lensing und seiner Ehefrau Karoline Maria. Elise verlebte unglückliche Kindertage: der Vater, alkoholkrank, cholerisch, prügelte seine Kinder. Nachdem ihn seine Frau hatte entmündigen lassen, heiratete diese einen Schiffer. Aber auch er behandelte Elise schlecht.
|
Elise war es nicht gewohnt, dass man ihr etwas Gutes tat, und so konnte sie sich auch nicht darüber freuen -vielleicht misstraute sie auch Männern, da sie diese bisher nur als gewalttätig kennen gelernt hatte - , als ein Hauptmann, dem ihr schüchternes Wesen gefiel, sich entschloss, sie ausbilden zu lassen und nach Magdeburg ins Pensionat des Pädagogen J. C. A. Heyse zu geben.
Mit neunzehn Jahren kehrte sie als junge Pädagogin nach Hamburg zurück, lebte wieder bei ihren Eltern und verdiente ihren Lebensunterhalt mit Privatstunden, Nähkursen und als Gesellschafterin. Eine kleine Erbschaft von ihrem leiblichen Vater gab ihr eine gewisse finanzielle Freiheit.
Als Hebbel auftauchte, entwickelte sich schnell ein Liebesverhältnis zwischen den beiden. Nach sechs Wochen zog Hebbel in ein Nachbarhaus, vermutlich, um den Klatsch zur Ruhe zu bringen. Beide liebten jedoch nicht gleich intensiv. Elise liebte Hebbel stets mehr.
Hebbel blieb nur ein Jahr in Hamburg. Im März 1836 zog er nach Heidelberg, um dort Jura zu studieren. Als er feststellte, dass er dazu keine Berufung hatte, ging er im September desselben Jahres nach München, weil er sich dort mehr Möglichkeiten für seine schriftstellerische Tätigkeit erhoffte. Elise unterstützte nicht nur ihn aus ihren geringen finanziellen Mitteln, sondern auch seine Mutter - ohne einen anderen Lohn zu fordern als einen nicht gar zu unfreundlichen Brief.
Nur wenn Hebbel sich einsam und unglücklich in einer fremden Umgebung fühlte, liebte er Elise, schrieb sehnsuchtsvolle Briefe an sie. Sobald er aber wieder festen Boden unter den Füßen hatte, verblasste seine Zuneigung. Aus München kam z. B. eine drastische Klarstellung seinerseits an Elise: Freundschaft sei es, was ihn mit Elise verbinde, alles andere sei ein Irrtum gewesen. Wenig später dann ein völlig anders ausgerichteter Brief an Elise, in dem er ihr seine Liebe gestand.
Elise ertrug diese Stimmungsschwankungen mit unendlicher Geduld. Immer wieder bedankte sich Hebbel für ihre Festigkeit und Teilnahme. Als er im März 1839 vollkommen mittellos war, kehrte er nach Hamburg und zu Elise zurück. Bald wurde Elise schwanger. Hebbels Tagebuch aus dieser Zeit ist voller Liebe, Zärtlichkeit und Anerkennung für Elise. Aber auch Selbstanklagen und Reue fehlen nicht, denn das Verhältnis war nicht wirklich harmonisch. Wie im Finanziellen war Elise auch im Emotionalen die Gebende und Ausgleichende. Am 5. November 1840 wurde der gemeinsame Sohn Max geboren, geheiratet wurde nicht. Hebbel hatte bereits in seinem Brief vom 19. Dezember 1836 aus München ausführlich auseinandergesetzt, dass und warum eine Ehe für ihn undenkbar sei: "Ich kann alles, nur das nicht, was ich muß. Das liegt zum Teil in meiner Natur, zum Teil in der Natur des Künstlers überhaupt. Wenn ein Genie sich verheiratet, so geschieht immer ein Wunder, so gut, als wenn ein anderer sich nicht verheiratet. Nimm es als den höchsten Beweis meiner Achtung auf, daß ich Dir diese dunkelste Seite meines Ichs entschleiere; es ist zugleich unheimlich und gefährlich, wenn ein Mensch zum Fundament seines Wesens hinuntersteigt und er tut gar wohl, wenn er niemals daran rüttelt, denn drunten lauern die Finsternis und der Wahnsinn." 1)
Als Elises Ersparnisse aufgebraucht waren und die spärlichen Einnahmen kein Auskommen mehr ermöglichten, reiste Hebbel im November 1842 nach Kopenhagen, um seinem Leben eine Wendung zu geben. Er erbat vom dänischen König eine Professur für Ästhetik an der Universität Kiel. Die Professur erhielt er nicht, aber ein Reisestipendium für zwei Jahre. Das Ziel hieß Paris, wo Hebbel nach einem Zwischenstopp in Hamburg im September 1843 eintraf. Und hier begann wieder, was schon auf der ersten Reise deutlich geworden war: Einsam in einem Land, das ihm fremd war, sehnte er sich nach Elise.
Als Elise ihm den Tod des Sohnes Max meldete, der am 2. Oktober 1843 nach einem Sturz auf den Kopf an einer Gehirnentzündung verstorben war, und zugleich ihre erneute Schwangerschaft, das sie durch Fußbäder abzubrechen versucht hatte, war Hebbel außer sich vor Kummer und Sorge und wollte sofort heiraten. Aber schnell stellten sich Zweifel ein. Als Elise die Koffer schon gepackt hatte, kam die Anweisung: Bleibe, wo Du bist, hier verhungern wir beide!
Hebbel führte immer wieder die finanzielle Lage an, die eine Heirat unmöglich machte. Er sprach davon, eine Geschwister-Ehe mit Elise zu führen. Eine Trennung im wahren Sinne des Wortes könne nie stattfinden. Auch das zweite Kind solle selbstverständlich auf seinen Namen getauft werden, aber heiraten …
Als Elise ihre alles erduldende Haltung aufgab, Vorschläge machte, wie eine Heirat auch bei der finanziellen Misere möglich sei, und ihr wahres Verhältnis zu Hebbel nicht länger verleugnete, indem sie sich dem dänischen König als Hebbels Verlobte vorstellte, antwortete er: "Warum mußtest Dü Hundert Mal in ähnlichen Fällen warst Du nur meine Cousine" (Brief vom 16.12.1844).
Am Ende des Jahres 1844, dem Jahr, in dem der zweite Sohn Ernst am 14. Mai geboren wurde, gab Hebbel sich selbst wie an jedem Jahresende Rechenschaft: "Kann ich, muß ich heiraten? Kann ich, muß ich einen Schritt tun, der mich auf jeden Fall unglücklich und dich! Nicht glücklich machen wird? (…) Elise ist das beste Weib der Erde, das edelste Herz, die reinste Seele, aber sie liebt, was sie nicht wiederlieben kann, die Liebe will besitzen, und wer nicht liebt, kann sich nicht hingeben, sondern sich höchstens opfern!" (Tagebuch 31.12.1844). Später verstieg er sich dazu, Liebe als "die höchste Spitze des Egoismus" (Brief vom 6.12.1845) zu interpretieren - ein Selbstschutz vermutlich! Als er nach Wien ging, wurden die Worte noch schroffer, ja drohend: " (…) das mußt Du doch fühlen, daß die Verhältnisse von ehemals jetzt unmöglich sind und daß mein Leben entweder einen höheren Schwung oder - ein Ende nehmen muß. So steht die Sache, täusche Dich nicht" (Brief vom 6.12.1845).
Sein Leben nahm "einen höheren Schwung": In Wien wurde ihm Anerkennung zuteil, und hier verliebte er sich 1846 in die Burgschauspielerin Christine Enghaus. Elise verlor jetzt die Geduld, sie hatte seine Reisen und Liebschaften lang genug ertragen. Bitter beklagte sich Hebbel in seinem Tagebuch über ihr ungewohntes Aufbegehren: " (…) kaum aber nannte ich ihren [Christine Enghaus] Namen, in einem Brief nach Hamburg, als Elise, die sich schon über mein bloßes Verweilen in Wien auf die rücksichtsloseste Weise geäußert hatte, mir die ärgsten Schmählichkeiten über sie schrieb, und in einem Ton gemachter Naivität, der mich noch mehr verdroß, als die Sache selbst" (Tagebuch, 29.12.1846). Am 26. Mai heiratete Hebbel Christine Enghaus. Elise blieb nur der gemeinsame Sohn Ernst. Aber auch den musste sie hergeben. Ernst starb wie sein Bruder im Alter von knapp drei Jahren am 12. Mai 1847. Christine Enghaus' Reaktion, die auch gerade ein Kind verloren hatte: "Laß sie - die Mutter - zu uns kommen" (Tagebucheintragung 4170).
Elise lebte eineinhalb Jahre bei Hebbel und Christine Enghaus in Wien. Christine begegnete ihr schwesterlich. Elise übertrug all ihre Liebe zu Hebbel auf seine Frau und das Kind Tinchen, das am 25. Dezember 1847 geboren wurde.
Im August 1849 reiste Elise zurück nach Hamburg, weil sie die ständige Gegenwart Christines und Hebbels wohl doch nicht ertragen konnte. Mit ihr fuhr der uneheliche Sohn Christines, Carl, den Christine Enghaus aus einer anderen Beziehung hatte. Ihn sollte Elise erziehen, was sie auch mit aufopfernder Hingabe tat. Carl wurde zu Elises ganzer Freude in ihrer Einsamkeit.
Die Briefe, die Elise nach ihrer Rückkehr aus Wien an Christine und Friedrich Hebbel schrieb, wobei der größte Teil an Christine gerichtet war, dokumentieren ein Leben allein in Bezug auf Hebbel, übertragen auf dessen Ehefrau Christine und die Tochter Tinchen. Die Briefe vermitteln auch den Eindruck, dass es wieder einmal Elise war, die mehr liebte, als sie geliebt wurde.
Elise Lensing starb nach einem qualvollen Lungenleiden. Sie erhielt ein Armengrab auf dem Friedhof in St. Georg. Als der Friedhof eingeebnet wurde, kaufte ihr Christine Hebbel eine Grabstätte auf dem Friedhof Ohlsdorf.
Quellen:
Text, im Wesentlichen von Brita Reimers
1) Friedrich Hebbel: Werke. Hrsg. von Gertrud Fricke, Werner Keller und Karl Pörnbacher. Bd. 3 und 4. Darmstadt 1966 und 1967; Elise Lesing: Briefe an Friedrich und Christine Hebbel. Hrsg. von Rudolf Kardel. Berlin. Leipzig 1928.
|
|
 |
 |
 |
| Marie Lippert (Marie Anne Lippert geb. Zacharias) |
 |
 |
| 7.9.1854 - 18.6.1897 |
| Gutsherrin und Stifterin |
Ohlsdorfer Friedhof, Grab-Nr. U 23, 21-35 / V 23, 17-25
Marie Lippert geb. Zacharias und ihre drei Brüder wuchsen in einer großbürgerlichen Familie auf. Ihr Elternhaus lag im Hamburger Stadtteil Harvestehude in der Fonteney.
Marie Zacharias heiratete den 10 Jahre älteren Eduard Amandus Lippert, der zusammen mit seinen beiden Brüdern ein Wollhandelsunternehmen leitete. Als das Unternehmen nach einem Börsenkrach unverschuldet in Konkurs gegangen, ein Bruder von der Familie des Landes verwiesen worden war - die Gründe hierfür sind uns heute unbekannt - und der andere die Firma
|
übernommen hatte, ging das kinderlose Ehepaar Eduard und Marie Lippert in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts nach Afrika ins Matabeleland und kehrte erst in den 90er Jahren endgültig wieder zurück nach Hamburg. Die Sehnsucht nach ihrer Verwandtschaft trieb Marie Lippert jedoch immer mal wieder für einen kurzen Besuch nach Hause zurück, obwohl es für sie ein großes Unterfangen bedeutete, solch eine weite Reise allein zu unternehmen.
In Afrika schufen sich die Lipperts eine neue finanzielle Basis, was allerdings nicht ohne Schwierigkeiten vonstatten ging. Eduard Lippert, der von König Lobengula eine Landkonzession für seinen englischen Freund erwirkt hatte, erwarb auf diesem Areal die oberirdischen Nutzungsrechte und erwirtschaftete ein Vermögen mit Gold- und Diamantenschürfungen. Der britisch-südafrikanische Kolonialpolitiker, Abgeordnete, Finanzminister , Premierminister der Kapkolonie und Vorkämpfer des britischen Imperialismus, Cecil Rhodes, der großen Reichtum durch die Ausbeutung der südafrikanischen Diamantfelder erworben hatte, machte Eduard Lippert jedoch das Land streitig, weil er für dieselben Ländereien die unterirdischen Rechte eingehandelt hatte. Die Situation verschärfte sich, als Lippert dem betrunkenen Cecil Rhodes in einem Klub vor Zeugen Unangenehmes sagte. Rhodes wollte daraufhin Lipperts Konzession vernichten und hatte auch seine Regierung hinter sich, im Gegensatz zu Lippert, der die Hilfe der deutschen Regierung vergeblich erbat. 1892 kam es zu einer Einigung: Eduard Lippert verkaufte zu einem Millionenbetrag seine Rechte an Cecil Rhodes.
Im Privatleben hatte das Ehepaar nicht so viel Glück. Es wurde bald überschattet von Marie Lipperts Krebserkrankung. Doch die junge Frau ließ sich nicht unterkriegen. Sie liebte Afrika, war neugierig auf das fremde Land, und nichts war ihr mehr zuwider, als irgendwelche Umstände zu machen. Deshalb war es für sie auch selbstverständlich, gleich nachdem sie 1891 den ersten Krankheitsschub überstanden hatte, ihren Mann auf eine dreimonatige Reise durch das Matabeleland zu begleiten. Eduard Lippert schreibt dazu in seinem Nachwort zu den von seiner Frau für einen kleinen Freundeskreis veröffentlichten kurzen Landschaftsskizzen und Reisebriefen an die "liebe Mama": "Umstände waren ihr ihrLeben lang in den Tod zuwider, und so nahm sie, kaum vom Krankenlager erstanden, auch diese Reise zu den Wilden als etwas ganz Einfaches, Selbstverständliches, da die Reise gemacht werden musste und sie mich doch nicht allein ziehen lassen könne."¹
Von der Fahrt durch das Land mit einem Planwagen und einigen Bediensteten schrieb Mike, wie Marie Lippert genannt wurde, ihrer Mutter regelmäßig Briefe. Aus ihnen spricht sowohl die Beschwerlichkeit solch einer Reise als auch Zuversicht und fröhliche Neugierde auf die fremde Kultur. Vieles Ungewohnte empfand Marie Lippert eher als spaßig denn beschwerlich. So äußert sie sich über das Schlafen in einem Zelt: "… sehr komisch, man kriecht hinein, so niedrig ist es."¹ Und über das Schlafen im Wagen: "Vorige Nacht haben wir im Wagen geschlafen, der ganz zugemacht werden kann, und die Sitzlehnen klappt man herunter, so daß es wie ein Bett wird."¹
Auf der Fahrt durch den endlosen Busch musste die kleine Reisegruppe selbst für ihr Essen sorgen und es im Freien zubereiten. Sie fingen z.B. zwei Hühner und kochten sie: "Kochen im Freien ist auch komisch, man hat nie Zeit und man ist Abends müde, Reis spielt eine große Rolle, das geht so rasch."¹ Wenn sie am Lagerfeuer saßen und ihr Essen zubereiteten, kamen sie schnell mit den Einheimischen in Kontakt, was Marie Lippert sehr schätzte, trotz der wenigen Zeit, die dadurch für ein trautes Beisammensein des Ehepaares blieb. Marie Lippert scheint keine Scheu vor dem Fremden und den Fremden gehabt zu haben, mit denen sie sich hauptsächlich auf englisch unterhielt, weil sie Zulu nur bröckchenweise sprechen konnte. So schreibt sie über ein Zusammentreffen mit Einheimischen: "Die letzten Tage nur Kaffern gesehen, uns sehr mit ihnen amüsiert."¹ Oft saß das Ehepaar mit seinen neuen Freunden am Lagerfeuer und genoss die romantische Stimmung: "Unserer Matabele-Führer hatten ein großes Feuer gemacht, dazu der schöne Mondschein, es war wirklich gemütlich."¹
Wenn das Ehepaar Lippert länger an einem Ort weilte, wohnte es in einfachen Lehmhütten, liebevoll dekoriert von den Einheimischen. Darüber berichtet Marie Lippert in einem Brief an ihre Mutter. "Denke dir, acht oder zehn Lehmhütten, weit voneinander entfernt, jede auf einem Hügel, Strohdächer; ganz kleine Fenster ohne Scheiben, innen mit Matten und Fellen und allerhand Zeug zurechtgemacht. Für mich hatten sich die jungen Leute wirklich angestrengt, sie dekorierten, was nur zu dekorieren war. Wir haben ein Haus für uns allein. Bettlaken, Tischtücher, Gläser gibt es nicht; man schläft auf seinen Schaffellen, trinkt aus emaillierten Kummen und hat sein Essen in einer handgroßen Zinnschüssel. Dann trinkt man Burgunder und Champagner und ißt fein eingemachtes französisches Obst und Gemüse. Frisches Fleisch, Brot und Milch sind Luxusartikel, frisches Gemüse und Kartoffeln gibt es gar nicht."¹
Marie Lippert passte sich ohne Murren den Gegebenheiten an, auch wenn sie dabei auf gewohnten Komfort verzichten musste, war aber doch froh, als man ihr für eine täglich zu verrichtende Tätigkeit einen gewissen Luxus bot: "Man war darauf verfallen, ein Klosett zu bauen und das ist ein außerordentlich angenehmer Luxus! In der Wildnis ist es in Ordnung, aber in einem Camp mit einer Menge von Männern, ist es akward, to say the least of it, besonders in Tati, wo unser Haus ganz allein auf einem Hügel stand, das von allen Seiten zu übersehen war, so daß man sich bei gewissen Gelegenheiten so fühlte wie Jochen Nüssler's Eltern, wenn sie sich Geheimnisse erzählen wollten!"¹
Marie Lippert lernte das Leben in der freien Natur gegenüber den eingeschränkten Verhältnissen in der Zivilisation schätzen. "Wundern tue ich mich auch darüber, daß schlechtes Wasser und komisches Essen und Anstrengung einem nichts tut. Es zeigt recht, wie viel natürliches Leben ganz im Freien wert ist und wie verkehrt unser zivilisiertes Leben sein muß. Wäre ich den Ratschlägen der Königinnen gefolgt und trüge keinen Gürtel und kein Korsett mehr, ginge es mir vielleicht noch besser."¹ Dem Land und der Kultur wäre sie vermutlich noch mehr verbunden gewesen, wenn sie auf die einheimischen Frauen gehört und sich dem dort vorherrschenden Schönheitsideal zugewandt hätte. So wie Marie Lipperts Figur geschaffen war, entsprach sie so gar nicht den Vorstellungen der Einheimischen. "Ganz entsetzt sind sie [die Frauen] über meinen geringen Umfang. Besonders wenn ich aufstehe, erhebt sich ein allgemeines Oh und Ah, und sie zeigen alle auf meine Taille und fragen, ob ich nicht abbreche, und sagen, ich muß immer einen großen Haufen Fleisch auf dem Tische stehen haben und einen großen Topf Bier, damit ich dicker werde. Im übrigen habe ich seit Johannisburg sechs Pfund zugenommen und Eduard drei Pfund abgenommen, womit wir beide sehr zufrieden sind."¹
An manchen ihrer Aufenthaltsorte wurde Marie Lippert aus Sicherheitsgründen nur ein eingeschränkter Bewegungsradius zugestanden: "Für mich ist es auch ein wenig langweilig, wenn die Herren den ganzen Tag weg sind, was im Camp zu zeichnen ist, das habe ich gezeichnet und allein aus der Umfriedung herausgehen darf ich nicht. Es würde einem nicht gerade etwas passieren, aber die jungen Regimenter, die in Buluwaju liegen, sind übermütig und solcher Trupp von jungen Leuten mit ihren Schildern und Speeren könnte einen belästigen."¹
Nach dieser Reise kehrte das Ehepaar in sein festes Haus in Afrika zurück. Marie Lipperts Krankheit war jedoch nicht zum Stillstand gekommen. Sie musste operiert werden. Aber auch das half nicht. Eduard Lippert, in großer Sorge um seine Frau, verkaufte seine Besitztümer in Afrika, und um seiner Frau den Abschied von Afrika und die Eingewöhnung in Hamburg so angenehm wie nur möglich zu machen, kaufte er 1896 ein schönes Haus in der Fontenay und das Gut Hohenbuchen in Poppenbüttel. Marie Lippert fiel der Abschied von ihrem geliebten Afrika dennoch sehr schwer. Eduard Lippert äußert sich dazu in seinem Nachwort: "Noch bis in die letzten Tage kämpften bei meiner Frau mit der Liebe zu dem hier neu geschaffenen Heim, welches das Zusammenleben mit den unsrigen doppelt wert machte, der Zug nach dem Heim draußen im fernen Afrika, nach den großen einsamen Flächen, den weiten blauen Horizonten, nach dem selbst aus der Wüste geschaffenen Heim, das sie im nächsten Jahre wieder aufsuchen wollte. Und sie war wie vorbestimmt für ein solches Leben; ob sie am Morgen mit Entzücken durch die Waldanpflanzungen oder über die Felder ritt, ob sie im Garten grub und pflanzte, ob sie am Abend der Mittelpunkt der Geselligkeit war, überall dieselbe unbesiegbare und unsiegende Heiterkeit, die der Grundzug ihres Charakters war, und die auf alle, die ihr nahe kamen, eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausübte. Ob sie Leidenden, Unglücklichen Hilfe zu bringen suchte, ob sie tätigen Anteil nahm an Beschwerden und Kämpfen, an denen das Erwerbsleben in Ländern wie der Transvaal überreich ist, immer der selbe klare, grade auf das Ziel gerichtete Blick, dieselbe Leichtigkeit, sich in die Verhältnisse zu schicken, ohne ,Umstände' zu machen."¹
In Hamburg angekommen, ließ das Ehepaar Lippert auf Gut Hohenbuchen in Poppenbüttel ein Kindergenesungsheim für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr errichten und am Poppenbüttler Markplatz ein Erholungsheim für ca. 30 weibliche Ladenangestellte und Telefonistinnen bauen, die dort für einen sehr geringen Geldbetrag zwei bis vier Wochen Urlaub machen konnten. Zudem unterhielt das Ehepaar Lippert ein Säuglingsheim in Groß-Borstel sowie ein Waisenhaus für zwölf Kinder bis zum 14. Lebensjahr an der Poppenbüttler Hauptstraße Nr. 23. Die Gründe für Eduard LippertsTatendrang nennt Marie Lipperts Schwägerin Elise, geb. Wentzel in ihrem unveröffentlichten Tagebuch: "Eduard Lippert tat alles, um seiner Frau ein langes Leben vorzutäuschen, ob sie sich täuschen ließ? Wir glaubten es nicht! Eduard gründete auf Hohenbuchen ein Kinderheim. Zu seinem Erstaunen war es schwer,verwahrloste Kinder aufzutreiben. Mike war die Leiterin des Heimes. Das war wieder ein Täuschungsmanöver für Mike, die Totkranke. So lebte sie in den schönsten Verhältnissen, dem bitteren Tod entgegen. Sie wurde wieder operiert, und man sah, daß das Leiden sehr weit fortgeschritten war. 1897 im schönsten Sommer wurde sie von ihrem Leiden erlöst."²
Marie Lippert wurde nur 42 Jahre alt. Sie wurde auf dem Ohlsdorfer Friedhof begraben. Das Grabmal auf dem Familiengrab der Familie Lippert zeigt in Reliefs Szenen aus dem Leben Marie Anne Lipperts. Bestimmte Gesichtszüge sollen typisch für die Zacharias-Linie sein, aus der Marie stammte. Auf der linken Seite des Reliefs sieht man Marie Lippert an einer Rosenblüte riechend in einem Garten mit exotischen Pflanzen und Bergen im Hintergrund.
Hier muss sie sich schon in Afrika befunden haben. Rechts daneben sitzt sie in einer offenen Veranda an einem kleinen Tisch, stützt den Kopf in die eine Hand und hat in der anderen Hand eine Schreibfeder, ihr Blick ist in die Ferne gerichtet. Marie Lippert schreibt an ihren Reiseberichten. Die Inschriften über dem Relief lauten: "Selig sind die reines Herzens sind" - darunter: "Nur einmal weile ich auf dieser Erde. Alles Gute daher, das ich thun, jede Liebe, die ich einem meiner Mitmenschen erweisen kann, lass sie mich sogleich thun. Lass mich nicht säumen, dass ich die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lasse! Denn niemals werde ich dieses Weges wieder ziehen."
Auf der rechten Seite sieht man Marie Lippert zwischen zwei großen Bäumen stehen, um sich herum eine große Kinderschar. Es handelt sich dabei um ihre Neffen und Nichten. Rechts davon ist im Hintergrund ein niederdeutsches Bauernhaus zu sehen, das von Marie Lippert gestiftete Waisenhaus, rechts davor steht am Bildrand Marie Lippert hinter einem Leiterwagen, aus dem ein Baby die Arme und Beine hochstreckt. Dabei soll es sich nach Aussagen von Christoffer Zacharias-Langhans, dem Großneffen von Marie Lippert, um seinen Vater handeln, mit dem seine Großmutter zu diesem Zeitpunkt schwanger ging. Marie Lippert hat die Wagendecke hochgehoben und sieht auf eine schräg vor ihr hockende bäuerlich gekleidete Frau, die die Hände zu ihr emporhebt, Inschriften über dem Relief: "Die Liebe höret nimmer auf ", unter dem Relief: "Wer wahre und vollkommene Liebe hat, sucht in keiner Sache sich selbst."
Der letzte Spruch ist auch an der Südseite des Hauses an der Poppenbüttler Hauptstraße Nr. 23 als Inschrift zu sehen, gefolgt von dem Datum "18. Juni 1897" - dem Sterbedatum Marie Anne Lipperts. Auch auf der Nordseite des ehemaligen Waisenhauses verweist die Inschrift auf dieses Datum: "Marie und Eduard Lippert 1897".
Eduard Lippert führte das gemeinsam begonne wohltätige Werk fort. Auf Gut Hohenbuchen, welches er noch bis 1914 betrieb, züchtete er im Kupferteich Karpfen, nutzte die Gebäude an der oberen Mühle als Fischbrutanstalt für Forelleneier und produzierte ab 1900 keimfreie und fettreiche Kindermilch, die "Kontroll-Kindermilch Hohenbuchen", eine Art Vorzugsmilch, die in Deutschland eine Neuheit war. Der Hof umfasste 40 ha landwirtschaftliche Nutzfläche und 15 ha Wasser sowie Ödland. Durch Zukauf erweiterte Eduard Lippert den Besitz auf 147 ha Nutzfläche. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg besaß er 143 Milchkühe. Während der Inflationsjahre verlor er fast sein gesamtes Vermögen.
Text: Rita Bake
Quellen:
1 Marie Lipperts Reisebriefe und Skizzen aus dem Matabeleland,
geschrieben in der Zeit vom 21.9. - 23.12.1891. Privatbesitz.
2 Elise Lippert. Unveröffentlichtes Tagebuch. Privatbesitz.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Else Mauermann, geb. Fritz |
| 5.12.1903-5.10.1989 |
| Widerstand gegen das NS-Regime |
| Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bn 73, 350
Else Mauermann und und ihr Ehemann Rudolf wurden durch "Georg Sacke in die illegale Arbeit für die Bewegung ‚Freies Deutschland' eingeführt. Über die Entwicklung des Hamburger Freundeskreises zu einer zielbewußten antifaschistischen Gemeinschaft und deren Anschluß an die Leipziger Widerstandsorganisation Schumann-Engert-Kresse berichtet Rosemarie Sacke: "Man kann sagen, daß die Eheleute Sacke, Mauermann und Hans Scheffel eine illegale Gruppe gebildet haben. Georg hat sich besonders bemüht, Rudi und Hans für eine systematische Flüsterpropaganda in ihren Betrieben aufs beste auszurüsten. Fest umrissene Gestalt bekam diese Anleitung, als uns Wolfgang Heinze mit einer der ersten Veröffentlichungen, die auf dem Programm der NKFD basierten, versah. (…)
|
Zur Bekanntgabe und Diskussion dieses Dokuments beriefen wir in unserer Wohnung eine Zusammenkunft ein, an der Hans und Paula Ketzscher, Rudi und Else Mauermann (…) teilnahmen (…). Das Material enthielt eine klare Analyse der damaligen politischen Lage und beantwortete konkret die Frage: Was können wir in der gegenwärtigen Phase des Krieges tun? (…)Vor allem aber sollte die Erkenntnis verbreitet werden, daß nur der Sturz des Hitlerregimes Deutschland vor dem Schlimmsten bewahren konnte." 1)
Quellen:
1) Ursel Hochmuth, Gertrud Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933-1945. Frankfurt a. M. 1969, S. 309.
|
|
 |
 |
 |
| Gertrud Meyer |
 |

Photo aus: Mathiys Wessing: Gertrud Meyer - Die Frau mit den grünen Haaren. Hamburg 1978. |
| 21.1.1898 Köln - 21.12.1975 Hamburg |
| Stadtverordnete. Mitglied der Widerstandsgruppe Bästlein-Jacob-Abshagen, Gründerin eines Archivs für antifaschistischen Widerstand, Mitbegründerin des Komitees ehemaliger politischer Gefangener |
Ohlsdorfer Friedhof. Geschwister-Scholl-Stiftung, Grab Nr. Bn 73, 302
Gertrud-Meyer-Straße,Ohlsdorf, seit 2014, benannt nach Gertrud Meyer.
Gertrud Meyer, die den größten Teil ihres Lebens in Hamburg verbrachte, war eine überzeugte Kommunistin und wurde von den Nationalsozialisten verfolgt und inhaftiert - doch trotz oder gerade wegen der erlittenen Qualen gründete sie gleich nach Kriegsende ein Archiv für antifaschistischen Widerstand.
Am 21. Januar 1898 wurde Gertrud Meyer in Köln als Tochter eines engagierten sozialdemokratischen Handwerkerehepaares geboren. Als Gertrud Meyer zwölf Jahre alt war, starb ihr Vater an Schwindsucht.
|
Die Familie zog nach Hamburg. "Schon dieser erste Schicksalsschlag (der Tod des Vaters und die daraus resultierende Verarmung der Familie) hatte sie tief verwundet, zugleich aber ihr Bedürfnis nach Selbstbehauptung, ihren Widerstand und ihre Energie ungemein gesteigert. So fand sie den Weg zur aktiven Teilnahme an der sozialistischen Jugendbewegung," 1) schreibt die Herausgeberin von Gertrud Meyers Autobiographie.
Gertrud Meyer war begabt, sie besuchte die Selekta, was nur den besten Schülerinnen aus den letzten Volksschulklassen Hamburgs erlaubt wurde. Ihr Wunsch, Lehrerin zu werden, wurde jedoch von der Armenverwaltung mit einer unglaublichen Begründung abgelehnt: "Ich war damals vierzehn Jahre alt (...). Aus der Selekta konnten zu jener Zeit Volksschülerinnen ein Stipendium bekommen und konnten eine höhere Lehranstalt besuchen, entweder ein Lehrerseminar oder ein Lyzeum und hatten damit die Möglichkeit eines qualifizierten Berufes. Bei mir gab es zwei Möglichkeiten. Ich zeichnete sehr gut, meine Zeichnungen wurden ausgestellt in der Kunstgewerbeschule am Lerchenfeld (...). Ich konnte Zeichenlehrerin oder Lehrerin werden. Auf alle Fälle mußte ich dazu das Lehrerseminar besuchen und nebenbei die Kunstgewerbeschule im Lerchenfeld. (...) Nun ging die Verhandlung, ob ich aufs Lehrerseminar soll. Da schaltete sich die Armenverwaltung bzw. die Gemeinde ein und bestimmte: wenn die Gertrud nicht Dienstmädchen wird, wörtlich: `Dann ziehen wir die milde Hand zurück und Frau Meyer bekommt ihre fünf Mark nicht mehr.` So mußte ich Dienstmädchen werden und mich auch konfirmieren lassen." 1)
Nach einiger Zeit kündigte Gertrud Meyer ihre Dienstmädchenstelle und begann eine Tätigkeit in einer Schraubenfabrik im Hamburger Stadtteil Hammerbrook, wo sie sehr anstrengende Arbeiten verrichten musste.
Nachdem sie dort gekündigt hatte, arbeitete sie eine Zeit lang auf dem Gut des Barons von Ohlendorff (siehe auch: Heinrich-von-Ohlendorff-Straße, in Bd. 3 online). Nachdem sie auch diese Stellung verlassen hatte, versuchte sie eine neue Anstellung zu finden und sprach deshalb in Hamburg beim Vaterländischen Frauenverein vor, der als Arbeitsvermittlungsstelle fungierte. Diesem Verein: "gehörten u. a. die Damen Sieveking, Heydorn und Mönckeberg, also die Hautevolee von Hamburg [an]. Die machten auf diese Weise Vaterlandsverteidigung, indem sie uns Mädchen vershanghaiten. Ich wurde von ihnen nach Quickborn in Holstein, fünfzig Kilometer von Hamburg entfernt, vermittelt. Da war ein Komplex von Munitionsfabriken, der der Dynamit-Nobel-AG und der Norddeutschen Sprengstoff-AG gehörte. Dort habe ich an der Presse gearbeitet - Schwarzpulver -, wir haben Leuchtkörper hergestellt. Es gab keine Verbindung mit den Jugendorganisationen. In Quickborn, wo ich arbeitete, war nicht eine Stelle, war kein Gewerkschafter, der sich darum kümmerte, daß wir Milch haben mußten, da wir doch dieses Gift schlucken mußten." 1)
Die Arbeit in der Munitionsfabrik machte Gertrud Meyer krank - sie brach zusammen - kehrte nach Hamburg zurück und musste sich einige Zeit auskurieren und: "nachher wiederum zum 'Vaterländischen Frauenverein'. Die feinen Damen mit den reingewaschenen Hälsen haben uns dann im Mai 1917 nach Leverkusen geschickt. In Leverkusen habe ich in einem Geschoßfüllwerk gearbeitet." 1) Dort lernte sie Mitglieder der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung kennen. 1917 trat sie der USPD bei, 1920 dann der KPD.
In der Munitionsfabrik in Leverkusen erkrankte sie durch ihre Arbeit mit Piktrinsäure, die Gertrud Meyers Haare grün und ihre Haut gelb werden ließ. "Es kam die Revolution vom November 1918 - die Munitionsarbeit war vorbei, und allmählich verschwand nicht nur Gertruds widerliche Färbung, sondern auch der damit verbundene Minderwertigkeitskomplex. Gertrud spielte eine wesentliche Rolle im Arbeiter- und Soldatenrat und später auch in der Kommunistischen Partei in Köln", 1) so Gertrud Meyers Biographin Mathijs C. Wiessing.
Nachdem Gertrud Meyer die Munitionsfabrik in Leverkusen verlassen hatte, zog sie zu Verwandten nach Köln. Dort lernte sie in ihrem politischen Umfeld Kurt Meyer kennen, einen Mann aus bürgerlichen Kreisen, Architekt von Beruf und Mitbegründer der Zeitung "Sozialistische Republik". Am 14. April 1920 heirateten die beiden. Zusammen mit ihrem Mann setzte Gertrud Meyer ihre politische Arbeit fort, so als Angestellte in der Expedition der "Sozialistischen Republik". Mit dieser Arbeit verdiente sie ihr Geld, nebenher war sie als Referentin der USPD, ab 1920 dann der KPD tätig. Außerdem wurde Gertrud Meyer in Köln zur Stadtverordneten gewählt und arbeitete in verschiedenen Ausschüssen, auch in der Bezirksleitung der KPD für die Frauenarbeit, mit. Gleichzeitig hatte sie noch ihren kleinen Sohn zu versorgen.
Da Gertrud Meyers Gesundheit bereits sehr angeschlagen war, stand sie diese vielfältigen Tätigkeiten nicht durch - neue Erkrankungen stellten sich ein: "Ich hatte eine ganze Zeit das Stadtverordnetenmandat, aber dann wurde meine Stirnhöhlenentzündung immer schlimmer. Das wurde dann so furchtbar, daß es passierte, daß ich während der Stadtverordnetenversammlung einfach zusammenbrach und diese entsetzlichen Kopfschmerzen hatte, an denen ich tagelang litt und mich wie ein totgeschlagener Hund fühlte. Es wurde so schlimm, daß ich gar keine Funktion mehr richtig ausüben konnte, weil ich einfach keine Termine einhalten konnte, so daß ich damals dann alle Funktionen niederlegen mußte, mit Ausnahme der Stadtteilleitung." 1)
Ihr Mann war in dieser Zeit Stadtarchitekt. 1929 zogen sie von Deutz nach Köln. Nachdem es Gertrud Meyer gesundheitlich wieder ein wenig besser ging, übernahm sie die "Rote Hilfe" und die Frauenarbeit der KPD. Als ihr Mann 1930 zum Städtebaudirektor befördert werden sollte, ließ Adenauer ihn zu sich kommen und forderte ihn und seine Frau auf, aus der KPD auszutreten - ansonsten könne er die Beförderung nicht unterschreiben. Kurt Meyer bat um Bedenkzeit, um sich mit seinen Genossen zu beraten. Bei diesen handelte es sich um Vertreter der Sowjetischen Handelsgesellschaft und des Obersten Volkswirtschaftsrates. Sie rieten ihm, sich für mindestens zwei Jahre beurlauben zu lassen und nach Moskau zu gehen - um sich somit Adenauers Forderung elegant zu entziehen.
1930 folgte das Ehepaar Meyer diesem Rat und zog mit ihrem neunjährigen Sohn nach Moskau. Dort arbeitete Gertrud Meyer in einem Dynamowerk, wollte aber eigentlich Biologie studieren. Man schlug ihr jedoch vor, ein Politikstudium aufzunehmen, und zwar an der Westuniversität, einer Hochschule für ausländische Studentinnen und Studenten, die auch einen deutschen Sektor besaß. Kurt Meyer wurde zum Leiter eines der Moskauer Bezirksämter ernannt und erhielt die Einbürgerung.
Doch auch in der Sowjetunion waren der Familie nur knapp neun Jahre gegönnt, denn in die politischen Auseinandersetzungen innerhalb der KPdSU, die sich ab 1934 zuspitzten, wurden auch die Emigranten einbezogen. Gertrud Meyers Biographin schreibt zu den politischen Ereignissen: "Kirow, Parteisekretär von Leningrad, seit dem XI. Parteitag 1922 Kandidat des ZK der KPdSU, seit 1927 Mitglied des Politbüros, wird am 1. Dezember 1934 ermordet. Noch am Abend des Mordtages gibt Stalin, ohne Konsultation des Politbüros, eine Verordnung zur beschleunigten Aburteilung sogenannter Terroristen und zur unverzüglichen Hinrichtung aller bislang zum Tode verurteilten Oppositionellen heraus. Die Ermordung Kirows wird so zum Auftakt einer immensen Repressionswelle, in deren Verlauf tausende Kommunisten verhaftet und verschleppt werden." 1) Von diesen politischen Spannungen war auch das Ehepaar Meyer betroffen. Gertrud und Kurt Meyer wurden 1936 aus der Partei ausgeschlossen, Kurt Meyer am 26. November 1936 verhaftet. Er starb 1942 und wurde später posthum in der Sowjetunion rehabilitiert. Weil Gertrud Meyer deutsche Staatsbürgerin war und zu den Kadern der Komintern gehörte, erfolgte 1938 ihre Ausweisung aus der SU. Ihr Sohn blieb zurück und wuchs in einem Kinderheim auf. Die beiden sollten sich erst nach dem Krieg wiedersehen.
So kehrte Gertrud Meyer 1938 in ein Deutschland zurück, in dem die Nationalsozialisten regierten. Als sie über Polen kommend Berlin erreichte, wurde sie in Gestapo-Haft genommen und mehrere Tage verhört. Im Oktober 1938 kam sie ins Gefängnis Moabit in "Schutzhaft". Im März 1939 wurde sie zu zwei Jahren Zuchthaus wegen "Vorbereitung zum Hochverrat" verurteilt. Die Strafe saß sie in Cottbus ab und kam, da die Untersuchungshaft angerechnet worden war, endlich Ende September 1940 nach Hamburg zu ihrer Mutter und Schwester.
Kurz nach ihrer Ankunft in Hamburg nahm Gertrud Meyer Kontakt zur illegalen Organisation der KPD auf, deren Angehörige sie zum Teil von früher kannte. Sie wurde Mitglied der Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe, der illegalen Bezirksleitung der KPD Hamburg und begann als Laborantin in der Rüstungsfabrik des Valvo-Werkes in Hamburg-Lokstedt tätig zu werden. Hier arbeiteten auch viele "Ost"-Arbeiterinnen aus besetzten Gebieten. Sie waren unterernährt, unter primitivsten Umständen untergebracht, und ihr Lohn war meist geringer als ein Taschengeld. Da sich Gertrud Meyer wegen ihrer Labortätigkeit relativ frei in den Valvo-Werken bewegen konnte, wurde sie von ihrer Partei zur Kontaktperson für die Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter gewählt. Gertrud Meyer setzte sich für diese ein und überzeugte die restliche Belegschaft der Valvo-Werke, sich solidarisch mit den "Ost"-Arbeitern und -arbeiterinnen zu zeigen. So wurde mehr oder weniger offen den "Ost"-Arbeiterinnen und -arbeitern geholfen. Gleichzeitig versuchte Gertrud Meyer ihre Kolleginnen und Kollegen zum Widerstand gegen das NS-Regime aufzurufen.
Als Hamburg im Sommer schwer bombardiert wurde, entwarf Gertrud Meyer ein Flugblatt, das in den Betrieben Hamburgs verteilt werden sollte. Es lautete: "An die Bevölkerung der Stadt Hamburg! Das vierte Kriegsjahr nimmt seinen Lauf. Es begann mit der Niederlage von Stalingrad. Mehr als hunderttausend deutsche Männer und Söhne mußten dort elend für eine verlorene Sache zugrunde gehen. Unaufhaltsam folgen die Rückschläge an allen Fronten. Jeder kann jetzt erkennen: Dieser Krieg ist nicht mehr zu gewinnen! Verbreitet die Wahrheit über diesen Krieg! Arbeitet langsamer! Macht keine Überstunden! Blockiert die Lieferungstermine! Alles, was Ihr tut, um den Krieg zu beenden, dient der Rettung der Heimat und unzähliger Menschenleben!"
Für die Verteilung des Flugblattes blieb jedoch keine Zeit mehr. Die Gestapo war der Widerstandsgruppe auf den Fersen. Im Jahre 1944 begannen die Verhaftungswellen. Gertrud Meyer wurde am 25. Februar 1944 in ihrem Betrieb verhaftet, nachdem sie noch einige Freunde hatte warnen können. Weil sie keine Freunde und Genossen verriet, wurde sie gefoltert. Ihr Prozess sollte im März 1945 vor dem Volksgerichtshof stattfinden. Da sich ihr Prozess jedoch immer wieder durch Bombenangriffe und andere Umstände, z. B. durch den Tod des Vorsitzenden des Volksgerichtshofs verzögerte, wurde Gertrud Meyer der Prozess nicht mehr gemacht. Am 1. Mai 1945 wurde Hamburg den Engländern übergeben, Gertrud Meyer aber erst am 26. Mai 1945 aus dem Gefängnis entlassen.
Trotz dieser schweren Erlebnisse baute Gertrud Meyer gleich einen Monat nach ihrer Entlassung aus der Haft zusammen mit anderen früheren Widerstandskämpferinnen und -kämpfern das Komitee ehemaliger politischer Gefangener auf, das der britischen Militärregierung bei der Entnazifizierung half. Außerdem hatte das Komitee die Aufgaben, sich um ehemals Verfolgte und ihre Familienangehörigen zu kümmern, bei der Arbeitssuche zu helfen, Trümmeraufräumarbeiten zu organisieren und andere soziale Hilfe zu leisten. Gertrud Meyer sammelte Berichte und Dokumente über die Verfolgung in der NS-Zeit und war maßgeblich an den Kriegsverbrecherprozessen in Hamburg beteiligt.
In der Zeit des Kalten Krieges wurde das Komitee verboten. Aber nicht nur das war ein harter Schlag für Gertrud Meyer. Ihr und ihrem neuen Lebensgefährten, dem österreichischen Sozialdemokraten und ersten Sekretär des Komitees, Hans Schwarz, wurde von den eigenen Genossen vorgeworfen, dass sie mit den Engländern, den ehemaligen Verbündeten, die nun zu Feinden geworden waren, zusammengearbeitet hatten. Gertrud Meyer wurde aus der KPD ausgeschlossen. Kurze Zeit später wurde die KPD verboten und Gertrud Meyer vom ZK der nun illegalen KPD wieder aufgenommen. Gertrud Meyer organisierte die Parteiarbeit in der Illegalität, erstellte ein neues Archiv des Widerstandes und half beim Aufbau des KZ Neuengamme als Gedenkstätte. Außerdem schrieb sie mehrere Bücher über die NS-Zeit, z. B. "Nacht über Hamburg", "Frauen gegen Hitler" und "Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand".
Gesundheitlich war Gertrud Meyer sehr angeschlagen. Aufgrund der erlittenen Qualen unter der Folter und während der Haft hatte sie sich ein schweres Herzleiden zugezogen. Gertrud Meyer starb am 21. Dezember 1975 in ihrer Hamburger Wohnung in der Maria-Louisen-Str. 65 im Stadtteil Winterhude.
Text: Anja Bögner
Quellen:
1) Mathijs C. Wiessing (Hrsg.): Gertrud Meyer - Die Frau mit grünen Haaren. Erinnerungen von und an G. Meyer. Hamburg 1978.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Antonie Möbis, geb. Schmidt |
| 5.3.1898 - 16.8.1976 |
| Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (KPD, 1931-1933) |
| Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bn 73, 358
Antonie Möbis war das sechste und jüngste Kind einer Arbeiterfamilie. Der Vater, ein Lokomotivführer, starb 1910, zwei Jahre später ihre Mutter. Antonie Möbis musste gleich nach Abschluss der Hauptschule ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, zuerst von 1912 bis 1917 als Hausmädchen, dann ab Juni 1917 als Industriearbeiterin auf der Deutschen Werft in Kiel. 1919 wurde sie Gewerkschaftsmitglied, war von 1920 bis Juni 1923 Mitglied der SPD und seit Juni 1923 Mitglied der KPD. Wegen ihres politischen Engagements wurde sie arbeitslos und kam auf die "schwarze Liste".
|
Das bedeutete, sie fand in Kiel keine Arbeit mehr. Deshalb zog sie im Sommer 1925 nach Hamburg. Hier arbeitete sie als Hilfspflegerin in der "Irrenanstalt Friedrichsberg" und als Reinemachefrau. Zwischendurch war sie immer wieder arbeitslos. Am 1.8.1931 wurde sie wegen "Zersetzungshochverrats" inhaftiert. Doch weil sie im September 1931 in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt worden war, wurde sie am 4.11.1931 aus dem Untersuchungsgefängnis entlassen. In der Zeit des NS-Regimes arbeitete Antonie Möbis im Widerstand. Sie war vom 16.9.1933 bis 20.3.1934 im Hamburger Untersuchungsgefängnis inhaftiert, dann vom 21.3.1934 bis 12.5.1936 fünfzehn Monate in Einzelhaft im Zuchthaus Lauerhof bei Lübeck. Nach der Strafverbüßung kam sie ins KZ Moringen, aus dem sie am 27.8.1936 entlassen wurde. Im November 1939, nach einer Denunziation, wurde sie von der Gestapo verhört. Eine Inhaftierung konnte abgewendet werden. Fünf Jahre später kam es zur erneuten Inhaftierung. Vom 22.8.1944 bis 24.10.1944 saß sie im KZ Fuhlsbüttel. In ihrem "Antrag auf Ausstellung eines Ausweises für politisch, rassisch und religiös durch den Nazismus Verfolgte" vom 18.12.1946 beantwortete sie die folgenden Fragen zu ihrer Zeit in den Konzentrationslagern: "Wurden Sie mißhandelt?" "Ja getreten und gestoßen". "Haben Sie gesundheitliche Schäden erlitten?" "Ja. Nervenleiden im rechten Arm." Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete sie als Stationsfrau im Hamburger Hilfskrankenhaus am Weidenstieg.
Seit 1991 gibt es in Hamburg Eidelstedt einen Antonie-Möbis-Weg.
Text: Rita Bake
|
|
 |
 |
 |
| Martha Naujoks, geb. Pleul |
 |
 |
| 3.12.1903 - 26.1.1998 |
| Korrespondentin, Mitglied der KPD, war vier Monate in Haft, emigrierte |
| Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, B0 73, 12
Martha Pleul entstammte einer Arbeiterfamilie. Um zum Familieneinkommen finanziell etwas beizutragen, musste Martha Pleul schon als Elfjährige in Heimarbeit große Ballen Nesseln zerschneiden. Mit 15 Jahren trat Martha Pleul, unterstützt von ihrem Vater, der Freien Sozialistischen Jugend (FSJ) bei. 1920, nach dem Vereinigungsparteitag von KPD und USPD, wurde Martha Pleul Mitglied der KPD. Sie zog nach Hannover, arbeitete bei der Bezirksleitung der KPD und war Funktionärin in der Kommunistischen Jugend. Später siedelte sie nach Hamburg und nahm 1923 am Hamburger Aufstand teil. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei Flugblätter und verhaftete Martha Pleul, sie kam für ¼ Jahr ins Gefängnis Hütten in U-Haft.
|
1926 heiratete sie Harry Naujoks, der nach dem Hamburger Aufstand im Oktober 1923 Vorsitzender des Hamburger Kommunistischen Jugendverbandes (KJVD) wurde. Später fungierte er als Organisationsleiter der KPD in Barmbek. Ab 1932 wurde er bei der Bezirksleitung Wasserkante der KPD für die Arbeit der KPD in Betrieben zuständig. Ab 1933 arbeitete das Paar illegal für die KPD weiter. Martha Naujoks wurde eines Nachts in sogenannte Schutzhaft genommen. Auf Beschluss der KPD ging sie 1935 in die Emigration nach Moskau. Harry Naujoks sollte sich scheiden lassen, was er aber zurückwies. Er durchlitt Zuchthausstrafen und mehrere Konzentrationslager. 1945 kam Martha Naujoks aus der Emigration zurück.
Quelle:
Archiv/Sammlung: Gedenkstätte E. Thälmann Hamburg.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Toni O'Swald, geb. Haller |
| 18.6.1866 Hamburg -19.11.1949 Hamburg |
| Wohltäterin |
| Ohlsdorfer Friedhof, Grab Nr. AC 7, 109-13
Toni O'Swald, geb. Haller war die Tochter des Architekten Martin Haller. Verheiratet war sie seit 1890 mit dem Großkaufmann des Kolonialhandelshauses O'Swald, Alfred O'Swald (1861-1929). Toni O'Swald, die am Rondeel 6 wohnte, schrieb Kinderbücher, so z. B. das Buch "In der Dämmerung - zehn Erzählungen für unsre liebe Jugend" (1920) und Lust- und Märchenspiele. Das Thalia Theater führte 1902 den "Wohltätigkeitskuß" auf, ein von Toni O'Swald geschriebenes Lustspiel. Das von ihr verfasste Märchenspiel "Die Wunderquelle - ein Märchenspiel in 4 Bildern" mit der Musik von Oskar Fetras wurde am 27.11.1900 in den Sagebiel'schen Sälen in Hamburg zugunsten des "Verandes Hamburger Mädchenhorte" erstaufgeführt.
|
Toni O'Swald war aktiv in der Hamburgischen Frauenhilfe 1923. Die Hamburgische Frauenhilfe gründete sich im Winter 1923/24 zur Zeit des Höhepunktes der Inflation. Der Stadtbund Hamburgischer Frauenvereine rief zur Gründung solch eines Vereins auf. In 21 Bezirken der Stadt wurden 47 Bezirksgeschäftsstellen errichtet, von denen 20 für die Erwachsenenfürsorge und 27 für die Kinderfürsorge arbeiteten. Die Tätigkeit war rein ehrenamtlich. Geholfen wurde mit: Kleidung,, Lebensmitten, Beratung, Miet- und Gasbeihilfen, Bezahlung von Entbindungen, und Krankenhausrechnungene etc. Die Hamburgische Frauenhilfe unterhielt Tagesräume für obdachlose Frauen in der. Böhmckenstaße und Rentzelstraße sowie , Nähstuben.
Text: Rita Bake
|
|
 |
 |
 |
| Charlotte Paulsen, geb. Thornton |
 |
 |
| 4.11.1797 Hamburg - 15.11.1862 Hamburg (auf dem Grabstein stehen falsche Daten) |
| Mitbegründerin der Bewahranstalt für Kinder, Mitbegründerin des Frauenvereins zur Unterstützung der Armenpflege |
Ohlsdorfer Friedhof, Heckengartenmuseum
Charlotte Thornton kam aus einer reichen Bankiersfamilie und war das vierte von vierzehn Kindern aus der zweiten Ehe ihres Vaters, des Engländers John Thornton. Die Familie lebte in einem Landhaus in Othmarschen. Charlotte wurde von Gouveranten in Französisch, Englisch, Tanzen, Klavierspielen unterrichtet und erhielt den letzten Schliff in gesellschaftliche Umgangsformen.
Als Charlotte 15 Jahre alt war, verliebte sie sich in einen schmucken, in russischen Diensten stehenden Soldaten, der, weil seine Armee Hamburg von der französischen Herrschaft befreit hatte, bei der Familie Thornton wohnte.
|
Es folgte eine rasche Verlobung, aber ebenso schnell auch die Entlobung, da der Vater den Bräutigam für einen Hallodri hielt. Als kurze Zeit später die Franzosen erneut in Hamburg einzogen, floh die Familie Thornton nach London. Der Bankier John Thornton war in Hamburg der Hauptagent Englands und wurde von Napoleon, der mit England um den Markt in Norddeutschland kämpfte, als Gegner verfolgt. Als Hamburg 1814 endgültig von der französischen Herrschaft befreit wurde, kehrte die Familie nach Hamburg zurück. Sie hatte den größten Teil ihres Vermögens verloren, und so galt es nun, die Kinder so gut wie möglich zu versorgen. Im selben Jahr verheiratete John Thornton seine Tochter mit dem zwanzig Jahre älteren Makler Paulsen. Es handelte sich dabei keineswegs um eine Liebesheirat. Beide gingen eine Konvenienzehe ein. Paulsen: "ein stiller redlicher Mann, der seine bequeme Existenz hatte, und in früheren Jahren auch wohlhabend gewesen sein mag, aber nie zu den Matadoren der Börse gehörte", wie eine Hamburger Zeitung in einem Artikel über Charlotte Paulsen schrieb, bot seiner jungen Frau materielle Sicherheit. Die beiden wurden Eltern einer Tochter und nannten sie Elisabeth. Sie übernahm nach dem Tod der Mutter deren Lebenswerk und wurde Leiterin der von der Mutter gegründeten Bewahranstalt für Kinder. Charlotte ermöglichte ihrer Tochter eine gute Bildung und lernte dabei gleichzeitig selbst viel Neues kennen. Sie beschäftigte sich mit Literatur, lernte aber auch Nähen und Stopfen und lebte das gesellige Leben ihrer Jugend mit Theater, Tanz und Spiel weiter.
Elisabeth heiratete früh, Charlotte wurde ebenso früh Großmama und hatte nun viel Leid zu tragen: einige ihrer Enkel starben, und auch ihr Schwiegersohn, ein den modernen demokratischen Ideen verbundener Apotheker aus Oldesloe, starb früh.
Nach diesen Schicksalsschlägen empfand Charlotte Paulsen das Leben einer priviligierten "Dame von Welt" als immer unbefriedigender. Sie suchte eine sinnvolle Betätigung und adoptierte ein Kind: Marie Paulsen. Außerdem nahm sie 1844 Kontakt zu der in der Armenpflege tätigen Amalie Sieveking auf, die jedoch Charlotte Paulsen als viel zu freisinnig empfand: "Eine Freidenkerin, die rationalistischen Ideen anhing, die nicht an erster Stelle die Armen auf den christlichen Glauben verpflichten, sondern ihnen auf gleicher Ebene begegnen wollte, war für den christlichen Verein als Mitarbeiterin unannehmbar." 1
Über die Loge "Zur Brudertreue", die 1846 in Billwerder eine konfessionell ungebundene, nur auf humanitären Grundsätzen basierende Erziehungsanstalt für gefährdete Jungen und Mädchen gegründet hatte, kam Charlotte Paulsen zu der dieser Loge nahestehenden Deutschkatholischen Gemeinde und zum Frauenverein zur Unterstützung der Deutschkatholiken. In diesem Frauenverein lernte Charlotte Paulsen Emilie Wüstenfeld, Bertha Traun, Amalie Westendarp und Johanna Goldschmidt kennen.
Mit Emilie Wüstenfeld gründete Charlotte Paulsen im März 1849 den Frauenverein zur Unterstützung der Armenpflege. Amalie Sieveking sah in dieser neuen Vereinigung ein Konkurrenzunternehmen. Sie warf Charlotte Paulsen "Unsittlichkeit" vor und forderte, daß die "Ungläubigen" sich vom Geschäft der Armenpflege fernhielten. Als "ungläubig" galten in Frau Sievekings Augen all jene, die sich nicht dem Frömmigkeitsgebot der beiden großen Konfessionen beugten. Amalie Sieveking verlangte von ihren Mitarbeiterinnen Dienstbereitschaft, Demut und Unterwerfung und von ihren "Schutzbefohlenen" ständige Frömmigkeitsnachweise. Wer dem nicht nachkam, erhielt keine Unterstützung. Von einer Selbstbestimmung des Menschen, besonders wenn Frauen dies forderten, wollte sie nichts wissen. Als die 48er Revolution ausbrach, befürchtete sie eine Rebellion ihrer Schützlinge gegen den nach Amalie Sievekings Auffassung gottgewollten Stand der Armut. Frau Paulsen hingegen verteidigte die Menschenwürde der Armen, denn sie war zu der Erkenntnis gelangt, daß die meisten Menschen unverschuldet in Armut gerieten.
In Charlotte Paulsens und Emilie Wüstenfelds neuem Verein wurden: "Kranke und Wöchnerinnen mit Suppe versorgt, arbeitslosen Familienvätern Anstellungen verschafft, konfirmierte Mädchen in Dienste vermittelt oder im Schneidern unterrichtet, Kinder bekleidet und/oder gebadet und in Warteschulen gebracht, Pflegebedürftige auf dem Lande untergebracht, in einzelnen Fällen auch Miete bezahlt. ... Manchem in wilder Ehe lebenden Paar wurde das Geld für die Erwerbung des Bürgerrechts gegeben, ohne das die Eheschließung nicht möglich war". 2
Die Gelder für ihre Unternehmungen holte sich Charlotte Paulsen von Hamburgs Bürgern. Die Presse erinnerte ein Jahr nach Charlottes Tod: "Sie klopfte an unzählige Thüren, um zu bitten ... . Sie warb unter den Frauen Hamburgs neue Mitglieder oder Gönner des Vereins; sie ging an die Comptoire der Kaufherren, um Beiträge für milde Zwecke zu sammeln. Obwohl viele Hamburger Bürger ihr Geld gaben, so ganz geheuer war sie ihnen nicht mit ihren demokratischen Ideen aus der 48er Revolution. Sie war den Hamburgern der guten Gesellschaft unbequem. Der Kaufherr läßt sich überhaupt ungern stören, wenn er hinter seinem Geschäftspult sitzt, zumal von einer Dame, die er unmöglich so sans facon abfertigen kann wie einen Handwerksburschen. Die Meisten fanden die Art der Frau Paulsen unweiblich; Andere fürchteten deren Einfluß auf ihre eigenen Frauen, welche sie um keinen Preis in so mancherlei freisinnige Bestrebungen gezogen wissen wollten."
Aber Charlotte Paulsen ging ihren Weg unbeirrt weiter. 1849 richtete der Frauenverein für Kinder erwerbstätiger Mütter aus der Unterschicht eine Bewahranstalt ein. Hier sollten die Kinder liebevoll betreut und nicht, wie es in den fünf in Hamburg bestehenden Warteschulen der Fall war, lediglich "abgestellt" werden. 1854 zählte die Bewahranstalt bereits 70 Kinder, 1866 stieg die Zahl auf 160 Kinder. Leiterin dieses, wie wir heute sagen würden, Kindertagesheimes, wurde 1851 die von Friedrich Fröbel ausgebildete Minna Seemeyer.
Aber was sollte mit den Kindern geschehen, wenn sie dem Alter der Warteschule entwachsen waren? Eine allgemeine Schulpflicht gab es nicht, und die wenigen Armenschulen waren überfüllt. Viele Kinder blieben deshalb ohne jeden Unterricht und wurden schon früh zum Mitverdienen herangezogen. Um diesen Mißständen abzuhelfen, nahm Charlotte Paulsen die Idee einer vereinseigenen Armenschule, die ihr von den Lehrerinnen und gleichzeitigen Mitgliedern des Frauenvereins, der Jüdin Johanna Goldschmidt und der Christin Amalie Westendarp, unterbreitet worden war, begeistert auf. Die beiden Lehrerinnen hatten bereits privat bei sich zu Hause begonnen, einzelne arme Kinder regelmäßig zu unterrichten. Solange die Gruppe nicht mehr als 12 Schüler und Schülerinnen umfaßte, brauchte man für den Unterricht keine Konzession. Als jedoch aus diesen ersten Schulversuchen, die Armenschule des Frauenvereins gegründet wurde, Johanna Goldschmidt und Amalie Westendarp den ersten Kurs mit 20 Kindern starteten und die Anzahl der Kinder immer größer wurde, kam 1851 das behördliche "Aus" für die Schule. Die Frauen nahmen dieses Verbot nicht widerstandslos hin. Drei Familien erklärten sich bereit, in ihrer Wohnung Platz für die Gruppen zu schaffen. Der Senat verbot jedoch auch diese Kurse, denn er sah in ihnen eine bloße Fortsetzung der verbotenen Schule. Dabei berief er sich auf ein Gesetz von 1732, wonach nur Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten durften. Der wahre Verbotsgrund war jedoch ein politischer. Die freisinnige, nichtkofessionelle Richtung des Vereins paßte der Regierung nicht. Sie mißbilligte, daß in der Schule kein Religionsunterricht erteilt wurde. Denn die konservative politische Haltung der Regierung wurde von der evangelischen und katholischen Kirche unterstützt. Das Grundprinzip des Frauenvereins war aber gerade die konfessionelle Unabhängigkeit, so daß in den Klassen auch Kinder verschiedener Religionszugehörigkeit, auch israelitischer, zusammengefaßt werden konnten.
Charlotte Paulsen wurde als Repräsentantin des Armenvereins polizeilich verhört. All ihre Überzeugungsarbeit vor den Behördenvertretern half nichts. Der Armenverein mußte seine Unterrichtskurse aufgeben. Aber die Frauen resignierten nicht. Sie fanden eine Lehrerin, die die erforderliche Konzession besaß und sie dem Verein zur Verfügung stellte. Dadurch konnte die Schule neu eröffnet werden, was 1856 mit sechzig Kindern an der Hohen Fuhlentwiete 91 dann auch geschah.
In den nächsten Jahren kümmerte sich Charlotte Paulsen darum, die Bewahranstalt und die Armenschule unter einem Dach zu vereinen und ihren Gesinnungsgenossen, die aufgrund ihrer politischen Überzeugung von der Polizei verfolgt und inhaftiert worden waren, zur Flucht zu verhelfen oder im Gefängnis zu besuchen. Finanziell hatte Charlotte Paulsen jetzt große Sorgen. Denn nachdem 1855 ihr Mann gestorben war, waren Charlotte Paulsens finanzielle Mittel erschöpft. Sie lebte einige Zeit im Haus der Bewahranstalt am Holländischen Brook, mitten unten den Kindern. Dann zog sie in eine kleine Wohnung an der Mundsburg. "Man sah sie im einfachen schwarzwollenden Kleid mit einem altmodischen Hut zu allen Tageszeiten unterwegs im Regen, Wind und Schnee. Ihre Wege galten meistens den Armen, die sie in Gängen und Höfen aufsuchte. Sie trug meistens einen Beutel am Arm, der den mannigfachsten Inhalt barg, Geschenke für die Armen, Predigten, Subskriptionsbögen, Lose ...", schrieb die Presse zu ihrem Tode.
Text: Rita Bake
Quellen:
1) Inge Grolle: "Auch Frauen seien zulässig". Die Frauensäule im Hamburger Rathaus. Erscheint 1997 als Aufsatz in dem von der Landeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Publikation: "Auf den zweiten Blick" zum 100. Geburtstag des Hamburger Rathauses.
2) Marie Kortmann: Emilie Wüstenfeld. Eine Hamburger Bürgerin. Hamburg 1927.
Vgl.: Inge Grolle: Die Schule des Paulsen-Stifts - ein Denkmal für Charlotte Paulsen - ein Erbe der Frauenbewegung. In: Charlotte Paulsen Gymnasium, Hamburg Wandsbek, 125 Jahre Schule des Paulsen-Stifts, 75 Jahre Lyzeum Wandsbek. Hamburg 1991.
|
|
 |
 |
 |

Bild aus: Peter Berglar: Matthias Claudius in selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek b. Hamburg 1992. |
 |
Caroline Perthes, geb. Claudius |
| 7.2.1774 Wandsbek- 28.8.1821 Hamburg |
| Tochter des Dichters Matthias Claudius und Ehefrau des Buchhändlers und Verlegers Friedrich Perthes |
Althamburgischer Gedächtnisfriedhof: Grabplatte "Herausragende Frauen"
Perthesweg, Hamm (1929), benannt nach Friedrich Christoph Perthes (1772-1843);
Rebecca und Matthias Claudius' Tochter Caroline (1774-1821) war mit dem Buchhändler Friedrich Perthes verheiratet, der 1796 zusammen mit zwei Gesellschaftern eine Sortimentsbuchhandlung gegründet hatte. Hier hatte er den Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi kennen gelernt, der ihn mit dem Dichter Mathias Claudius bekannt machte, in dessen Tochter Caroline sich Friedrich Perthes verliebte.
1797 hatte der damals 25-jährige Friedrich Perthes um ihre Hand angehalten. Mathias Claudius fiel es - wie so vielen Vätern - schwer, seine Tochter aus der eigenen Obhut zu entlassen. Außerdem schmerzte es ihn, dass die Tochter einen jungen, unerfahren Mann mehr liebte als den Vater. Doch 1797 war Hochzeit.
|
Am Tage zuvor schrieb Caroline dem Bräutigam: "Wir wollen Gott nach alter Weise um seinen Segen bitten, und er wird uns nach alter Weise segnen. Ach, lieber Perthes, tue es doch mit mir: ich bin so lebendig überzeugt, daß an Gottes Segen alles gelegen ist, wenn wir mit und durch einander glücklich werden wollen und unser Glück bestehen soll. Alles andere verläßt uns gewiß wieder früher oder später und kann nicht Stich halten. Du lieber Herzens-Perthes! Mach die Arme weit auf und halte mich fest, bis Du mein Auge zudrückst; ich bin Dein mit Leib und Seele und vertraue Gott, daß ich mich wohl dabei befinden werde." (Brief vom 1. August 1797). 1) Das Paar bekam neun Kinder, eines starb im Kindesalter.
In Wandsbeck hatte Caroline ein nach innen gekehrtes Leben in stillem Gottvertrauen geführt. Mit Perthes bekam sie einen Ehemann, der mit großer Leidenschaft an allen geistigen und politischen Auseinandersetzungen seiner Zeit Anteil nahm, was auch bedeutete, dass er nur wenig Zeit für seine Frau und auch Kinder erübrigte. In einer Biographie über Friedrich und Caroline Perthes aus dem Jahre 1900 heißt es dazu: "So schmerzlich Caroline es auch immer wieder empfand, daß Perthes ihr bei aller Liebe so wenig Zeit widmen konnte, wurde ihr das Vorrecht der Frau, ihr ganzes Leben auf ihre Liebe beziehen zu dürfen, nicht zur Klippe ihres Eheglücks: sie verlangte vom Manne nicht das Gleiche. Sie war zu klug und zu wahrhaftig in ihrer Liebe, um die kurzen Stunden des Zusammenseins durch nutzlose Klagen und schmollendes Zürnen zu verbittern. Sie blieb im täglichen Verkehr immer liebevoll, nachgiebig und freundlich. Stimmungen und Launen lagen ihr völlig fern, sie verstand es, ohne jede Stockung und Erkaltung Liebe zu leben." 2)
Caroline Perthes hatte eine Scheu vor Berührung mit der Welt, war leicht verwundbar und beunruhigt durch äußere Verhältnisse. Perthes wandte ein, daß ein Leben allein in Gott, unberührt von Schmerz und Unruhe, ein kaltes Leben sei, bestärkte sie aber zugleich in ihrer Art. Im Sommer 1799 schrieb er: "Glaube mir, glaube mir, Du mein guter Engel, ich fühle es, daß Du viel hast, und laß Dich nicht stören. O unser Vater hatte sehr Recht, Euch Kinder von der Richtung aufs Wirken und Handeln und auf das Kunstwesen zurückzuhalten. Selbst wenn er zu weit hierin gegangen wäre, selbst wenn er Euch ungeschickt gemacht hätte zum Handeln und Schaffen im Leben, ja selbst wenn ihr der Welt eine Thorheit werden solltet, so habt ihr dennoch in Euch den geist der Liebe, und der Geist der Liebe ist lebendig." 3) Perthes Brief waren voll glühender Leidenschaft und Anerkennung des ihm noch fehlenden inneren Lebens.
Caroline ihrerseits erhielt bald Gelegenheit, sich auch im äußeren Leben zu bewähren. 1798 waren die Gesellschafter ihres Mannes aus der Handlung ausgeschieden, weil ihnen der Gewinn zu gering erschien. Mit viel Fleiß und Geschick brachte Perthes die Handlung trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit dem neuen Partner Johann Heinrich Besser zur Blühte und Ansehen. Sie galt bald als eine der bedeutendsten im Norden Deutschlands. Im Herbst 1805 kaufte man das Axensche Haus am Jungfernstieg, wo Familie, Geschäft, Lager, Gehilfen und die befreundete Familie von Axen untergebracht wurden.
Der durch den Einfluss ihres Mannes vielfach wechselnde Verkehr mit den verschiedenartigsten Menschen und die wachsende Familie, stellten an Caroline große Ansprüche. Sie lernte "sich freien Geistes im Leben zu bewegen und mitten im Wechsel äußerer Umstände innere Stille und Gleichmäßigkeit zu bewahren." 4)
Das Jahr 1813 brachte für Caroline schmerzlichste Begegnungen mit der Außenwelt. Hamburg war seit 1806 von den Franzosen besetzt. Nun, 1813, mit der Niederlage der Franzosen in Russland schien der Zeitpunkt der Befreiung Hamburgs von den Franzosen gekommen zu sein. Freudig begrüßten die Hamburger den russischen Oberst Tettenborn, als er mit seinen Kosaken in Hamburg einzog. Da die Hamburger aber die Rückkehr der vertriebenen Franzosen befürchteten, gründeten sie eine Bürgergarde, an deren Spitze Perthes trat. Die Franzosen kamen tatsächlich wieder nach Hamburg. Während Perthes Tag und Nacht kämpfte und die Bürger motivierte, versuchte Caroline zu Hause die Not zu lindern. "Ich hatte keinen Mann mehr im Hause, alle waren auf den Wachen. Immer aber gingen Leute aus und ein, die essen und trinken wollten; denn keiner unserer Bekannten hatte in der Stadt noch eine Haushaltung. Unsere große Stube hatte ich mit Strohsäcken belegt, auf denen bei Tag und Nacht Bürger lagen, die sich ausruhen wollten." 5) Erst als die Lage fast hoffnungslos war, floh Caroline am 28. Mai 1813 mit ihren damals sieben Kindern und ihrer Amme nach Wandsbeck. Doch auch von hier mussten sie fliehen, nachdem Tettenborn die Stadt verlassen hatte und die Franzosen kurz vor Wandsbeck standen. Perthes beschwor die Familie, nach Nütschau, dem Gut seines Freundes Moltke, zu gehen, und floh selbst in die Nacht hinein.
Die schwangere Caroline packte noch in derselben Nacht und machte sich am Morgen mit ihren sieben Kindern und der Amme auf den Weg. Die Schwester Auguste begleitete sie. Als Perthes in Nütschau zu ihnen stieß, erreichte sie die Nachricht, dass das Haus am Jungfernstieg durchsucht worden sei. Nütschau war zu nahe, man musste weiter fliehen, fand auf dem bei Eckernförde gelegenen Gut Altenhof bei dem grafen Reventlow freundliche Aufnahme. Der Graf stellte der Familie Perthes sein einsam an der Ostsee gelegenes Gartenhaus in Aschau zur Verfügung.
Die Perthes hatten zwar alles verloren, was sie besaßen, die Handlung war versiegelt, das Vermögen beschlagnahmt, die Wohnung von einem französischen General bewohnt, aber für eine kurze Zeit waren sie glücklich, wieder zusammen zu sein. Dann musste Perthes weiter. Die dänische Regierung hatte erklärt, ihn nicht schützen zu können, wenn die Franzosen seine Auslieferung fordern sollten. Zudem musste er sich um den Unterhalt der Familie kümmern. Am 9. Juli 1813 nahm er Abschied und reiste nach Mecklenburg, wo er sich erneut in das Kriegsgewirr mischte. Caroline blieb unter den eingeschränktesten Verhältnissen mit den Kindern zurück.
Das Gartenhaus brachte in dem feuchten Sommer ihr und den Kindern Erkältungen und Krankheiten. Dazu kam die ständige Sorge um Perthes, von dem nur unregelmäßig Nachricht kam, und die Angst, die bevorstehende Entbindung nicht zu überleben und die Kinder unversorgt zurückzulassen. Die Bedrängnis wurde ein wenig gemildert durch die Schwester, die Caroline hilfreich zur Seite stand, die Familien der Grafen Reventlow und Stolberg und durch die Freude an den Kindern: "Ich habe es in der Wahrheit erfahren, daß Gott uns nichts Größeres geben kann in Freud und Leid als ein liebhabendes und geliebtes Kind. Nichts kann uns das Herz so erquicken, aufrichten und beschämen. Das hab eich hundertmal erfahren, und ich glaube kaum, daß ich Herr geblieben wäre, wenn Gott mir nicht meinen Engels-Bernhard und in ihm das lebendige Bild der kindlichen Liebe und des kindlichen Vertrauens gegeben hätte. Wenn ich versunken war in Angst und Sorge um Perthes und in den Jammer. Meine acht Kinder ohne Vaterrath und Vaterliebe ihren Weg durch das Leben anfangen zu sehen, so war ich oftmals in Gram zu verzagen. Wenn ich dann aber meinen lieben Bernhard in meine Arme schloß und ihm in sein helles Kinderauge sah und gewahr ward, wie er sich um nichts bekümmerte und für nichts fürchtete, sondern nur freundlich war und mich lieb hatte, so fand auch ich meinen Haltpunkt wieder und bat Gott, mich werden zu lassen, wie mein liebes Kind." 6)
Doch solchen Augenblicken folgten immer wieder Stunden tiefster Angst und Not, die Caroline mit großer Kraft und Souveränität bewältigte. Nachdem sie einmal Perthes ihre und ihrer Kinder Lage ausführlich geschildert hatte, fügte sie hinzu: "ich musste Dir Alles sagen, damit Du die Wahrheit weißt thun kannst, was recht ist; aber ich sage Dir es nicht, um Dich zur Rückkehr zu bewegen. Gott den Herrn, der mir mehr ist als Du, nehme ich zum Zeugen, daß ich nicht will, was Du nicht darfst." 7)
Im September 1813 zog Caroline mit den Kindern nach Kiel, wo Graf Moltke der Familie einige Zimmer überließ, die er selbst bei längeren Aufenthalten in Kiel bewohnte. Hier in der Stadt hatte Caroline für die Entbindung ärztlichen Beistand, Freunde und Verwandte. Am 16. Dezember wurde der Sohn Andreas geboren. Am 1. Weihnachtfeiertag kam Perthes, der in großer Sorge um seine Familie war, weil sich das Kriegsgeschehen inzwischen auf Schleswig-Holstein ausgedehnt hatte. Caroline schrieb später dazu: "Den ersten Weihnachtstag des Abends im Halbdunkel kam Perthes unerwartet. Matthias sah ihn zuerst. Er hatte in Lübeck meine Niederkunft erfahren. Ich konnte ihm alle Kinder gesund übergeben und noch einen lieben gesunden Jungen oben im Kauf. Was das war, weiß auch niemand, als der es erfahren hat." (Brief vom 29. April 1815). 8)
Wenige Tage später erhielt Perthes vom Generalstab des Kronprinzen von Schweden den Auftrag, zusammen mit zwei anderen Männern die Verwaltung und Verwendung der Gelder zu übernehmen, die der Kronprinz für die aus Hamburg Vertriebenen bewilligt hatte. Am 1. Januar 1814 reiste er ins Hauptquartier nach Pinneberg. Caroline war wieder allein. Alleine musste sie auch die Krankheit und den Tod des geliebten Sohnes Bernhard durchstehen. Er starb am 19. Januar 1814. Als Perthes, den Carolines Nachricht nicht erreicht hatte, am 21. Januar unerwartet und mit banger Sorge ins Zimmer trat mit den Worten: "Sind alle wohl?", erfuhr er die bittere Wahrheit. Wenige Stunden danach erhielt er vom schwedischen Kronprinzen die Aufforderung, nach Pinneberg zu gehen. Caroline redete ihm zu: "Wenn Du in dieser Zeit und in solchen Verhältnissen gerufen wirst, so mußt Du folgen." 9) Perthes fühlte sich aber außerstande, er reiste erst am 27. Januar ab. Von ihr, die ursprünglich so ganz in ihrer Innerlichkeit gelebt hatte, stellte Perthes fest: "Carolines Heldenmuth war größer als meine Kraft." 10)
Obwohl die Gefahr keineswegs vorüber war, machte sich Caroline aus der Überzeugung heraus, "nicht länger auseinander sein" zu können (Brief vom 11. November 1816), 11) am 20. April mit den Kindern auf den Weg nach Blankenese, von wo die Familie nach einjähriger Abwesenheit am 31. Mai 1814 nach Hamburg zurückkehrte. "Diese sechs Wochen in Blankenese", schrieb Caroline an ihre Schwester Anna Jacobi, "sind der Konfekt meines Lebens gewesen. Gern gebe ich Ruch einen lebendigen Brocken davon, liebe Anna, lieber Max! Die Hoffnung auf die Befreiung unserer Stadt wurde mit jedem Tage größer, und mit einem Male wehten die weißen Fahnen am Michaelisturm und in Hamburg. Nun war auch Deich und Damm gebrochen, und von allen Seiten strömten die Vertriebenen wieder der Stadt zu. Wir wohnten dicht an der Elbe, konnten also, die von Bremen und aus dem Hannöverschen zurückkamen, ankommen sehen. Ganze Herden von armen Ausgehungerten, mit Kindern und Lumpen Bepackten zogen an unserem Fenster vorbei, und wunderbar groß und rührend war die Liebe zu Haus und Herd sichtbar, obgleich die meisten nur Jammer und Elend zu erwarten hatten. Sowie sie an Land stiegen, brachen sie Zweige von den Bäumen, und Alt und Jung bis auf die kleinsten Kinder herunter, die nur einen halben halten konnten, bekamen einen Busch in die Hand und dankten Gott unter Freuden- und Trauergeschrei und Tränen für die Erlösung des großen und allgemeinen Übels, wohl wissend, daß ein jeder seinen Privatpack mit hereintrüge. Endlos sind die Erfahrungen, die diese armen, unglücklichen Menschen gemacht haben während der Flucht. Einmal wurde uns ein ganzer Wagen voll kleiner und großer Kinder geschickt, deren Eltern im Krankenhaus in Bremen gestorben waren. Ich machte schnell warme Suppe für sie, aber einige waren so bewegt von dem Jammer, der gewesen war und kommen würde, daß sie nicht einmal essen wollten. Doch ich wollte Euch ja nur Freude erzählen, und da habe ich die Fülle im Ganzen und auch für uns." (Brief vom 11. November 1816). 12)
Als Caroline wieder zurück in ihr Haus am Jungfernstieg zog, fand sie es in einem desolaten Zustand vor. Caroline setzte alle Kraft daran, ihr Heim wieder bewohnbar zu machen. Doch ihre Gesundheit war seit dem Schreckensjahr 1813 schwer angegriffen. Sie litt an einem Herz- und Nervenleiden, dennoch nahm sie ihren todkranken Vater auf und pflegte ihn bis zuletzt. "Der Tod des Vaters riß in Carolines Leben eine tiefe Lücke, denn sie hatte seit ihrer ersten Kindheit zu ihm in der denkbar innigsten Beziehung gestanden. Er hatte immer Zeit und Neigung gehabt, sich um ihr Eigenstes und Persönlichstes zu bekümmern, auch als ich schon verheiratet war; er hatte immer ein Ohr gehabt für das Echtweibliche in ihrer Natur, das der Anlehnung und der Mitteilung bedurfte, um nicht zu verkümmern. Mit diesem innersten Bedürfnis ihrer Seele war ich nun ganz auf Perthes gewiesen," 13) heißt es in dem 1900 verfassten Porträt über Caroline Perthes. Doch" "der großartige Geschäftsbetrieb ließ wenig Stunden für die Familie übrig." 14) Und so offenbarte Caroline verzagt und doch mutig zugleich ihren Mann, der sich auf Geschäftsreise befand, in einem Brief ihre Gefühlslage: "Du hast Dir zwar alle Empfindung für dieses Jahr Deiner vielen Geschäfte wegen verbeten, aber ich bin eine Person, die nicht ohne Empfindung schreiben kann, wenn sie an Dich schreibt; denn ich empfinde mein alles, wenn ich an Dich denke (…). Im vorigen Jahre versprachst Du mir (…) sehr ernsthaft viel Freudenstunden, wenigstens im Zusammenleben mit Dir; solche Freudenstunden sind mir noch nicht viele geworden, und Du bist sie mir wahr und wahrhaftig schuldig." 15) Perthes antwortete: "Du schreibst, ich hätte mir für dieses Jahr alle Empfindung verbeten. Das, mein liebes Herz, ist wohl nicht so. wenigstens etwas anders: ich meine, wenn durch vieljähriges Miteinandersein der Gefühls-, Empfindungs- und Gedankenwechsel und Austausch so innig (…) geworden ist, dass man sich vollkommen versteht, kann von Zärtlichkeitsäußerungen, die immer ein noch Interessantes und darum Fremdes gegenüber voraussetzen, nicht mehr die Rede sein. Sei Du nur zufrieden mit mir, mein liebes Kind, wir verstehen uns doch! Die Jugend hat ihre Art und die späteren Jahre auch. Es würde doch wirklich lächerlich sein, wenn ich jetzt wie vor 20 Jahren im Mondschein die Bäume und Wolken für Mädchen oder die Mädchen als Engel ansehen wollte, und besser würde es sich auch nicht ausnehmen wollen, wenn Du (…) auf Bäume klettern wolltest. Hadern dürfen wir doch nicht darüber, dass wir älter werden, sei also nur zufrieden (…) und mit mir habe Nachsicht und Geduld." 16)
Carolines Herzleiden und die Reizbarkeit ihrer Nerven steigerten sich mehr und mehr und machten ihr die häusliche Arbeit sehr mühsam. Am 28. August 1821 starb sie im Alter von 47 Jahren an einem Schlaganfall. Nun wurde es Perthes schmerzlich bewusst, was er an seiner Frau gehabt hatte und schrieb in verschiedenen Briefen an seine Kinder: "Nun stehe ich da mit meinen armen Kindern, und öde und leer ist es." "Sie hat es nicht gewusst, wie sehr ich von ihr abhängig war, sie hat es nicht im einzelnen erkannt, sondern nur allgemein an der Innigkeit ihrer Liebe zu mir gefühlt, welche Opfer ich meiner Natur und meinem Temperament nach dieser Abhängigkeit in Liebe gebracht habe. Jetzt ist das alles fort, kein Band bindet mich; ich kann thun, was ich will. Nächst der Sehnsucht in dem Alleinsein drückt mich dieses widrige Gefühl der Freiheit am meisten." 17)
Nach Carolines Tod zog Perthes 1822 mit seinen vier noch unmündigen Kindern nach Gotha zu seiner dort verheirateten Tochter. Drei Jahre später heiratete er die verwitwete Charlotte Hornbostel, mit der er vier Kinder bekam. In Gotha baute er einen neuen Verlag auf. Die Buchhandlung in Hamburg ging mit dem endgültigen Austritt Friedrich Perthes im Jahre 1836 an die Erben seines Kompagnons Johann Heinrich Besser und firmierte fortan unter dem Namen "Perthes-Besser und Mauke". Friedrich Perthes starb am 18. Mai 1843 in Gotha im Alter von 71 Jahren.
Text: Brita Reimers
Quellen:
1) Rudolf Kayser (Hrsg.): Karoline Perthes im Briefwechsel mit ihrer Familie und ihren Freunden. Hamburg 1926.
2) Clemens Theodor Perthes: Friedrich Perthes' Leben nach dessen schriftlichen und mündlichen Mittheilungen. Bd. 1. 6. Aufl. Gotha 1872.
3) Clemens Theodor Perthes, a. a. O.
4) Clemens Thedor Perthes, a. a.O.
5) Ottilie Adler: Friedrich und Caroline Perthes. Leipzig 1900, S. 65.
6) Clemens Theodor Perthes, a. a. O.
7) Clemens Theodor Perthes, a. a. O.
8) Rudolf Kaysr (Hrsg.): Karoline Perthes im Briefwechsel mit ihrer Familie und ihren Freunden. Hamburg 1928.
9) Clemens Theodor Perthes, a. a. O.
10) Clemens Theodor Perthes, a. a. O.
11) Rudolf Kayser, a. a. O.
12) Rudolf Kayser, a. a. O.
13) Ottilie Adler, a. a. O., S. 98.
14) Ottilie Adler, a. a. O., S. 140f.
15) Ottilie Adler, a. a. O., S. 142.
16) Ottilie Adler, a. a. O., S. 229ff.
17) Ebenda.
|
|
 |
 |
 |
| Marianne Prell |
 |
 |
| 20.7.1805 Hamburg - 27.8.1877 Hamburg |
| Erzieherin Hamburger Persönlichkeiten |
Althamburgischer Gedächnisfriedhof: Grabplatte "Pädagogen"
"Am 27. August entschlief sanft in ihrem 73. Lebensjahre unsere liebe Schwester Marianne Prell, auf's schmerzlichste vermißt von den ihrigen", so lautete im "Hamburgischen Correspondenten" vom 30.10.1877 die Todesanzeige für Marianne Prell. Einen Monat zuvor war am 1.7.1877 der Ohlsdorfer Friedhof eröffnet worden. Marianne Prell fand dort als eine der ersten ihre Ruhestätte.
Am 20. Juli 1805 wurde Marianne Prell in Hamburg als erstes von sieben Geschwistern geboren. Ihr Vater, Andreas Prell, war ein Lüneburger Kaufmann, der durch seine Ehe mit Anna Dorothea Moller seinen Sitz nach Hamburg verlegt hatte.
|
Während der französischen Besetzung kämpfte Andreas Prell von 1806 bis 1814 als Oberstleutnant in der Bürgerwehr erfolgreich in vorderster Front gegen Napoleons Truppen. Später wurde er Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft.
Mit 27 Jahren entschloss sich Marianne Prell mit ihrer jüngeren Schwester Franziska eine Elementarschule für Mädchen im elterlichen Hause in der Holländischen Reihe Nr. 19 zu eröffnen. Dazu schrieb die Malerin Marie Zacharias: "Es war ihre Absicht gewesen, eine Mädchenschule zu gründen, doch wurde eine Jungenschule daraus, in der aber die drei einzigen Mädchen Amanda Pietzker, Agnes Lenz und ich, die die Schule aufgetan hatten, noch lange beibehalten wurden. Ein fröhlicher gemütlicher Geist durchwehte das alte Haus an der Holländischen Reihe. Sorgen kannte man nicht, nur Vergnügen." 1
Ein weiterer Schüler von Marianne Prell war Paul Hertz, dem in seinen Erinnerungen nicht nur eine milde, sondern auch strenge, pädagogisch begabte Marianne Prell gegenwärtig war: "Marianne hatte geradezu großes pädagogisches Talent. Klug, energisch, praktisch, zur rechten Zeit strenge und zur rechten Zeit milde, beherrschte sie ihre Schule unbedingt. Marianne nicht zu gehorchen, ging einfach nicht an und fiel niemandem ein. Franziska war eine weichere Natur, die sich der Schwester willig unterordnete. Sie gewann sich die Liebe der kleinen Ankömmlinge sofort und war deshalb besonders geeignet, die Kinderseelen vom Spiel zur Arbeit überzuleiten." 2
Wegen ihrer größeren Strenge führte Marianne die Oberaufsicht über die Schule. Ansonsten waren die Schwestern gleich ausgelastet: Marianne leitete die erste Klasse, gab Rechnen, Geographie, biblische- und Weltgeschichte. Franziska führte die zweite Klasse - mehr Klassen gab es nicht - und unterrichtete im Lesen und Schreiben. Jungen ab dem sechsten Lebensjahr besuchten für zwei bis drei Jahre diese Schule und erhielten täglich zwischen neun und fünfzehn Uhr fünf Stunden Unterricht und eine Stunde Exerzieren.
Mariannes erklärtes Ziel war es, ihre Schüler zu energischen patriotischen Männern zu erziehen. Denn Marianne entwickelte einen ausgeprägten Patriotismus: "Sie hatte mitgelitten, als die Stadt von den Franzosen unterjocht und jahrelang mißhandelt war, sie hatte mitgejubelt, als endlich die Befreiung kam," 3) erinnerte sich Paul Hertz. Und sie hatte miterlebt, wie ihr Vater gegen die Franzosen gekämpft hatte - das prägt. Der patriotische Einfluss zeigte sich im Fach "militärische Wissenschaft". Täglich zwischen 12 und ein Uhr mussten die Jungen, die alle eine Patronentasche und ein Gewehr besaßen, im Schulgarten exerzieren üben. In jedem Jahr bedeutete der 18. Oktober ein besonderer Höhepunkt im Fach Exerzieren: "Der größte Tag des Jahres war der achtzehnte Oktober, der Jahrestag der Schlacht bei Leipzig. Marianne richtete ihren Geschichtsunterricht so ein, daß einige Wochen vorher die Geschichte Napoleons an die Reihe kam. (...) Sie erzählte uns die ergreifende Geschichte der Knechtschaft und der ruhmvollen Wiedererhebung Deutschlands. Ihrer Methode nach schilderte sie besonders die Schicksale der Vaterstadt, viele persönliche Erlebnisse einflechtend. Wir hörten, wie es in ihrem eigenen Hause, in dem wir uns ja selbst befanden, hergegangen war. (...) Am achtzehnten Oktober selbst wurde eine große militärische Revue abgehalten. Wir teilten uns in zwei Parteien und manövrierten im ganzen Hause nach allen Regeln der Kriegskunst gegeneinander. Nachher aber zog die ganze Armee im Parademarsch in die große Schulstube ein. Dort saß dann der alte Oberstleutnant in einem Lehnstuhl und blies auf einem Kamm den Pariser Einzugsmarsch. (...) Wir waren unsagbar stolz darauf, daß der alte Held uns persönlich kommandierte (...). Schließlich präsentierten wir das Gewehr und sangen alle zusammen `Auf Hamburgs Wohlergehen`, während Marianne in kräftigen Akkorden auf dem Klavier begleitete und die Trommeln wirbelten," 4 schrieb Paul Hertz.
Auch Marie Zacharias konnte sich gut an den alten Major Prell erinnern, der bei seinen Töchtern im Schulhaus lebte: "Herr Prell war der Inbegriff alles Militärischen, und wenn wir zu Hause das Lied `Schier dreißig Jahre` sangen, so kam im vierten Vers anstatt `der Appell`, `der Herr Prell, der macht alles lebendig`." 5
Marianne Prells Patriotismus als Unterrichtsfach verschaffte der Schule den Ruf, eine der besten und vornehmsten Privatschulen zu sein, obwohl es 1833 bereits mehr als 200 verschiedene, mehr oder weniger gute Privatschulen in der Hansestadt Hamburg gab.
1863 gab Marianne Prell anonym ihre Kindheitserlebnisse unter der französischen Fremdherrschaft heraus. Der Titel ihres Buches lautete "Erinnerungen aus der Franzosenzeit in Hamburg von 1806-1814". Bis 1913 erschienen sieben Auflagen.
Die Schule, die in der Zwischenzeit zweimal verlegt worden war und sich zuletzt in der Kirchenallee Nr. 24 im Stadtteil St. Georg befand, schloss Ostern 1877. Wenige Monate später, am 27. August 1877, starb Marianne Prell im Alter von 73 Jahren. Als Erzieherinnen vieler berühmter Hamburger Männer des 19. Jahrhunderts finden sich ihr und der Name ihrer Schwester (gest. 1903) auf dem Althamburgischen Gedächtnisfriedhof.
Ihr Vater Johann Andreas Prell (1774-1848) ist auf dem Gedächtnisfriedhof auf der Grabplatte "Bürgermilitär" verewigt worden.
Text: Birgit Köhler
Quellen:
1) Marie Zacharias: Familien-, Stadt- und Kindergeschichten. Hamburg 1954.
2) Paul Hertz: Unser Elternhaus. Hamburg 1913.
3) ebenda.
4) ebenda.
5) Marie Zacharias, a. a. O.
|
|
 |
 |
 |

Bild aus: Gisela Jaacks: Gesichter und Persönlichkeiten. Bestandskatalog der Porträtsammlung im Museum für Hamburgische Geschichte. Hamburg 1992 |
 |
Toni Petersen |
| 23.3.1840 Hamburg - 20.9.1909 Hamburg |
| Kunstförderin, Wohltäterin |
Ohlsdorfer Friedhof, Grab Nr. AA 13, 1-12
Der Petersenkai, HafenCity (1889) ist nach ihrem Vater Dr. Carl Friedrich Petersen (1809-1892), Erster Bürgermeister benannt
Nach dem Tod seiner Frau Kathinka im Jahre 1863 führte seine Tochter Toni ihm den Haushalt. Als Antonie (Toni) Petersen zwischen 1876 und 1892 mit ihrem Vater, dem Bürgermeister Dr. Carl Friedrich Petersen in der Großen Theaterstraße 33 wohnte, konnte sie aus ihrem Fenster auf den Bühneneingang des Stadtheaters/Oper blicken. Ihr Wohnhaus steht nicht mehr. Toni Petersen war eine engagierte Kunstförderin und Wohltäterin. Sie leitete das Stadtteilbüro St. Pauli des 1899 gegründeten Hauspflegevereins und hielt für Hilfesuchende Sprechstunden ab.
Der Verein half besonders armen Familien, wenn die Hausfrau durch Wochenbett oder Krankheit ihren hausfraulichen Pflichten nicht nachkommen konnte. In solchen Fällen schickte er eine Pflegerin - meist eine ältere Frau "von gutem Ruf" - ins Haus, die nach dem Rechten sah. Toni Petersen war auch Mitglied der Ortsgruppe Hamburg
|
des 1900 gegründeten Deutsch-Evangelischen Frauenbundes (DEF), der Teil der bürgerlichen Frauenbewegung war und in dem eher die konservativen evangelischen Gesellschaftskreise Hamburgs vertreten waren. Der DEF kümmerte sich um die Armen und Schwachen. Ein Schwerpunkt war die Arbeiterinnenbetreuung. Hier verstand sich der DEF als Gegenpol zu der von der Sozialdemokratie getragenen Arbeiterinnenfürsorge. Die Helfenden legten großen Wert auf die Konfessionszugehörigkeit. Auch hatte ihre Klientel den sittlichen und moralischen Vorstellungen des DEF zu entsprechen.
Ob Toni Petersen sich aus gesellschaftlicher Opportunität der Wohltätigkeit widmete oder ob es ihr ein Herzensbedürfnis war - zumal sie selbst an einem körperlichen Handicap litt, was ihr vielleicht ein größeres Verständnis für Menschen, die am Rande der Gesellschaft standen, eröffnete - ist nicht mehr zu ermitteln. Die Presse jedenfalls würdigte anlässlich ihres Todes ihr karitatives Verhalten und lobte, dass Toni Petersen diese Tätigkeit still und bescheiden ausgeübt hatte - Attribute, die einer Frau in der damaligen Zeit auch in ihrer Ausübung auf den karitativen Gebiet gut zu Gesicht standen: "Fräulein Toni Petersen gehört zu der Gruppe der Elise Averdieck und der Caroline Wichern, obgleich ihr Wirken scheinbar noch stiller und unscheinbarer war, und obgleich sie ohne eigenen Beruf durch ein langes Mädchendasein schritt. Sie wetteiferte nicht mit den tüchtigsten Männern, aber sie stand ihnen treu zur Seite, und die Tüchtigen und Bedeutenden bekannten sich als ihre Schuldner. Eine solche Parteinahme setzt geistige Fähigkeiten voraus, und die Instinkte für heroisches über die Grenzen des Alltäglichen hinausgehendes Wollen. Es setzt Uneigennützigkeit und Opferwilligkeit voraus und Verständnis für die großern Ziele menschlicher Kulturbestrebungen. Von der Natur äußerlich stiefmütterlich behandelt, wurde sie dennoch keine Anklägerin ihres Geschicks, sondern eine unverbesserliche, stets hilfsbereite Optimistin. Ihr Name stand unter Aufrufen zu allen Sammlungen und Wohltätigkeitsfesten in den letzten Jahren mit an erster Stelle, und sie ließ es nicht bei der bloßen Namensunterschrift bewenden."
Seit ihrer Kindheit litt Toni Petersen an einem schmerzhaften Hüftleiden. Dennoch - oder gerade wegen dieses Handicaps und der damit in der damaligen Gesellschaft verbundenen geringeren Aussicht auf eine Heirat - war sie es, die als junges Mädchen nach dem Tod der Mutter die Hausfrauenrolle im Vaterhaus an der Elbchaussee übernahm. Später dann, nachdem ihr Bruder verwitwet war, übernahm sie auch in dessen Haushalt die Hausfrauenpflichten. Da die Petersens kunst- und musikliebend waren, richtete Toni Petersen oft Gesellschaften aus, zu denen z. B. Richard Wagner, Johannes Brahms und Hans von Bülow eingeladen wurden. Zu Richard wagner entwickelte sie eine besondere freundschaftliche Beziehung. Sie übernahm den Vertrieb von Patronatsscheinen und hafl damit dem Bayreuther Festspielunternehmen aus seinen finanziellen Schwierigkeiten. Richard Wagner dankte ihr später durch die Übersendung seiner Photographie mit folgender Widmung: "Richard Wagner, immer in Not und Sorgen, nur bei Toni Petersen wohl geborgen." Mit Richard Wagners Frau Cosima stand Toni Petersen lange Jahre im Briefwechsel, wurde von ihr sogar "Nichte" genannt.
Toni Petersen und Hans Bülow waren auch gern gesehene Gäste im Salon von Frau Lazarus, die gleich um die Ecke an der Esplanade 37 wohnte.
Neben Musikern verkehrte im Hause Petersen auch Fürst Bismarck, den Toni Petersen mit ihrer Familie manchmal in Friedrichsruh besuchte und den sie sehr verehrte. Deshalb ist sein Konterfei auch neben dem von Tonis Vater, Johannes Brahms und Hans von Bülow als Portraumedaillon unter dem von Julie de Boor (ihr Grabstein steht im Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof) gemalten Portrait von Toni Petersen abgebildet. Unter dem Bild steht geschrieben: Toni Petersen 1840-1909, Tochter des Bürgermeisters Dr. Carl Petersen 1809-1892. Repräsentantin seines gastfreien Hauses, in dem große Zeitgenossen gern verkehrten. Begeistert für alles Große, Gute und Schöne, unterstützte sie künstlerische und philantropische (!) Bestrebungen." Das Portrait befindet sich heute im Museum für Hamburgische Geschichte.
Ihrer Herkunft entsprechend war es selbstverständlich, dass Toni Petersen zusammen mit einem Damen-Comitee, dessen erste Vorsitzende sie war, dem neuen Rathaus zu seiner Eröffnung im Jahre 1897 ein Geschenk überreichte: Das Comitee stiftete dem Senat für dessen Ratsstube, in dem bis heute die wöchentlichen Senatssitzungen abgehalten werden, einen mit dem großen Hamburger Wappen bestickten Wandbehang, der noch heute unter dem Baldachin hängt, unter dem der Erste und Zweite Bürgermeister ihre Plätze haben. Auch die Bürgerschaft wurde nicht vergessen. Sie erhielt für den Bürgerschaftssaal einen bestickten Panneau für die Wand hinter dem Sitz des Bürgerschaftspräsidenten.
Als Toni Petersen starb, berichte die Hamburger Presse ausführlich über die Umstände ihres Todes. So schrieb das Hambruger Fremdenblatt: "Fräulein Toni Petersen, die Tochter des Bürgermeisters Petersen und Tante des Herrn Dr. Carl Petersen (Mitglied der Bürgerschaft), ist Montag nachmittag, als sie von einem Besuch bei ihrem Bruder, dem Direktor der Norddeutschen Bank, Rudolf Petersen, in der Parkstraße in Othmarschen zurückkehrte, in einem Wagen der Straßennbahn vom Schlage gerührt worde und verstorben. In hervorragender Weise hat sie die Wohltätigkeitsbestrebungen ihrer Vaterstadt Hamburg unterstützt. Ihre letzte Fahrt galt noch der Teilnahme an einer Wohltätigkeitssitzung."
Ein Jahr nach ihrem Tod gründeten Damen und Herren der Hamburger Gesellschaft die Toni-Petersen-Freibettenstiftung im Bad Oldesloer Auguste-Viktoria-Pflegeheim. Um dieses Unternehmen finanziell zu bewerkstelligen, gab es diverse Aufrufe in Hamburger Tageszeitungen. Die Institutionalisierung der Stiftung wurde zu einem gesellschaftlichen Ereignis - von einem stillen Agieren und von Bescheidenheit im Geben für die Armen - ist hier nichts zu spüren. Und so schrieben dann auch am 20. Juli 1910 die "Hamburger Nachrichten": "Im Auguste-Viktoria-Pflegeheim zu Oldesloe hatte sich am Montag eine Anzahl Festgäste eingefunden, um die dritte Freibettenstiftung des Hauses einzuweihen. Über jedem dieser freibetten ist eine Metalltafel mit dem Namen des Stifters bzw. der Stifterin angebracht. Die Anbringung der Tafel ist stets mit einer Zeremonie verbunden, die diesen Akt zu einem recht feierlichen gestaltet. Dem Bericht des Oldesloer Landboten über die Einweihung der Toni-Petersen-Freibettenstiftung entnehmen wir folgendes: ‚Mit dem Choral: ‚Die Himmerl rühmen des Ewigen Ehre' wurden die Freigäste empfangen, nachdem die auswärtigen Teilnehmer um 4 ½ Uhr von der Bahn abgeholt worden waren (…). Dann fand eine eingehende Besichtigung des Heims statt, an die sich ein Kaffee im Speisesaal anschloß. Hier nahm Direktor Peters das Wort zur Festrede. Er schilderte eingehend die Geschichte des Heims vom Anfang bis heute und hob dabei die Verdienste der Frau Rompeltien, ihres Gatten und ihrer Tochter, der Frau Oberin ins verdiente Licht. Durch die im Winter von Frau Rompeltien angelegte Sammlung zur Ehrung des verstorbenen Fräulein Toni Petersen sei es ermöglicht, außer einem Bildnisse der Verewigten, das Frau Julie de Boor malt, eine Freibettenstiftung zum gedächtnis des Fräulein Toni petersen im Auguste-Victoria-Pflegeheim ins Leben zu rufen, von deren Zinsen vier arme Leute mehr als bisher je vier Wochen im Augsute-Viktoria-Pflegeheim verpflegt werden (…). Später fuhren die Herrschaften durch die Stadt zum Kurhause. Das Abendessen wurde dort durch eine Reihe von Ansprachen verschönt. (…) Eine in poetischer Form gehaltene Ansprache widmete Oberrealschullehrer Maßmann den Frauen. (…)."
Text: Rita Bake
|
|
 |
 |
 |
| Anita Rée |
 |
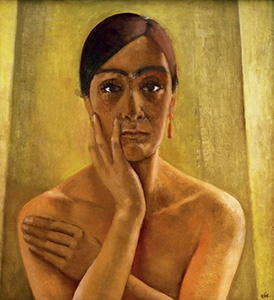
Selbstbildnis, 1930, Hamburger Kunsthalle |
| 9.2.1885 Hamburg - 12.12.1933 Kampen auf Sylt |
| Malerin der Hamburgischen Sezession |
Ohlsdorfer Friedhof, dort auf dem Althamburgischen Gedächtnisfriedhof, dort Urne
Anita-Rée-Straße, Bergedorf, seit 1984, benannt nach Anita Rée. Motivgruppe: Verdiente Frauen
Stolperstein vor dem Wohnhaus Fontenay 11.
"Mein Schmerz, dieser wühlende, nicht zu lindernde Schmerz, wird grösser von Tag zu Tag und untergräbt meine Gesundheit." 1) Diese Klage, die Anita Rée am Silvestertag des Jahres 1930 an Emmy Ruben (Grabstein im Garten der Frauen) richtet, kennzeichnet keinen vorübergehenden Zustand, sie könnte als Leitmotiv über ihren gesamten Leben stehen. Anita Rée war eine Fremde in der Welt.
Der Malerkollege Friedrich Ahlers-Hestermann erinnert sich an ihr Leben im Elternhaus:
|
"Darüber schwebte ihre Malerei als eine seltsame Landschaft, ebenso wie - später - oben auf dem Dachboden sich ihr Atelier befand als ein fremder und zu diesem Hause eigentlich nicht gehöriger Raum, ein Raum, der gar nicht so sehr günstig zum Malen war, für sie aber doch nun das eigentliche Lebenszentrum wurde. Als sie ihn hatte aufgeben müssen, hat sie ihn beklagt wie einen unersetzlichen Toten." 2) Als das Haus am Alsterkamp 13, ihr Refugium, einziger wirklicher Halt in einer Welt, in der sie sich nicht zurechtfinden konnte, verkauft wurde, lebte sie in ständig wechselnden Wohnungen, ärmlich und möbliert, ohne dass ihre finanziellen Verhältnisse das erfordert hätten. Schließlich floh sie 1932 nach Sylt, wo sie am 12. Dezember 1933 ihrem qualvollen Leben mit Veronal ein Ende setzte.
Geboren wurde Anita Rée am 9. Februar 1885 als zweite Tochter des jüdischen Kaufmannes Israel Rée, der im Deutsch-Französischen Krieg gekämpft, als Unterhändler fungiert und bei der Reichsgründung 1871 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Die Mutter war Anna Clara Hahn, die in Venezuela geboren und katholisch erzogen worden war.
Die beiden Mädchen, Emilia und Anita, wuchsen als "höhere Tochter" in einer kultivierten Sphäre liberalen Bürgertums auf. Sie gingen auf eine Privatschule und wurden protestantisch getauft und konfirmiert.
1905 wurde Anita Rée Schülerin des Hamburger Malers Arthur Siebelist. Er unterhielt seit 1899 eine Malschule, in der Anita Rée die Freilichtmalerei und die klassischen Genres lernte. Doch bald stellten sich die immer wieder an ihr nagenden Zweifel an ihrem Können ein, auch hielt sie die Ausbildung bei Siebelist für unzureichend. Ihre Versuche, auswärts einen Lehrer zu finden, schlugen fehl. Max Liebermann bestätigte sie zwar in ihrer Begabung, nahm sie jedoch nicht als Schülerin an. Daraufhin schloss sie sich 1910 dem Siebelist-Schüler Franz Nölken an, der gerade aus Paris zurückgekommen war, wo er bei Matisse gearbeitet hatte, und malte mit ihm zusammen in seinem Atelier. Nölken, der ein leidenschaftlicher Pädagoge war, freute sich zunächst, in Anita Rée jemanden gefunden zu haben, dem er die neu erworbenen, ihn völlig erfüllenden Erkenntnisse und Überlegungen mitteilen konnte. Anita Rée wurde in den elitär gesinnten Kreis ehemaliger Siebelist-Schüler der ersten Generation, zu dem Nölken und Ahlers-Hestermann gehörten, aufgenommen, die eigentlich auf ihre, die zweite Generation, herabsahen, glaubten sie doch zeitweilig, sie seien die neue Generation, von Lichtwark dazu bestimmt, den Hamburgischen Künstlerclub von 1897 abzulösen, eine Kontinuität hamburgischer Maler zu verbürgen und Lichtwarks Ideen reiner zu verkörpern als der Künstlerclub mit seiner überwiegend landschaftlichen Betätigung. Doch bald fühlte sich Nölken in seiner Freiheit bedroht. Er reiste ab und ließ eine tief gekränkte Anita Rée zurück. Im Winter 1912/13 ging sie, angeregt durch die Erfahrungen Nölkens und Ahlers-Hestermanns, nach Paris und wurde Schülerin von Fernand Léger.
Von 1913 bis 1922 lebte sie dann als freischaffende Künstlerin in Hamburg im Haus ihrer Eltern. Die einzige längere Unterbrechung war 1916 ein Aufenthalt in Blankenheim in Thüringen in einer Erholungsstätte für Künstler und Wissenschaftler. 1913 nahm Anita Rée an einer Ausstellung bei Commeter teil, gehörte fortan zur Hamburger Avantgarde. Gustav Pauli, der damalige Direktor der Hamburger Kunsthalle, erwarb bereits 1915 Arbeiten der jungen Malerin für die Kunsthalle. Sie wurde Gründungsmitglied der Hamburgischen Sezession und stellte selbst regelmäßig aus. Der dreijährige Aufenthalt in Positano in Italien von 1922 bis 1925 wurde für sie zum Schlüsselerlebnis. Hier verfestigte sich ihre zunächst vom Impressionismus und dann von den französischen Malern Cézanne und Matisse beeinflusste Malerei zu einem neusachlichen Stil. Sie wurde bekannt, erhielt nach ihrer Rückkehr nach Hamburg zahlreiche Portraitaufträge sowie um 1930 von Fritz Schumacher Aufträge für zwei Monumentalwerke. Das Wandbild der "klugen und törichten Jungfrauen" in der Gewerbeschule für weibliche Angestellte in der Uferstraße wurde 1942 zerstört, während das in der Oberrealschule für Mädchen in Hamm in der Caspar-Voght-Straße gemalte "Orpheus und die Tiere" heute noch zugänglich ist.
Mehrere Auszeichnungen (35 zu Lebzeiten, davon sieben Einzelausstellungen) mit ungewöhnlich guten Kritiken und hohe Preise dokumentieren ihre erstrangige Stellung. Die Malerkollegen und -kolleginnen, das Ehepaar Friedrich Ahlers-Hestermann und Alexandra Povorina, Alma del Banco und Gretchen Wohlwill (Grabstein im Garten der Frauen) waren ebenso ihre Freunde wie Magdalene und Gustav Pauli, Hildegard und Carl Heise, Nachfolger von Gustav Pauli als Direktor der Kunsthalle, Ida und Richard Dehmel und die Familie Warburg (siehe: Franziska Jahns, Kindermädchen der Warburgs, deren Grabstein im Garten der Frauen). Doch weder der berufliche Erfolg noch der große Freundeskreis, in dem sie zuweilen ausgelassen und fröhlich war, konnten ihr zerrissenes Wesen heilen. Hinzu kam das Scheitern der Liebe zu dem Buchhändler und Künstler Christian Selle, die ihren Aufenthalt in Italien begleitet hatte. Sie endete 1926 ebenso unglücklich wie die unerwiderte frühe Liebe zu Franz Nölken und die zu dem Hamburger Kaufmann Carl Vorwerk Anfang der 1930er- Jahre. Die Kompromisslosigkeit und Verletzbarkeit Anita Rées wird in folgender Episode besonders deutlich: Als die auch von Gretchen Wohlwill als "katastrophal" empfundene Jury der Sezessionsausstellung von 1927 ihr Bild "Weiße Bäume", das sie für ihr bestes hielt, nicht ausstellen wollte, zog sie alle Bilder zurück, stellte bis 1932 gar nicht mehr in der Sezession aus und auch dann nur ein einziges Bild.
Das Aufkommen nationalsozialistischer Tendenzen kann ihr Weltverhältnis nur bestätigt haben. 1932 wurde ihr für den Neubau der Ansgarkirche in der Langenhorner Chaussee gemaltes Altarbild aufgrund "kultischer Bedenken" vom Kirchenvorstand der Ansgargemeinde abgelehnt. Im selben Jahr verlor sie ihre Wohnung in der Badestraße. "Ich musste da zu meinem größten Kummer das Zimmer aufgeben, wusste in meiner Not nicht wohin mit all meinen Sachen, (die nun sehr provisorisch im Keller lagern) u. da ich in Hbg. Keine Bleibe mehr hatte, begab ich mich hierher in tiefste Einsamkeit und ohne je zu malen oder daran zu denken", 1) schreibt sie am 14. November 1932 von Sylt aus an Emmy Ruben. Ein Jahr später, am 2. Dezember 1933, zehn Tage vor ihrem Suizid, heißt es in einem Geburtstagsbrief an eine Schweizer Freundin: "Ich bin Dir sehr, sehr dankbar, daß Du mir die Basler Zeitung schicktest, die sowohl Lesenswertes, das man sonst nie zu Gesicht bekommt, aber auch so viel Tiefergreifendes, Trostloses enthält, daß ich beim Lesen dieses entsetzlichen Aufsatzes aus Berlin bitterlich geweint habe. Diese Dinge bringen mich um alle Fassung; ich kann mich in so einer Welt nie mehr zurechtfinden und habe keinen einzigen anderen Wunsch, als sie, auf die ich nicht mehr gehöre, zu verlassen. Welchen Sinn hat es - ohne Familie und ohne die einst geliebte Kunst und ohne irgendeinen Menschen - in so einer unbeschreiblichen, dem Wahnsinn verfallenen Welt weiter einsam zu vegetieren und allmählich an ihren Grausamkeiten innerlich zugrundezugehen? (…) Wenn ich nicht ans Sterben denke (und Muttis Todestag verdoppelt diese Sehnsucht) so kenne ich nur noch den einen, ständigen Gedanken: fort, fort aus diesem Land! Aber wohin?? Und wo ist es besser?? (…) Den Töchtern herzliche Grüße von Deinem jetzt ganz weißhaarigen, nicht wiederzuerkennenden Reh."
Die aparte, exotisch aussehende Frau, die ebenso liebenswürdig und bezaubernd wie schwermütig, unglücklich und hart sein konnte, setzte ihrem Leben am 12. Dezember 1933 ein Ende. Liest man die einfühlsamen Worte des Freundes Gustav Pauli an ihrem Grab, so wird einmal mehr deutlich, dass ihr, wie Heinrich von Kleist in seinem eigenen Abschiedsbrief an die Schwester schreibt, "auf Erden nicht zu helfen war": "Dem praktischen Leben und seinen Forderungen stand sie hilflos gegenüber, so hilflos, daß sie schließlich das Leben fürchtete. - Im Norden geboren, doch südlichen Geblüts, verzehrte sie sich in Sehnsucht nach Sonne und der heiteren Sorglosigkeit des Lebens südlicher Völker. Und doch liebte sie das Leben. Wir wissen es, sie konnte froh sein mit den Fröhlichen, scherzen und lachen bis zur Ausgelassenheit und auf Stunden vergessen, was im Grunde ihrer Seele als Schwermut ruhte." 2)
Die Kunsthalle besitzt die größte Sammlung der Arbeiten Anita Rées.
Text: Brita Reimers
Quellen:
1) Mappe "Nachlass Ruben". Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Handschriftenabteilung.
2) Hildegard und Carl Georg Heise (Hrsg.): Anita Rée 1885 Hamburg 1933. Ein Gedenkbuch von ihren Freunden, mit Beiträgen von Carl Georg Heise, Friedrich Ahlers-Hestermann, Fritz Schumacher und Gustav Pauli. Hamburg 1969.
Maike Bruhns: Leben und Werk einer Hamburger Malerin 1885-1933. Hamburg 1986.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Frieda Reimann, geb. Vides |
| 17.5.1899 - 24.7.1996 |
| Ausgebildete Lehrerin, Antisemitisch verfolgt, Widerstandskämpferin, Bürgerschaftsabgeordnete |
Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bo 73, 56
Frieda Reimann stammte aus Vilnius und war jüdischer Herkunft. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Walter Reimann (stammte aus Königsberg und starb 1988) war sie Mitglied der KPD. Das Ehepaar wohnte in einer Kleingartenkolonie in der Nähe des heutigen Kleiberwegs.
Vor 1933 war Friedas Reimann als betriebsratsvorsitzende eines Metallbetriebes aktiv gewesen. Auch soll sie Mitbegründerin des Kommnunistischen Jugendverbandes Litauens gewesen, so Uwe Scheer.
|
Ihren späteren Ehemann Walter Reimann lernte sie in Königsberg kennen, wo er eine Volksbuchhandlung leitete.
Während der NS-Zeit war Walter Reimann von 1934 bis 1937 aus politischen Gründen im KZ Fuhlsbüttel inhaftiert. Frieda Reimann wurde in einer Fabrik in Elmshorn zur Zwangsarbeit auf zwei Jahre und einen Monat verurteilt.
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus war Frieda Reimann von Februar 1946 bis Oktober 1946 KPD-Abgeordnete in der von der britischen Militärregierung Ernannten Hamburgischen Bürgerschaft. Von den 81 Ernannten waren nur sieben Frauen.
Auch engagierte sich Frieda Reimann in der Kleingartenarbeit des ehemaligen KLG Kiebitzmoor und in der VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes).
|
|
 |
 |
 |
| Sophie Reimarus, geb. Hennings |
 |

Bild aus: Victor Dirksen: Ein jahrhundert Hamburg 1800-1900. München 1926. |
| 14.4.1742 Pinneberg - 30.9.1817 Hamburg |
| Mittelpunkt des "Theetisches" im Hause Reimarus |
| Ohlsdorfer Friedhof, Grab Nr. S 25, 1-10
Sophie Reimarus, die allgemein nur "die Doktorin" genannt wurde, war dem aufklärerischen Gedankengut von Vernunft und Toleranz verpflichtet. "Hier kommt und geht, wer will, und denkt auch, was er will, und sagt es ziemlich dreist, und niemand kümmert sich darum" 1), beschrieb sie einmal ihren Theetisch, der einer der zentralen Orte der Hamburger Aufklärung und Anziehungspunkt für zahlreiche fremde Besucher der Stadt war. Hier herrschte Offenheit, Herzlichkeit und ein ganz auf geistige Genüsse gerichteter Sinn. Mehr als einen Tee hatten die Besucherinnen und Besucher der Familie Reimarus in der Fuhlentwiete 122 (heute Straße: Stadthausbrücke) kaum zu erwarten. Der Archäologe, Altphilologe und Schriftsteller Karl August Böttiger nannte die Familie Reimarus den "Licht- und Mittelpunkt des geistigen Hamburg",
|
und weiter: "Nichts ist in der That fröhlicher und genußreicher als eine Theetischconversation im Kreise dieser Familie, zu der ich während meines Aufenthaltes in Hamburg so oft eilte, als ich mich anderswo wegschleichen konnte. Während Vater Reimarus im Kaftan und mit Pfeife bald mit einsitzt, bald in dem benachbarten Zimmer Arzneien zubereitet, aber auch von daher durch die geöffnete Thür den Faden des Gesprächs festhält und oft seine Bejahung oder Verneinung mit vorgestrecktem Kopfe hereinruft, sitzt die Mutter Reimarus am dampfenden Theeständer, ihr zur Seite die ehrwürdige Elise und zwei unverheiratete Töchter des Doctors." 2) Die Hamburger Caspar Voght, Johann Georg Büsch, Friedrich Gottlieb Klopstock und Gotthold Ephraim Lessing in seiner Hamburger Zeit gingen hier ebenso ein und aus wie durch Hamburg reisende Gelehrte und Schriftsteller wie Adolph Freiherr von Knigge, Karl Leonhard Reinhold oder Karl August Böttiger.
Sophie Reimarus war die Tochter des Pinneberger Staatsrats Martin Hennings, der ihr eine ausgezeichnete Ausbildung angedeihen ließ. Schwester des bedeutenden Aufklärers August Hennings, zweite Ehefrau des nicht weniger angesehenen Arztes und Gelehrten Johann Albert Heinrich Reimarus, Schwägerin der klugen und gebildeten Elise Reimarus, Stiefmutter von Hannchen Sieveking, die ein großes Haus und nach dem Tod des Ehemannes eine Zeitlang auch das Handelshaus führte.
Sophie Reimarus wurde von ihren Zeitgenossen als geistvolle und lebhafte Gesprächspartnerin beschrieben. Wilhelm von Humboldt rühmte 1796 in seinem Reisetagebuch ihren "in hohem Grade gebildeten Verstand, und eine sehr angenehme und heitere Laune im Umgang" und notierte weiter: "Sie soll ein außerordentliches Talent zu der leichten Gattung des Stils haben, und über die Vortrefflichkeit ihrer Briefe herrscht nur eine Stimme." 3) Ein Blick in ihre Briefe an den Bruder August Hennings bestätigt das. Es sind gescheite und schlicht formulierte Dokumente ihrer Gedanken zu Politik, Philosophie und Literatur. In ihren Berichten von den Teegesellschaften zeichnet sie mit wenigen Sätzen plastische Portraits der Besucher. Immer sind ihre Ansichten und Urteile geprägte von Vernunft und Maß. Schwärmerei und romantischen Tendenzen steht sie voller Skepsis gegenüber, hier können ihre Urteile auch einmal hart und scharf ausfallen. So mokiert sie sich beispielsweise in drastischer Form über Caspar Voghts Eitelkeit, als er sich mit dem Etatsratstitel, dem Eintrittsbillet in den Adel, schmückte. Und in einem Brief an den Kaufmann Sulpiz Boesserée fragte sie: "Aber auf welche Universität wollen Sie dann ziehen? Jena hat seit einiger Zeit seine berühmtesten Männer verlohren und unter den bösen Phenomenen der Schellingschen Philosophie gehört auch wohl diese Gährung. Wenn nun diese ledigen Lehrstühle mit den Schlegeln und Tieck besetzt, und von Jacob Böhme beschützt werden, wird es vollends junge Köpfe verdrehen. Seit Kurzem sind uns 3 Junge Herren vorgekommen, die halbtot, wenigstens zu allem nützlichen verdorben waren." 4) Und auch die anfängliche Revolutionsbegeisterung - ausführlich hatte Sophie ihrem Bruder von der Revolutionsfeier bei Sievekings berichtet und sich später begeistert über den Mainzer Jakobinerklub geäußert - schlug bald um. Mitte Dezember 1792 schrieb sie in einem Brief an den Bruder: "Nein, die Französen sind keine Nation, mit der man sich brüderlich verbinden kann! (…) Gute Freiheit, warum bist du nicht in andere Hände gefallen!" 5) Und in einem Gedicht pries sie wie viele von der Revolution enttäuschte ZeitgenossInnen den Rückzug ins Private, Überschaubare, Geordnete: " (…) Ein grauenvolles Zeitungslesen
Zerstört oft unser ganzes Wesen,
(…)
Was gute Menschen kaum begannen
Sinckt schrecklich hin durch VolksTyrannen,
(…)
Hinweg denn mit dem großen Traume
Die Freiheit haußt im engen Raume
Wohnt in der Brust der Redlichkeit
Sie wohnt in unserm kleinen Zimmer
Und unser Theetisch sey ihr immer
Zum bleibenden Altar geweiht." 6)
Sophie Hennings hatte im Alter von 28 Jahren, am 8.6.1770, den Arzt, Naturforscher und Philosophen Johann Albert Heinrich Reimarus geheiratet. Sie hatte ihn kennengelernt, als sie von Pinneberg nach Hamburg gereist war, um sich der ovn ihm in Hamburg eingeführten Pockenimpfung zu unterziehen. Zu Hannchen, der Tochter aus der ersten Ehe ihres Mannes, gesellten sich 1771 die Tochter Christine, (1771-1815), die später (1786) den französischen Gesandten in Hamburg, Karl Reinhard heiratete und einen umfänglichen Briefwechsel mit Wilhelm von Humboldt führte, und 1774 der Sohn Hermann, der Kaufmann wurde.
Der Tagesablauf im Hause Reimarus, den Piter Poel beschreibt, bestätigt noch einmal die geistige Beweglichkeit und Bildung Sophie Reimarus': "Der Theetisch vereinigte die Gatten früh morgens, dann im Laufe des Vormittags, wenn der Mann sich ein halbes Stündchen von seinen Patienten abmüßigen konnte und nach dem Abendessen, selbst wenn sie erst spät aus der Abendgesellschaft nach Hause gekommen waren. Dann hatte sie immer Journale in Bereitschaft mit den angemerkten Stellen, die ihn der Mühe überhoben, das Ganze durchzulesen, oder sie trug mündlich ihm vor, was ihn auf andre Weise erfreuen konnte." 7)
Wie sehr sich ihre Wesensart von der ihrer Stieftochter Hannchen unterschied, die die Seele eines anderen namhaften gesellschaftlichen Treffpunkts in Hamburg jener Zeit war, zeigt die folgende Begebenheit: Als das Sievekingsche Handelshaus 1811 Konkurs gemacht hatte, bat Hannchen ihren Vater ins Elternhaus zurückkehren zu dürfen: "Ich will mein Kinderleben wieder anfangen, will Papa mich bei sich aufnehmen?" Sophie Reimarus Antwort: "Gutes Kind. Du hast nie aufgehört, es zu führen; denn rein und kindlich ist dein Leben immer gewesen." 8) Diese kindliche Liebe sollte Sophie Reimarus in besonderem Maße zuteil werden, als sie bettlägerig wurde und Hannchen sie aufopfernd bis zu ihrem Tode pflegte. Sophie Reimarus starb drei Jahre nach dem Tode ihres Mannes, am 30. September 1817.
Text: Brita Reimers
Quellen:
1) Zit. nach: Georg Heinrich Sieveking: Lebensbild eines Hamburgischen Kaufmanns aus dem Zeitalter der französischen Revolution. Kapitel VII. Berlin 1913.
2) Karl August Böttiger: Literarische Zustände und Zeitgenossen. In: Schilderungen aus Karl Böttigers handschriftlichem Nachlasse. Hrsg. von Karl Wilhelm Böttiger. Bd. 2. Leipzig 1838.
3) Zit. nach: Franz Schultz: Ein Urteil über die "Braut von Messina". Aus ungedruckten Briefen von Sophie Reimarus an Sulpiz Boisserée. In: Euphorion.
4) Zit. nach: Franz Schultz, a. a. O.
5) Zit. nach: Inge Stephan: Aufklärer als Radikale? Literarische und politische Opposition in Hamburg und Altona am Ende des 18. Jahrhunderts. In: Inge Stephan, Hans-Gerd Winter (Hrsg.): Hamburg im Zeitalter der Aufklärung. Berlin, Hamburg 1989.
6) Zit. nach: Franklin Kopitzsch: Grundzüge einer Sozialgeschichte der Aufklärung in Hamburg und Altona. 2. Aufl. Hamburg 1990.
7) Gustav Poel: Bilder aus vergangener Zeit nach Mitteilungen aus großenteils ungedruckten Familienpapieren. Teil II. Kapitel I. Hamburg 1887.
8) Zit. nach: Georg Heinrich Sieveking, a. a. O.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Pauline Runge, geb. Bassenge |
| 18.09.1785 Dresden - 26.04.1881 Hamburg |
| Ehefrau des Malers Philipp Otto Runge |
Althamburgischer Gedächtnisfriedhof: Grabstein Philipp Otto Runge.
Nach Angaben der Friedhofsverwaltung soll hier auch Pauline Runge beigesetzt sein, allerdings ohne namentliche Erwähnung auf dem Gedenkstein.
"Sieh, ich bin verliebt, sehr verliebt; mich dünkt, ich habe alles das gefunden, zusammen, was mich sonst wohl einzeln entzückt hat", schreibt der 25-jährige Philipp Otto Runge an seinen Bruder Daniel in Hamburg, als er im Sommer 1801 die noch nicht 16-jährige Pauline Susanna Bassenge in Dresden kennenlernt. (Brief vom 12. September 1801)1
Ist das Zitat die nur allzu bekannte Äußerung eines Frischverliebten, die nicht ganz ernst zu nehmen ist? Wohl nicht.
|
Die Begegnung mit Pauline Bassenge, dem neunten Kind des aus belgischer Hugenottenfamilie stammenden Dresdner Handschuhfabrikanten Charles Frédéric Bassenge und dessen Cousine Marie Frédérique Bassenge, hatte für Runges menschliche und künstlerische Entwicklung eine kaum zu überschätzende Bedeutung. Auch wenn Runge den Bruder im nächsten Satz des Briefes beruhigt: "(...) wenn ich auch völlig im Ernst bin, so will ich doch eben nicht gleich heiraten...",2) so bezieht er im dann folgenden die Begegnung mit Pauline doch sogleich auf die Zukunft und seine ganze Existenz. Er verlangt vom Bruder, sich mit ihm über Richtung und Bestimmung seines Lebens ein für allemal zu einigen, und wünscht insbesondere zu erfahren, ob Daniels Gedanken über seinen weiteren Lebensweg gegen die in ihm erwachte Liebe stünden. (Der ihm eng verbundene Bruder, in dessen Handelsgeschäft Philipp Otto Runge eine Zeit lang gearbeitet hatte, hatte ihm eine künstlerische Ausbildung ermöglicht und ihm angeboten, bei ihm zu leben, um sich ohne finanzielle Sorgen der Malerei widmen zu können.)
Die Liebe Paulines erscheint Runge als Bürgschaft seines Schaffens: Am 6. Oktober 1801 schreibt er an den Bruder: "Ihr werdet mich gewiß nicht abhalten, eine Liebe zu suchen, die mir teurer wäre wie alles, wodurch ich verführt werden könnte, und mich dadurch vor jeder Versuchung bewahrte. Ich weiß es, daß ein Künstler ohne die Liebe nichts ist, daß er ohne sie nichts leisten kann; auf welchem Wege nun soll ich diese Liebe suchen, wenn nicht auf diesem hier, wo sie mir so rein und ohne unübersehliche Schwierigkeiten entgegenkommt?"3) Und am 20. März 1802: "Ich kam wieder auf die Kunst und alles, was ich den Tag erlebt hatte; es drängte sich unwiderstehlich die Ahnung mir auf: Wenn du nun P. nicht erlangst, was wird dann aus der Kunst bei dir?"4)
Nach diesen Äußerungen scheint es kein Zufall zu sein, wenn in der Zeit der ersten Liebe, des sehnsuchtsvollen Hoffens, in der das romantische Gedankengut zutiefst erfahrene Wirklichkeit des eigenen Lebens wird, im Herbst 1801, die zweite Fassung des Bildes entsteht, das das Wesen der Kunst Runges richtungsweisend bestimmt, wie Jörg Traeger in seiner Runge-Monographie 5) überzeugend darstellt. In der zweiten Fassung des "Triumph des Amor" entwickelt Runge in der Darstellung des Themas Liebe, wobei er sich bezeichnenderweise von dem allgemein gehaltenen Liebesbegriff der ersten Fassung zugunsten der Geschlechterliebe abwendet, die allegorische Grundlage seiner Malerei. Runge selbst zählte das Bild zu seinen "eigentlich ersten Arbeiten". 6)
Doch was so hoffnungsvoll begann, erfährt zunächst ein jähes Ende, nicht durch den Einspruch des Bruders Daniel, sondern durch Paulines Vater. Als Runge im Juli 1802 um Paulines Hand anhält, lehnt der alte Bassenge mit dem Hinweis auf die Jugend seiner Tochter ab - Pauline ist erst 16 Jahre alt -, verwehrt Runge gar, sein Haus weiterhin zu betreten.
Diese Absage führt Runge in eine schwere psychische und physische Krise. An den Bruder schreibt er: "(...) ich muß Dir Nachricht von mir geben und kann es nicht, ich bin lahm, sehr lahm. O lieber Daniel, könnt ich weinen!" (Brief vom 11. Juli 1802)7)
Das Malen scheint jetzt nur noch den einen Sinn zu haben, Pauline darzustellen: "(...) und sehe in allem nichts anderes, als wie ich nur ihr Bild in allem recht ausdrücken möchte (...)" (Brief vom 16. Oktober 1802 an Daniel)8) Es entsteht "Die Lehrstunde der Nachtigall", Psyche trägt Paulines Züge.
Am 21. November dann der Jubelruf: "Mein allerbester D., jetzt gehe ich ordentlich mit Freuden und Begierde daran, Dir recht viel zu schreiben, so wie mir der ganze Himmel jetzt voll Geigen hängt und mir alles wie meine P. anlacht. O lieber D., müßte ich es Dir doch nicht erst schreiben! aber ich muß es wohl, denn sonst wirst Du aus den Übergängen von der dumpfen Traurigkeit meines vorigen zu den himmelhohen Sprüngen dieses meines geliebten Schreibens durchaus nicht klug (...). So ist denn nun alles wieder rosenrot in mir und mein Bild soll und muß nun gut werden. Bei all dem muß ich zu mir heimlich sagen: womit hast du alle die Seligkeit verdient? Ich bin's nicht wert, und wie kann man so etwas verdienen? Ich schäme mich vor Gott, wie ich habe so verzagt sein können, und ich will mich meines Glückes nicht überheben, sondern hübsch fleißig sein."9)
Der Grund für diese Freude ist die Botschaft aus dem Hause Bassenge, alle, Pauline eingeschlossen, seien für ihn, er dürfe nach ihrer Konfirmation, zu Ostern 1803, erneut um sie werben. Am 3. April 1804 wird in Dresden die Hochzeit gefeiert, am 13. Mai trifft das junge Paar in Hamburg ein.
Die Freunde Philipp Otto Runges, die Familien von Friedrich Perthes, Johann Michael Speckter, Gründer der ersten lithographischen Anstalt Norddeutschlands, und Friedrich August Hülsenbeck, Geschäftspartner Daniel Runges, die alle durch ihre künstlerischen Ambitionen verbunden sind, werden auch Paulines Freunde. Besonders mit Frau Hülsenbeck versteht Pauline sich gut.
Am 30. April 1805 wir der erste Sohn, Otto Sigismund, geboren. Ihm folgen 1807 die Geschwister Maria Dorothea und 1809 Gustav Ludwig Bernhard. Doch das Familienglück nimmt ein jähes Ende. Am 7. Dezember 1810 stirbt Philipp Otto Runge im Alter von nur 33 Jahren an der Schwindsucht. Sein dritter Sohn wird einen Tag später, am 3.12.1810, geboren. Er erhält die Namen des Vaters.
Liest man die vollkommen unbedarften Briefe Paulines an ihre Mutter, fragt man sich, worin die Liebe Runges gründete, die so weitreichende Wirkungen auf seine Kunst hatte.10)
Der Brief an den Jugendfreund Karl Friedrich Enoch Richter in Leipzig aus der Zeit tiefster Hoffnungslosigkeit macht deutlich, daß Runges Liebesauffassung zutiefst dem Gedankengut der Frühromantiker verpflichtet ist und aus eben diesem Grunde ihn so sehr beeinflussen konnte. So wie beispielsweise Friedrich Schlegel in seiner "Lucinde" eigentlich nicht die geliebte Lucinde als Individuum, sondern die Liebe liebt, so scheint es auch hier zu sein. Die Liebe soll den Schmerz über den fehlenden inneren Zusammenhang heilen, die Sehnsucht nach Verschmelzung mit dem Weltganzen erfüllen: "Liebster Enoch, daß ich jemals in der Welt zur Ruhe kommen werde, habe ich schon lange nicht mehr geglaubt, denn die Dinge, die sich in mir durchkreuzen, häufen sich beständig aufs neue; doch das alles könnte ich ertragen, wenn P. mein geworden wäre. Das wird sie aber schwerlich, und ich könnte wohl sagen, gewiß nicht, wenn ich mich nicht heimlich davor fürchtete, das zu sagen. Lieber E., ich wünschte von Herzen, daß das Leben erst zu Ende wäre, es ist mir eine Marter, und noch dazu eine, die ich willig trage, denn ich kann wieder nicht wünschen, daß es jetzt zu Ende sei. (...) Es ist kein Zusammenhang in mir, dies ist die größte Pein, und wenn ich glaube, alles in einen Zusammenhang gebracht zu haben, so werden immer neue Absonderungen entstehen, die mich nicht ruhig werden lassen.
Ich muß Dir das nennen, so einzeln, wie es in mir da ist. Ehe ich P. kannte, war es immer mein Trost, daß ich einst ein Wesen finden würde, das von ganzer Seele an mir hinge. Damals konnte ich noch mit Sehnsucht in eine unbestimmte Zukunft hoffen; jetzt ist nun das Bild bestimmt da, eben das, das ich vorher gekannt habe, ehe ich sie gesehen. Dieses wird von mir getrennt; ich weiß nicht, ob sie mich liebt oder nicht; die innere brennende Sehnsucht ist der Quell, woraus alle meine Kraft, alles, was ich hervorbringe, entsteht; ohne diese Sehnsucht bin ich nichts als ein unbesaitetes Instrument; die Erinnerung an sie immer frisch und lebendig zu erhalten, ist das erste Notwendige, denn dadurch kann ich sie nur verdienen.
Verdienen? das kann ich wohl nicht, denn wer verdient so etwas? und doch kommt mir diese Gabe nicht frei von Gott. Mein ganzes Leben kann ich ihr nur beweisen, daß ich sie liebe - und dieses Leben geht über den Beweis dahin, und ich verzehre mich unter der Glut. Sie kann mich hassen, und ich muß sie doch ewig lieben, denn dies ist die Form, worin meine Sehnsucht gebannt ist; ohne ihr Bild bin ich nichts als eine hohle Nuß .(…)" (Brief vom 21. Juli 1802)11). Die Sehnsucht nach der Erfahrung des Zusammenhangs mittels der Liebe zu einer Frau spricht auch aus einem Brief, den Runge während der Brautzeit an Pauline richtet: "Liebe Pauline, vergessen Sie nicht, daß ich alle meine Glückseligkeit in Ihre Hände lege und daß ich Ihnen alles geben will, was ich habe, dass ich mit Ihnen und durch Sie Gottes Wesen, wie es in der Welt wirkt, möchte begreifen lernen; (...)" (Brief, undatiert) 12) Im Brief vom April 1803 steigert sich die Sehnsucht gar zur Todesphantasie: "So wie ein Kind im Paradiese lebt und sich selbst unbekannt selig ist; es kommt aber, wie es anfängt zu lernen, die Sünde in ihm: das ist die Erbsünde, die nun einmal in der Welt ist, denn durch die Wissenschaft sind Körper und Seele getrennt worden. Wie man sich aber in der Schule zersplittert in tausend wissenswürdige Dinge, so geschieht wieder die Verbindung in uns durch die Liebe: das ist die alte Sehnsucht zur Kindheit, zu uns selbst, zum Paradies, zu Gott - diese ist, meine ich, die Sehnsucht, das Ich und Du zu verbinden, daß es einst wieder werde, wie es gewesen ist in Gott. Wir müssen, wenn wir uns lieben, uns du nennen und tun es auch bei uns selbst; daß wir es äußerlich nicht tun, ist bloß, weil es sich nicht schickt und um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. So ist unsre Liebe zueinander die Liebe zu uns selbst, und je näher wir uns werden kennenlernen, je dünner die Wand zwischen uns sein wird durch die Liebe, je mehr werden wir uns zur völligen Vereinigung sehnen, d.i. zum Tode."13)
Von dem von Goethe in den "Wahlverwandtschaften" formulierten Sinn der Ehe, nämlich das Rätsel des Lebens gemeinsam zu lösen, ist Runge weit entfernt. Der dänische Diplomat und Schriftsteller Johann Georg Rist erkennt diese Zusammenhänge, wenn er in seinen Lebenserinnerungen schreibt: Runge hatte sich aus Dresden eine kleine, liebe, schlichte Frau geholt, die gerade als eine ganz gewöhnliche, aber reine Natur und von allem idealen Streben entfernt, sich recht zu einer Künstlersfrau zu schicken schien. Sie hatte ihm ein paar allerliebste Kinder mit pausbäckigen Engelsköpfchen gebracht, und die Wirtschaft im vierten Stock, wo diese Familie lebte, ohne sich um eine andere als ihre eigene Welt zu kümmern, hatte in ihrer Einfalt und ihrem ganzen Zuschnitt etwas recht Poetisches, gerade weil gar keine Affektation darin war, vielmehr das hausbackene und spießbürgerliche Element sich auf das Ungezwungenste mit dem künstlerischen darin vermählte."14)
Diesen Eindruck vermitteln auch die verschiedenen Portraits, die Runge von seiner Frau malte.
Pauline scheint glücklich gewesen zu sein, mit ihren Kindern und in dem Gefühl, geliebt zu werden. Die einzigen Äußerungen in ihren Briefen, die über Banalitäten und Floskeln hinausgehen, sind fast erstaunte Feststellungen, dass die Liebe zu Runge immer noch frisch sei, ein wenig ernster geworden, seit die Kinder dazwischen stünden.
Nach dem Tod ihres Mannes kehrt Pauline am 23. Mai 1811 mit den drei jüngeren Kindern nach Dresden zurück, während Otto Sigismund bei Daniel bleibt. "Pauline lebt bei ihren Eltern - gesund und wohl, obschon auch in großer Einsamkeit",15) berichtet Daniel Runge einem Freund.
Im Herbst 1815 fährt Pauline nach Hamburg, um die ihr offenbar von Daniel Runge versprochene Ehe einzuklagen. Der schreckt jedoch zurück. Man kommt indessen überein, nicht die gesamte Kindererziehung den Dresdner Verwandten zuzumuten, sondern die beiden Söhne zusammen mit denen David Runges, des Bruders von Daniel und Friedrich, in Ludorf erziehen zu lassen.
Mit dem Tod ihres Vaters muss Pauline Geld verdienen. Sie arbeitet im ehemals väterlichen Geschäft und gibt Französischunterricht. Im Mai 1832 holt Otto Sigismund, der inzwischen Bildhauer geworden ist, die Mutter und die Schwester nach Hamburg, wo Pauline weiter unterrichtet. Pauline Runge stirbt im Alter von 95 Jahren. Sie wird auf dem St. Petrikirchhof begraben und 1935 zusammen mit ihrem Mann auf den Althamburgischen Gedächtnisfriedhof überführt.
Text: Brita Reimers
Quellen:
1. Philipp Otto Runge: Briefe und Schriften. Hrsg. Von Peter Betthausen. München 1982.
2. ebenda.
3. ebenda
4. ebenda
5. Vgl.: Jörg Traeger: Philipp Otto Runge und sein Werk. Monographie und kritischer Katalog. München 1975.
6. 6: Philipp Otto Runde: Briefe, a. a. O.
7. Karl Privat: Philipp Otto Runge. Ein Leben in Selbstzeugnissen, Briefen und Berichten. Berlin 1942.
8. Philipp Otto Runge, a, a, O.
9. ebenda
10. Vgl.: Wilhelm Feldmann: Philipp Otto Runge und die Seinen mit ungedruckten Briefen. Leipzig o. J. Der Band enthält ein Photo von der alten Pauline Runge.
11. Philipp Otto Runge, a., a., O.,
12. Karl Privat, a. a. O.;
13. Philipp Otto Runge, a. a. O.
14. Johann Georg Rist: Lebenserinnerungen. Hrsg. Von Gustav Poel. Bd. 2. Kapitel 8. 2. Aufl. Gotha 1884-1886.
15. Philipp Otto Runge, a. a. O.
|
|
 |
 |
 |
| Wilhelmine Schäfer, geb. Stegmann |
 |
 |
| 1783 Hamburg - 22.7.1861 Hamburg |
| Schauspielerin am Hamburger Stadttheater von 1792 bis 1832 |
Ohlsdorfer Friedhof, Althamburgischer Gedächtnisfriedhof:
Grabplatte "Stadttheater"
Wilhelmine Schäfer war die jüngere Schwester Caroline Herzfelds. 1783 während eines Engagements der Eltern am Hamburger Stadttheater geboren, war Wilhelmine Schäfer neun Jahre alt, als die Familie 1792 nach Hamburg zurückkehrte und Eltern und Töchter am Stadttheater auftraten, 1803 heiratete sie den Schauspieler, Sänger und Regisseur Heinrich Schäfer. 1804/5 bekamen beide ein festes Engagement am Stadttheater.
|
"Uebelwollende", berichtet Carl August Lebrun in seiner Geschichte des Stadttheaters,¹ wollten ihnen die verwandtschaftlichen Verhältnisse auf Kosten ihrer Fähigkeiten vorwerfen. Auffallend jedenfalls ist, dass Wilhelmine Schäfer kaum in der Literatur erwähnt wird, ihre Tätigkeit am Theater mehrfach unterbrach und sich bereits 1832 von der Bühne zurückzog. Heinrich Schäfer dagegen wird zusammen mit der gemeinsamen Tochter Karoline von Lenz-Schäfer (geb. 1808) Mitte der 20er Jahre als Publikumsliebling genannt.
Text: Brita Reimers
Quellen:
¹ Carl August Lebrun: Jahrbuch für Theater und Theaterfreunde.
Jg. 1. o. O. 1841.
|
|
 |
 |
 |

Bild aus: Berthold Litzmann: Friedrich Ludwig Schröder: Ein Beitrag zur deutschen Literatur- und Theatergeschichte. 1.Teil. Hamburg, Leipzig 1890-1894. |
 |
Anna Christina Schröder, geb. Hart |
| 9.11.1755 St. Petersburg - 25.6.1829 Rellingen |
| Tänzerin und Schauspielerin am Ackermannschen Schauspielhaus am Gänsemarkt von 1773 bis 1798 |
Ohlsdorfer Friedhof, Althamburgischer Gedächtnisfriedhof:
Grabplatte zusammen mit ihrem Ehemann Friedrich Ludwig Schröder
In den ersten Januartagen des Jahres 1773 stand in Hamburg eine junge Frau in Sommerkleidung vor der Tür Sophie Charlotte Ackermanns, der Schauspielerin und Witwe Konrad Ernst Ackermanns, des eigentlichen Begründers der stehenden Bühne in Deutschland, die zusammen mit ihrem Sohn dem berühmten Theaterreformator Friedrich Ludwig Schröder, das Ackermannsche Schauspielhaus am Gänsemarkt (später Hamburger Stadttheater, heute Hamburgische Staatsoper) leitete. So ärmlich wie ihre Kleidung war auch die Herkunft Anna Christina Schröders. Sie war als Tochter deutscher Eltern am 9. November 1755 in St. Petersburg geboren und schon als Kind in die von der Kaiserin Katharina gegründete stehende Scolary´s Tanzschule gegeben worden,
|
um für die Bühne ausgebildet zu werden. Als der Schauspielerprinzipal Wäser sie entdeckte nahm er die neunjährige mit nach Deutschland. Da seiner Schauspieltruppe jedoch keinerlei Erfolg beschieden war, sie in den 60er und 70er Jahren zu den unbeständigsten und kärglichsten des Landes gehörte, er aber eine hohe Meinung von dem Talent und den Aussichten seines Schützlings hatte, empfahl er Anna Christina in die Obhut der seriösen Ackermannschen Gesellschaft. "Ich weiß das gute Kind keinen besseren Händen anzuvertrauen, als den Deinigen", schrieb Frau Wäser an Sophie Charlotte Ackermann.
Hamburg war in jenen Tagen die führende Theaterstadt Deutschlands. Hier war ein Jahrhundert zuvor (1678) das erste Opernhaus errichtet worden, hier wagte Ackermann 1765 mit seiner Truppe am Gänsemarkt, dem alten Standort der Bürgeroper, ein stehendes "Comoedienhaus" zu gründen, aus dem die erste deutsche Nationalbühne hervorging, an der Lessing als Dramaturg wirkte und seine "Hamburgische Dramaturgie" verfasste. Da es jedoch nicht gelang, die anspruchsvollen Ziele zu verwirklichen, ging das Theater bald zugrunde. Erst Friedrich Ludwig Schröder wusste mit der Übernahme der künstlerischen Leitung der Bühne im Jahre 1771 der Theaterkultur eine entscheidende Wende zu geben, sowohl durch seine Spielplangestaltung - die Aufführung der Werke der Stürmer und Dränger und die Einführung Shakespeares, der dem großen nationalen Drama den Weg bahnte - als auch durch die Anhebung des Darstellungsniveaus. Schröder drang zu einer Menschengestaltung vor, die auf dem englischen Vorbild der Natürlichkeit basierte.
Als Anna Christina Schröder in Hamburg ankam, war die Ackermannsche Truppe gerade auf Gastspielreise. So gab sie am 13. Januar 1773 zunächst nur ihr Debüt in einem Pas de deux und reiste dann der Gesellschaft nach Celle entgegen. Hier stand sie zum ersten Mal zusammen mit Friedrich Ludwig Schröder, den sie schon kurze Zeit später, am 26. Juni 1773, heiratete, auf der Bühne. Unzählige gemeinsame Auftritte sollten folgen. Als Schröder 1798, nach Abgabe der Direktion, von seinen Nachfolgern gebeten wurde, als Schauspieler ans Theater zurückzukehren, ohne dass man auch nur ein Wort über seine Frau verlor, schrieb er brüskiert: "Daß Sie meiner Frau nicht erwähnen, habe ich gefühlt wie ich mußte. Meiner Meinung nach hätte selbst die Politik gegen das Publikum erfordert, Anfrage nach ihr zu thun, wenn sie auch vorher gewußt hätten, daß sie solche ablehnen würde. Das konnten Sie nicht wissen; und ich kann doch nimmermehr glauben, daß sie in Ihren Augen so unbedeutend seyn sollte! Mit wem sonst sollte ich wohl in manchen Stücken spielen, die auf Ihrem Verzeichnisse stehn?" ¹ Und dabei hatten beide eine große Karriere für Anna Christina Schröder ursprünglich nicht ins Auge gefasst. Er, weil er aufgrund täglicher Erfahrung der Überzeugung war, dass sich der Beruf der Schauspielerin nur schwer mit den Pflichten einer Hausfrau in Einklang bringen lasse, sie, weil sie diesen Beruf nur auf Wunsch der Eltern ergriffen hatte. Doch es war anders gekommen.
In den ersten Jahren wirkte Anna Christina Schröder fast ausschließlich als Tänzerin. Nur hin und wieder sang sie auch in der Oper und trat in Nebenrollen im Schauspiel auf. Zunehmend wagte sie sich jedoch an größere Rollen im Schauspiel, und als dann die hochbegabte und allseits beliebte Stiefschwester ihres Mannes, die Schauspielerin Charlotte Ackermann, 1775, im Alter von nur 17 Jahren starb, musste Anna Christina Schröder deren Rollen zum Teil übernehmen. Anna Christina Schröder bestand die Feuerprobe. Von ihrem Auftritt in der Titelrolle von Lessings "Emilia Galotti" am 5. Dezember 1777 - Schröder spielte den Odoaro - berichtet der Königliche Dänische Kanzleisekretär Johann Friedrich Schütze: "Mad. Schröder spielte Emilie. Nach einer vorherigen bescheidnen Entschuldigungsrede wagte sie es, diese Triumphrolle der unvergesslichen Charlotte Ackermann nachzuspielen. Wir waren Zeugen ihres sanften, empfindungsvollen Spiels. In jeder Szene sah man es dieser wackern Künstlerin (die auch als Weib ihrem Geschlechte Ehre macht,) an, wie vorbereitet sie erschien, wie fein gefühlt sie ihre Gefühle als Emilie wiedergab. Sehr wahr sagt ein Ungenannter in Nr. 8 der Litt. und Theat. Zeit. 1778: ‚Mad. Schröder spielte die Emilie und Rutland mit Beifall, welches in Rücksicht auf ihre große Vorgängerin sehr viel sagen will.? "² Über die Darstellung ihrer Ophelia im darauf folgenden Jahr schreibt er: "Mad. Schröder, als Ophelia, gelang es, sich als eine glückliche Nachbildnerin ihres großen Vorbildes zu zeigen. Ihr Spiel in den Wahnsinnsszenen erschütterte, so sehr es kann. Auch war (irren wir nicht,) sie die erste Ophelia, welche die bekannten Strophen zu singen mit Glück wagte."² 1779 stand sie in "Macbeth" auf der Bühne: "Schröder als Macbeth, Mad. Schrödern als Ladi Makbeth, beider wahres und trefliches Spiel mußte wirken, so wenig gleich dieser beider von dem Spiel der mehrsten übrigen unterstützt ward."² Der Freund und Schröder-Biograph Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer fasst Anna Christina Schröders Schauspielkunst folgendermaßen zusammen: "Die Wahrheit, Unschuld und Reinheit ihres Spiels war unübertrefflich. Sie vergriff keinen Charakter, kein falscher Ausdruck entschlüpfte ihr, sie erlaubte sich keine Uebertreibung. Sie wollte nie zur Unzeit glänzen, oder eine einzelne Stelle auf Kosten des Ganzen heben. Sie wich nie von der Bahn, die ihr der Dichter vorgeschrieben. Sie verstattete sich in der ansteckendsten Fröhlichkeit keine Gebehrde, keinen Wink, die nur der hingerissene, nicht der überlegende Zuschauer gutheißen kann. Unablässiger Fleiß, glückliches Gedächtnis, vortheilhafte Bildung, und die Sicherheit der Bewegungen welche die Tanzkunst verleiht, vereinigten sich ihre Bemühungen zu begünstigen. Auch war sicherlich das große Beispiel ihres Gatten, ihrer Schwiegerinnen, und der übrigen trefflichen Künstler, neben denen sie von Zeit zu Zeit gestanden, wesentlich erforderlich, um ihre Anlagen so günstig zu entwickeln. Aber selbst erkennen und nehmen mußte sie dies
Beispiel, das ihr nicht aufgedrungen ward. Denn nie erlaubte sich Schröder, den sie anfangs überraschte und endlich stolz machte, ihre Eigenthümlichkeit zu unterbrechen."¹ Anders beurteilt der Schröder-Biograph Berthold Litzmann Anna Christina Schröders Talent und den Anteil, den Schröder an ihrer Ausbildung hatte: "Und wenn sie in der Folge aus einer schüchternen Darstellerin sanfter Agnesen [Rolle eines einfachen Bauernmädchens; so genannt nach der Agnese in Molières "Schule der Frauen"] sich zu einem der meistbeschäftigten Mitglieder der Bühne ihres Mannes in großen tragischen Rollen entwickelte, so wich sie darin nur dem unablässigen Drängen ihres Mannes, der zugleich ihr Lehrmeister ward, und der mit einer argwöhnischen Sorge, die in ihrer Reizbarkeit die Schwäche verriet, darüber wachte, daß man sie überall auch als große Künstlerin anerkenne. Die Freunde des Hauses, die selbst unter dem Zauber der edlen Frau standen und bald sie auch mit seinen Augen sahen, haben ihm denn auch den Gefallen gethan und viel Freundliches und Lobendes über die Schauspielerin Christine Schröder gesagt und geschrieben; und der große Meister freute sich dann allemal wie ein Kind, wenn ihm so ein warmes Lob der geliebten Stina zu Ohren kam. Daß es aber so und nicht anders ausging, das durfte sich die feinfühlige Frau als ein Verdienst besonderer Art anrechnen. Übrigens unterliegt es wohl keinem Zweifel , daß der Glaube an die große Madame Schröder ein frommer Mythus war, der von den Intimen des Hauses optima fide gehegt wurde, der aber bei der unbefangenen Kritik, von der feindlichen ganz zu schweigen, auf starken und berechtigten Widerspruch stieß. Schwerlich hat sich auch die bescheidene Künstlerin selbst darüber getäuscht."³
Allgemeine Übereinstimmung herrscht dagegen über die Person Anna Christina Schröder. Sie war sehr belesen, besaß eine vortreffliche Menschenkenntnis und großes Einfühlungsvermögen, das es ihr auch erlaubte, die Künstlernatur ihres Mannes, die durch eine ans Unmenschliche grenzende Erziehung im Elternhaus und Internat in ihrer Unausgeglichenheit und leichten Erregbarkeit noch verstärkt worden war, zu verstehen und zu beeinflussen. Sie sah sich ganz als liebevolle Begleiterin ihres Mannes. Schröder selbst hat den Tag seiner Eheschließung immer als den glücklichsten seines Lebens gepriesen. "Sowie sie stürbe", sagte er einmal, "würde ich mich in einen Wagen setzen und davonfahren. Von einer Reise, vorzüglich aber von der wohlthätigen Zeit, die ja alles heilt, erwarte ich in solchen Fällen viel." 4
Als Schröder 1780 wegen interner Schwierigkeiten die Direktion des Theaters am Gänsemarkt niederlegte und nach einer triumphalen Gastspielreise ein Engagement am Hofburgtheater annahm, folgte ihm seine Frau nach Wien. Dort stand das Ehepaar zuerst in Hebbels "Agnes Bernauer" gemeinsam auf der Bühne. Die Wiener Jahre wurden für Anna Christina Schröder insofern nicht ganz leicht, als sie ihrem Alter entsprechend damals ausschließlich Liebhaberinnen spielte, von deren leichten und komischen Ausprägungen das Publikum erwartete, dass sie in Wiener Mundart gesprochen wurden, so dass Anna Christina Schröder viele Rollen nicht übernehmen konnte.
1785 kam das Paar nach Hamburg zurück, wo Schröder nach einer kurzen Zeit am Altonaer Schauspielhaus erneut die Leitung des Theaters am Gänsemarkt übernahm. Seine zweite Direktionsperiode (1786-1798) war nicht mehr von dem Rang der ersten, was z.T. daran lag, dass die literarischen Verhältnisse gesunken waren. Höhepunkt im Schauspiel dieser Jahre war 1787 die Uraufführung des "Don Carlos", in der Anna Christina Schröder neben ihrem Mann als König Philipp die Elisabeth mit großem Erfolg spielte. Danach trat sie in einer Vielzahl heute kaum noch gespielter Stücke, vornehmlich in den damals sehr beliebten Unterhaltungsdramen von Kotzebue und Iffland, auf. 1795 zog sie sich aufgrund ihres angegriffenen Gesundheitszustandes vom Theater zurück. Als Schröder jedoch durch interne Querelen in Personalnot geriet, war sie sofort bereit, einzuspringen und selbst neue Rollen einzustudieren. Bis zuletzt setzte sie sich für das Schaffen ihres Mannes ein. Als in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts der Plan gefasst wurde, das alte Theatergebäude durch ein neues Haus auf dem "Kalkhof" am Dammtor zu ersetzen, versuchten die Erben Schröders zunächst, einen solchen Bau zu verhindern. Anna Christina Schröder stimmte dann aber doch zu, weil die Vereinbarungen den Fortbestand einer wichtigen Hinterlassenschaft ihres Mannes, die Pensions- und Sterbekasse für alle Bühnenschaffenden, sicherten.
Am 25. Juni 1829, 13 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, starb Anna Christina Schröder auf einem Landsitz in Rellingen bei Pinneberg, wohin sich das Ehepaar 1797 zurückgezogen hatte.
Text: Brita Reimers
Quellen:
¹ Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer: Friedrich Ludwig Schröder. Beitrag
zur Kunde des Menschen und Künstlers. 2 Bde. Hamburg 1819.
² Johann Friedrich Schütze: Hamburgische Theater-Geschichte.
Hamburg 1794.
³ Berthold Litzmann: Friedrich Ludwig Schröder. Ein Beitrag zur
deutschen Litteratur- und Theatergeschichte. 2 Teile. Hamburg und
Leipzig 1890-1894.
4 Zitiert nach: Hermann Uhde (Hrsg.): Denkwürdigkeiten des
Schauspielers, Schauspieldichters und Schauspieldirectors Friedrich
Ludwig Schmidt 1772-1841. Hamburg 1875.
|
|
 |
 |
 |
| Henny Schütz, geb. Winkens |
 |
 |
| 1.6.1917- 15.3.2001 |
| Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus |
Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bn 73, 433
Nach ihr ist seit 2010 die Henny-Schütz-Allee in Langenhorn benannt.
Henriette Wilhelmine Winkens wurde am 1. Juni 1917 in Hamburg-Langenhorn geboren. Als Jugendliche war sie Mitglied der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ, Jugendorganisation der SPD) Winterhude bis zu deren Verbot 1933. Als weiterhin widerstandspolitisch Aktive wurde sie 1935/36 in so genannte "Schutzhaft" genommen und kam ins Gefängnis Fuhlsbüttel. Es erfolgte eine Untersuchungshaft wegen Vorbereitung zum Hochverrat (Prozess Winkens, SAJ Winterhude). Henny Schütz kam ins KZ Moringen/Solling. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus war Henny Schütz ab 1945 als Wohnbezirkskassiererin der SPD Langenhorn-Nord tätig. |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Anita Sellenschloh |
| 26.12.1911 - 4.11.1997 |
| Lehrerin, Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus |
Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bo 73, 3
Nach ihr ist seit 2002 der Anita-Sellenschloh-Ring in Langenhorn benannt.
Tochter eines Eimsbüttler Bäckers, der wegen einer schweren Kriegsverletzung, die er sich im Ersten Weltkrieg zugezogen hatte, seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte und die meiste Zeit arbeitslos war. Wuchs in sehr armen Verhältnissen auf, musste bereits als Kind mitarbeiten, um zum kargen Unterhalt der Familie, die in der Satoriusstraße und später am Rellinger Weg lebte, beizutragen.
|
Trotzdem die Möglichkeit, die damalige "Reformschule" in der Telemannstraße, die die Selbstständigkeit und individuelle Entwicklung der Schülerinnen und Schüler förderte, zu besuchen.
Im Alter von sechzehn Jahren Beitritt zunächst bei den "Falken", der sozialistischen Arbeiterjugend, wechselte bald zum Kommunistischen Jugendverband Deutschlands (KJVD). Nahm an Demonstrationen teil, spielte politisches Straßentheater, so in der Agit-Prop-Truppe "Rote Kolonne". Lernte Kurt von Appen kennen, verlobte sich mit ihm.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit im KJVD 1929 ausgewählt für eine Delegation in die Sowjetunion. "Vier Monate arbeitete sie in einer Leningrader Zigarettenfabrik und fand engen Kontakt zu den russischen Arbeiterinnen. Zu dieser Zeit schien ihr Traum von einer sozialen Gleichheit in der Sowjetunion verwirklicht: Sie schlief mit der Betriebsleiterin in einem kleinen Zimmer auf dem Fabrikgelände und fühlte sich wie in einer Familie aufgenommen." 1)
Zurück in Deutschland 1930 beauftragt "mit dem Aufbau der Antifa-Jugend in Hamburg. Sammelte in dieser Tätigkeit wichtige Erfahrungen, die zu ihrem klugen Verhalten in der illegalen Arbeit während der NS-Zeit beigetragen haben.
Obwohl 1928 nach der mittleren Reife die Aufnahmeprüfung für eine Ausbildung als Sozialarbeiterin als Zweitbeste bestanden, keine Ausbildungsstelle: ein frühes, politisch motiviertes Ausbildungsverbot. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sie Lehrerin werden. Zwanzig Jahre lang hielt sie sich mit Jobs als Bürokraft in den unterschiedlichsten Hamburger Betrieben über Wasser. Die einzige politisch interessante Tätigkeit war ihre Arbeit im Verlag ‚Der Arbeitslose' unter dem Chefredakteur Hermann Beuck. Die Zeitung mit dem Untertitel ‚Kampforgan der Erwerbslosen, Pflicht- und Fürsorgearbeiter' sollte die Arbeitslosen politisch informieren und aktivieren, gleichzeitig umfaßte sie einen umfangreichen Inseratenteil. Nach Verbüßung seiner Haft in der Festung Bergedorf traf Anita in der Redaktion auch Willi Bredel, der Artikel für die Zeitung verfaßte.
Ende 1931 wurde der Hamburger Verlag aufgelöst und die Anzeigenwerbung in Berlin zentralisiert. (…) Vier bis fünf Akquisiteure besorgten aus dem ganzen Reich Anzeigen, meist von kleinen Geschäftsleuten. In der Verwaltung arbeiteten acht bis neun Mitarbeiter. Anita leitete zusammen mit Martha Bleckmann die Mahnabteilung. Hier arbeitete Anita mit der Hamburgerin Lucie Suhling [siehe: Lucie-Suhling-Weg] zusammen. Zwischen den beiden entwickelte sich eine enge Freundschaft, (…)." 1)
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 Verbot der Zeitung, Rückkehr Anita Sellenschlohs nach Hamburg. Bis 1943 neun Mal verhaftet, während der Verhöre im "Stadthaus" - dem Gestapo-Hauptquartier - brutal misshandelt und mehrere Male inhaftiert.
Das erste Mal Verhaftung im Juni 1933, kam in Einzelhaft ins UG Hamburg: " ‚Kurt und ich hatten einen Liedanfang. Ich saß im obersten Stockwerk in der Zelle. So oft es möglich war, kam Kurt unten die Wallanlagen entlang und pfiff dieses Lied. Ich ging dann an das Zellenfenster, und so konnten wir uns sehen und heimlich zuwinken. Natürlich war es verboten und ich mußte sehr aufpassen. Aber irgendwie schafften wir es immer. (..) Das letztemal sah ich ihn vom Zellenfenster aus…' Während Anita von diesem letzten Blick, den beide tauschten, spricht, sucht sie Fotos heraus. ‚Nur wenige Fotos sind mir geblieben.' Sie bewahrt sie sorgfältig in einem wunderschönen Holzkästchen auf. ‚Eine Intarsienarbeit. Kurt hat sie mir gemacht - eine kunstvolle Arbeit. Er war ein hervorragender Kunsttischler.' In diesem Kästchen hütet sie auch seine Briefe." 2)
Sofort nach der Freilassung, schreiben und verteilen von Flugblättern und Kuriertätigekiten zwischen verschiedenen Widerstandsgruppen.
1937 erneute Verhaftung. Nachdem die Gestapo erfahren hatte, dass Anita Sellenschloh Briefe aus Spanien erhalten hatte, wohin Kurt von Appen gegangen war, um dort in den internationalen Brigaden gegen den Faschismus zu kämpfen, teilte "ihr der Chef der Gestapo, Kraus, mit zynischem Lächeln mit: ‚Kurt von Appen ist vor Madrid gefallen.' Sie wird abgeführt - in eine dunkle Einzelzelle gesperrt und weiß nicht, soll sie glauben, was er sagte, oder ist es eine Lüge, um sie einzuschüchtern. Sie ist 25 Jahre alt und will es nicht glauben." 2)
1943 Heirat mit dem Gewerbeoberlehrer Sellenschloh, ein politisch Gleichgesinnter, Geburt einer Tochter, Flucht mit ihrer Familie aus dem durch die Bombenangriffe schwer zerstörten Hamburg aufs Land nach Schleswig-Holstein.
Nach Kriegsende Ausbildung im Seminar von Anna Siemsen zur Lehrerin, ein langgehegter Berufswunsch. Unterrichtete ab 1948 an der Fritz-Schumacher-Schule, bis sie 1952 an der Volks- und Realschule Am Heidberg Lehrerin wurde. Hier arbeitete sie bis zu ihrer Pensionierung 1974. Ein Schwerpunkt ihres Unterrichts war die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus.
Erhielt 1947 von einem ehemaligen Spanienkämpfer die Bestätigung, dass Kurt Appen 1936 "gefallen" war.
"Eine bittere Erfahrung mußte sie mit ihrer eigenen Partei machen: 1951 wurde sie aus der KPD ausgeschlossen. Ihr angebliches Vergehen gegen die Parteidisziplin: eine nicht ‚genehmigte' Fahrt zu Genossen nach Dänemark. Dieser Ausschluß traf sie tiefer als alle Erniedrigungen in der NS-Zeit: grundlos von den eigenen Freunden und Genossen geschnitten zu werden, ist weit schlimmer als zu wissen, wofür man kämpft und Opfer auf sich nimmt. Trotzdem blieb Anita bis zu ihrem Tode eine überzeugte Kommunistin." 1)
Nach ihrer Pensionierung widmete sie sich verstärkt ihrem sozialen Engagement, trat als Zeitzeugin an Schulen und Universitäten auf, war eine der Gründerinnen der Willi-Bredel-Gesellschaft e.V., Mitglied bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), und beim Auschwitz-Komitee.
Text: Rita Bake
Quellen:
1) Rundbrief 1998 der Willi-Bredel-Gesellschaft, Geschichtswerkstatt e.V.
2) Gerda Zorn: Rote Großmütter, gestern und heute. Köln 1989, S. 28f.
2 Gerda Zorn, a. a. O., S. 29.
|
|
 |
 |
 |
| Hannchen Sieveking, geb. Reimarus |
 |

Bildquelle: Deutsches Geschlechterbuch 23. Hamburg 4. 1913 |
| 20.11.1760 Hamburg - 12.6.1832 Hamburg |
| Mittelpunkt des gesellschaftlichen Treffpunktes auf dem Sievekingschen Landhaus in Neumühlen |
Ohlsdorfer Friedhof Grab Nr. S 26, 1-10
Sievekingdamm, Hamm, seit 1945, benannt nach ihrem Sohn Dr. Karl Sieveking (1787-1847)
Caspar Voght, der wohl engste Freund, schrieb in seinen Lebenserinnerungen über Hannchen Sieveking: "Der Geist des alten Vaters ruhte in ihren Zügen; der Ton ihrer Stimme drang ins Herz des Leidenden, den ihre Blicke an sich zu ziehen schienen. Ihr Leben war Liebe, ihre Liebe war Tat. Mit dieser Liebe hing sie an mir und meiner Geliebten." 3), und ein Jahr vor seinem Tode 1838, als er seinen Abschiedsbrief verfasste, bekannte er seinem Patenkind, Hannchens Sohn Karl Sieveking: "Sie hat mich am besten verstanden und am dauerndsten und am reinsten geliebt." 4)
Auch wenn der Ton Wilhelm von Humboldts im Ganzen zurückhaltender ist, spricht auch aus ihm Verehrung und Anerkennung:
|
"Frau Sieveking hat ein anziehendes und vielversprechendes Äußeres, und man findet in ihr das überaus seltene Talent, einer sehr großen Haushaltung im genauesten Verstande treu und aufmerksam vorzustehen, und sich doch darum ganz und gar nicht der Gesellschaft zu entziehen. Dabei ist sie durchaus anspruchslos und bescheiden. Es ist schlechterdings unmöglich, angenehmer, als in ihrem Hause zu sein, in dem sich aller Überfluß des Reichtums mit der ganzen natürlichen Einfachheit des Mittelstandes verbindet." 5)
Und auch Hannchen Sievekings eigene Worte bestätigen dieses übereinstimmende Bild der Zeitgenossen, als sie am Ende ihres Lebens sich und ihr Wirken in einem Brief an ihre Kinder darstellt. "Ich fühle, daß ich alt werde und erschrecke nicht, denn ich bin mir keines Unrechts bewußt; nichts, was an meiner Ruhe nagt. Ich vertraue auf Gott und danke ihm für sor viel Gutes, was mir geworden ist und mein Alter freundlich macht. Das Schicksal und die Unvollkommenheiten des Lebens lehrten mich, kleine Plackereien zu ertragen. So werde ich denn das Leben voll Dank und Liebe verlassen. Gott segne Euch in Euren Kindern und gebe und erhalte Euch Freunde wie ich sie hatte und noch habe; dann veraltet und verkümmert das Herz nicht. Die nicht mehr sind, leben in uns fort, denn nichts vergeht ohne Spur, und die göttliche fühlen wir." 6)
Hannchen, wie sie allgemein genannt wurde, war eine geborene Reimarus, Tochter aus einer der ersten Familien der Stadt. Ihr Vater war der Arzt und Gelehrte Johann Albert Heinrich Reimarus, die Mutter Anna Maria Thorbecke. Hannchen heiratete einen der kenntnisreichsten Hamburger Kaufleute der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Georg Heinrich Sieveking. Die Familien Reimarus und Sieveking bildeten um sich herum zwei bedeutende gesellschaftliche Kreise der Stadt.
Nach dem sehr frühen Tod der Mutter am 17. Januar 1762 nahm sich Elise Reimarus, die Schwester von Johann Albert Heinrich Reimarus, der Nichte an. Als der Vater Sophie Hennings, die Schwester des Aufklärers August Hennings, heiratete, entfaltete sich im Hause eine reichhaltige Gastlichkeit. Hier traf sich alles, was von geistiger und literarischer Bedeutung in der Stadt war oder dorthin kam. So verkehrten hier auch die Kaufleute Caspar Voght und Georg Heinrich Sieveking, die seit dem Tod von Voghts Vater im Jahre 1781 dessen Firma gemeinsam führten. Am 2. Oktober 1782, nach zweimonatiger Verlobungszeit, wurde die Hochzeit gefeiert.
Das Paar wohnte zunächst in Harvestehude, denn wenn möglich, zog man damals aus der Enge der Stadt uns Freie. In Harvestehude wurden die ersten beiden Kinder Johannes (1785) und Karl (1787) geboren. Bald jedoch musste die kleine Familie das nur gemietete Haus verlassen, sie zog an den Neuen Wall 149, wo auch das Kontor untergebracht war. Ein Garten vor dem Dammtor ermöglichte jetzt, der Stadt zu entfliehen. Hier wurde am 14. Juli 1790, dem ersten Jahrestag der Erstürmung der Bastille, die berühmte Revolutionsfeier abgehalten, die Hamburg den Ruf einer liberalen Oase einbrachte.
Im Jahre 1793 erwarb man gemeinsam mit zwei Freunden, dem Kaufmann Conrad Johann Matthiessen und dem Schriftsteller und Herausgeber des "Altonaer Merkur" Piter Poel, ein Landhaus in Neumühlen, ein schlichtes Anwesen, auf dem Hang gelegen, mit einem herrlichen Blick über die Elbe. Für die Ausgestaltung von Haus und Garten holte man sich den aus Frankreich stammenden Baumeister und Gartenarchitekten Joseph Ramée. Während Matthiessen nach drei Jahren, bei seiner Vermählung, aus der Gemeinschaft ausschied, lebten die Familien Sieveking und Poel in Eintracht miteinander weiter, die Frauen führten in wöchentlichem Wechsel den Haushalt: "Friederike und ich leben sehr innig zusammen; wir haben herausgefunden, daß wir in dieser kleinen Republik die Gewalt haben, und da wir nur das Gute wollen, behält das Gute die Oberhand," 7) schrieb Hannchen Sieveking 1794 an Voght. Der Landsitz in Neumühlen entwickelte sich zu einem geselligen Mittelpunkt der Stadt, und das war in erster Linie Hannchen Sieveking zu verdanken. Sie war sicherlich keine intellektuelle Frau wie ihre Stiefmutter Sophie Reimarus und wohl zu recht hatte Elise Reimarus über die Nichte geurteilt: "Sie ist neunzehnjährig, nicht sehr für die Philosophie, recht liebenswürdig und beliebt: Wenn sie doch nur einen guten Mann kriegte." 8) Hannchens Talente lagen ganz offensichtlich mehr im Bereich der Herzensbildung als der Bildung, dort aber, wie die vielen Stimmen von Zeitzeugen belegen, in ganz ungewöhnlichem Maße.
Bei den Geselligkeiten auf dem Landsitz in Neumühlen ging es viel lebhafter und mannigfaltiger als am "Theetisch" im Hause Reimarus zu. Es war im Handelshaus, dem Sieveking zu Weltruf verholfen hatte - Voght war 1793 ausgeschieden, weil seiner geistigen Unabhängigkeit jedes Geschäft zuwider war -, üblich geworden, alle Fremden, die in Geschäften kamen, für den nächsten Sonntag nach Neumühlen einzuladen. Dazu gesellten sich Freunde aus der Stadt und durchreisende Schriftsteller und Gelehrte, später auch unzählige Emigranten. Oft wurde am Sonntag der Tisch für 80 und mehr Personen gedeckt. Karl August Böttiger berichtet, wie zwanglos und herzlich es dabei zuging: "Die Tafel ist gut und fein und reichlich, aber nicht übermäßig besetzt (…). Jeder nimmt sich oder läßt sich geben, von welcher Schüssel er will (…). Jeder fordert sich Wein, welchen er will (…). Jeder steht vom Tische auf, geht zu einem Andern, zu Mehreren, zu Allen, wie es ihm einfällt, und so lange es ihm gefällt. (…) Er geht dann in den Garten, (…) besieht Kupferstiche, Gemälde, durchblättert Bücher (…). Kurz, jeder ist frei für sich und hat keine andre Verbindlichkeit, als andre ebenso frei zu lassen, wie er selbst ist." 9) Hier in Neumühlen wurden Klopstocks Geburtstage begangen, Hochzeiten und Taufen von Mitgliedern aus dem weiteren Familienkreis gefeiert. Im Sommer weilten häufig Logiergäste in dem geräumigen Haus.
Auch wenn immer wieder von dem unausgeglichenen und aufbrausenden Temperament Sievekings zu lesen ist, unter dem Hannchen zu leiden hatte, so dass Josef Nyary am 17.3.1977 im "Hamburger Abendblatt" meinte, urteilen zu können, "für die Braut wurde es keine leichte Ehe", soll hier festgehalten werden, dass Hannchen selbst es offenbar anders sah. In einem Brief an ihren Mann schrieb sie: "Ich kann's Dir nicht oft genug wiederholen, daß es mich unendlich freut, daß ich wirklich das Vermögen habe, Dich glücklich zu machen, daß ich das wirklich kann. Gewollt habe ich's gewiß immer, aber ich habe oft daran gezweifelt, weil ich an mir selbst zweifelte. Glaubst Du's nicht auch, daß wir auch auf die Länge glücklich sein werden, daß wir uns nur noch immer fester aneinander ketten werden? Wenn ich das so nachdenke, so deucht es mich zuviel verlangt, zuviel vorgestellt, und dann fange ich an, für die Zukunft zu zittern. Was haben wir für so viele Menschen voraus, die so ein hartes Schicksal haben? Und die vielleicht besser sind als wir? Ich schäme mich oft meiner Undankbarkeit, aber das Herz ist mir doch so schwer, daß ich nicht imstande bin, die Grillen los zu werden. Just eben zu der Zeit, wenn ich am lebhaftesten fühle, am deutlichsten einsehe, wie ohne alles Verdienst mein Schicksal so gütig ist, dann sehe ich's auch am deutlichsten, daß noch vieles über uns verhängt ist, und daß unser Leben nicht immer so schlichtweg fortdauern kann." 10)
Hannchen sollte mit ihren Ängsten recht behalten. Am 25. Januar 1799, drei Tage vor seinem 48. Geburtstag, starb Georg Heinrich Sieveking nach einem schweren Brustkrampf. Nach 16jähriger Ehe stand Hannchen Sieveking mit 38 Jahren und fünf Kindern, von denen das älteste 13 Jahre, das jüngste noch kein Jahr alt war, alleine da.
Sie führte das Handelshaus zunächst zusammen mit den Teilhabern Bertheau und Schlüter weiter und erhielt auch der Familie und den Freunden den Landsitz in Neumühlen. Bedingt durch die Kontinentalsperre wurden die wirtschaftlichen Schwierigkeiten jedoch so groß, dass das Handelshaus 1811 Konkurs anmelden musste: "Über Sievekings trauerte die ganze Stadt", 11) schrieb Henriette Harder, die Tochter des Senators Johann G. Graepel, an ihre Stiefschwester. 1810 hatte Hannchen bereits ein Schicksalsschlag getroffen, als die einzige Tochter, Sophie, achtzehnjährig an einer Lungenentzündung starb. Zu ähnlicher Selbstverleugnung wie ihre Mutter geneigt, war die Kränkelnde in einer stürmischen Nacht auf Notrufe von der Elbe zu Nachbarn gelaufen, um Hilfe zu holen.
Voller Bewunderung berichtete Piter Poel, mit welcher Haltung und Souveränität Hannchen Sieveking den Unglücksfällen begegnete: "Trotz vollkommenster Weiblichkeit besitzt sie einen männlichen Geist, der ungetrübt durch Vorurteil und Illusionen, die Verhältnisse klar durchschaut und männlich wie ihr Verstand, ist auch ihr Mut, wenn große Unglückfälle ihr schwere Opfer auferlegen, Ich habe sie in dem Augenblicke gesehen, in welchem ihr angekündigt wurde, daß ihr Handlungshaus seine Zahlungen einstellen müsse (…), da erklärte die Sieveking sogleich mit der größten Fassung, daß sie alles unbedingt in die Hände der ratenden Freunde lege, die ihr ganzes Vertrauen, wie das des Publikums besäßen; nur bat sie, soweit es auf eine rechtliche Weise geschehen könne, Rücksicht auf die nicht vermögenden Freunde zu nehmen, die ihre Gelder dem Haus anvertraut hätten. Für sie selbst war ihr Entschluß augenblicklich gefaßt; sie gab Haus und Garten mit allen Kostbarkeiten auf und kehrte zurück in die väterliche Wohnung, um wieder, wie sie sagte, in die Verhältnisse einzutreten, in denen sie sich als 20jähriges Mädchen so glücklich gefühlt; ihre Knaben würden sich schon wie so viele andere ohne Vermögen, vielleicht sogar zu ihrem Besten, durchschlagen; für die Tochter hatte sie nicht mehr zu sorgen, die war bereits im Frühjahr vorher gestorben." 12)
Hannchens Vaters starb im Jahre 1814, die Mutter, die lange bettlägrig gewesen und von Hannchen aufopfernd gepflegt worden war, am 30. September 1817. Nach dem Tod war, am 30. September 1817. Nach dem Tod der Eltern verdiente Hannchen ihren Unterhalt, indem sie einige Zimmer vermietete, zumeist an junge Kaufleute aus bekannten Familien. An einem Abend in der Woche lud sie zum Teetisch ein, zu dem sich auch die alten Freunde einstellten. Und auch Caspar Voght mietete sich manchmal im Winter bei ihr ein. Er, der u. a. wegen seiner unmöglichen Liebe zu der Freundin Hannchens, Magdalena Pauli, auf jahrelange reisen gegangen war und mit dem Hannchen einen vielseitigen und regen Briefwechsel geführt und den Postillon d'amour für ihn gemacht hatte, war endgültig auf seinen Landsitz nach Flottbek zurückgekehrt. Hier, wo inzwischen auch Piter Poel mit seiner Familie lebte und Magdalena Pauli sich oft aufhielt, war Hannchen häufig zu Gast.
Text: Brita Reimers
Quellen:
1) Joist Grolle: Karl Sieveking, in: Hamburgische Biografie. Personenlexikon. Hrsg. von Franklin Kopitzsch und Dirk Brietzke. Bd. 2. Göttingen, 2006, S. 362. In dieser Biografie noch Weiteres zum Schaffen Karl Sievekings.
2) Gabriele Hoffmann: Das Haus an der Elbchaussee. Die Godeffroys - Aufstieg und Niedergang einer Dynastie. Hamburg 1998, S. 90 f.
3) Zit. nach: Georg Heinrich Sieveking: Lebensbild eines Hamburgischen Kaufmanns aus dem Zeitalter der französischen Revolution. Kapitel VII. Berlin 1913.
4) Zit. nach: Georg Heinrich Sieveking, a. a. O.
5) Zit. nach: Georg Heinrich Sieveking, a. a. O.
6) Zit. nach: Alfred Aust: "Mir ward ein schönes Loos", Liebe und Freundschaft im Leben des Reichsfreiherrn Caspar von Voght. Hamburg 1972.
7) Zit. nach: Georg Heinrich Sieveking, a. a. O.
8) Zit. nach Alfred Aust, a. a. O.
9) Zit. nach: Georg Heinrich Sieveking, a, a. O.
10) Zit. nach: Georg Heinrich Sieveking, a. a. O.
11) Zit. nach: Alfred Aust, a. a. O.
12) Gustav Poel: Bilder aus vergangener Zeit nach Mitteilungen aus großenteils ungedruckten Familienpapieren, Teil II. Kapitel I. Hamburg 1887.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Lucie Suhling, geb. Wilken |
| 20.6.1905 - 28.10.1981 |
| Widerstandskämpferin, Mitglied der KPD, Kaufmännische Angestellte |
Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bn 73, 248
Nach ihr wurde 1985 der Lucie-Suhling-Weg in Hamburg Bergedorf benannt.
Nach dem Besuch der Volks- und Handelsschule, Lehre als kaufmännische Angestellte. Ab 1927 Mitarbeiterin bei der Internationalen Arbeiterhilfe in Essen, später Mitarbeiterin der KPD, Bezirk Ostpreußen und freie Mitarbeiterin der Partei-Zeitung in Königsberg. 1932 Heirat, danach bei der "Hamburger Volkszeitung" bis zum endgültigen Verbot der kommunistischen Zeitungen und der KPD. Ab 1933 erwerbslos, September 1933 Geburt der Tochter, der 1940 und 1942 zwei Söhne folgen. Seit 1933 in der Widerstandsbewegung.
|
1934 erste Verhaftung und Einlieferung in das Konzentrationslager Fuhlsbüttel. Verurteilung zu zwei Jahren Zuchthaus wegen "Vorbereitung zum Hochverrat". 1936 Entlassung. Wieder illegale Arbeit, erneute Verhaftung 1938. KZ Fuhlsbüttel bis 1939. Lucie Suhling und ihr Mann Carl waren Mitglieder der KPD. Ihre illegale Tätigkeit bestand u. a. darin, Personalunterlagen von KPD-Mitgliedern in ihrem Siedlungshaus in Hamburg-Langenhorn zu verstecken. Nachdem Carl Suhling 1933 drei Monate in Haft gesessen hatte und mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt worden waren, vernichtete das Ehepaar Suhling die Dokumente. 1)
1934 bis 1936 war Lucie, 1933 und 1934 bis 1937 war Carl inhaftiert. Nach ihrer Entlassung führten Lucie und Carl in kleinerem Umfang illegale Tätigkeiten aus, da der Kontakt zu alten Freunden weitestgehend abgebrochen war. Die beiden arbeiteten nun meist allein. Mit dem Kinderdruckkasten ihrer Tochter stellten sie Flugblätter mit der Aufschrift: "Wehrt Euch! Es gibt Krieg" her. Außerdem malten sie mit einem befreundeten Ehepaar Parolen an Häuserwände.
Das Ehepaar Suhling wohnte bei Lucies Schwiegereltern. Da diese fürchteten, ebenfalls verhaftet zu werden, mussten sich Lucie und Carl eine andere Bleibe suchen. Sie zogen 1938 mit ihrer Tochter zu Katharina Hochmuth, der späteren Frau von Franz Jacob. 1) Dort traf man sich mit anderen Kommunisten zu geselligen Abenden und diskutierte über politische Ereignisse. Am 30. Dezember 1938 wurden Lucie und Carl wieder festgenommen und im KZ Fuhlsbüttel inhaftiert. Die Tochter kam ins Waisenhaus. 1943 kam Carl Suhling in das berüchtigte Strafbataillon 999. Er kehrte nicht zurück. Lucie Suhling überlebte, war nach der Befreiung aktiv in der Partei und im VVN/ Bund der Antifaschisten tätig. Sie berichtete als Zeitzeugin an Schulen und der Universität über ihre Erfahrungen während der Nazizeit. In ihren letzten Lebensjahren schrieb sie ihre Erinnerungen auf. "Der unbekannte Widerstand" erschien 1980 und in 2. Auflage 1998.
Text: Rita Bake
Quellen:
1) Vgl: Gerda Zorn: Frauen gegen Hitler. Frankfurt am Main 1974.
2) Vgl: Andreas Klaus: Gewalt und Widerstand in Hamburg-Nord während der NS-Zeit. Hamburg 1986.
|
|
 |
 |
 |
| Ebba Tesdorpf |
 |

Bild aus: Gisela Jaacks: Gesichter und Persönlichkeiten. Bestandskatalog der Porträtsammlung im Museum für Hamburgische Geschichte. Hamburg 1992. |
| 23.1.1851 Hamburg - 22.2.1920 Ahrweiler |
| Zeichnerin und Dokumentaristin Alt-Hambrugs |
Althamburgischer Gedächtnisfriedhof, Grabplatte "Graphiker"
Tesdorpfstraße, Rotherbaum (1898), benannt nach Adolph Tesdorpf (1811-1887), Senator, Landherr. Adolph Tesdorpf war ein Enkel des Lübecker Bürgermeisters Peter Hinrich T.; Ebba T. war eine Urenkelin dieses Bürgermeisters.
"In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts [gemeint ist das 19. Jhd.] konnten die Bewohner der Hamburger Aktstadt und der hafennahen Viertel folgendes beobachten: In einer winkligen Straße sitzt auf dem Beischlag eines alten Bürgerhauses bei Wind und Kälte eine Frau in einem abgetragenen Mantel mit einem Kapotthut auf dem Kopf, und ihre klammen Hände führen in konzentrierter Arbeit den Zeichenstift über das Papier.
|
Eine Anwohnerin verspürt Mitleid mit der - wie sie glaubt - armen Zeichnerin, der man etwas Gutes tun muß und bringt ihr eine Kanne heißen Kaffees. Eine kleine Episode, die sich ähnlich oft wiederholt." 1) Niemand ahnte, dass diese ärmlich wirkende Frau, die mit ihrem Zeichengeräte durch die Gassen Hamburgs streifte und nach lohnenden Motiven suchte, eine wohlhabende Kaufmannstochter war.
Ebba Tesdorpf stammte aus einer reichen, seit Generationen in Hamburg ansässigen und mit führenden Handelshäusern in Amsterdam, Kopenhagen und Lübeck verwandten Kaufmannsfamilie. Sie wurde am 25. Januar 1851 als Tochter des Kaufmannes Hans Peter Friedrich Tesdorpf und seiner Ehefrau Antoinette Caroline geb. Mohrmann verw. Abendroth geboren. Zusammen mit ihrer um zwei Jahre jüngeren Schwester Olga wuchs sie am Holzdamm in St. Georg auf, in einer Umgebung, die bestimmt war durch großbürgerliche Villen, deren Gärten bis zur Alster hinunterreichten.
Malunterricht erhielt sie wie Julie de Boor bei Bernhard Mohrhagen. Doch während Julie de Boor (deren Grabstein steht im Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof) bei der damals für vornehmer gehaltenen Ölmalerei blieb, wandte sich Ebba Tesdorpf unter dem Einfluss des Architekturzeichners und Landschaftsmalers Johann Theobald Riefesell, bei dem sie nach Mohrhagens Tod im Jahre 1877 Unterricht erhielt, dem Zeichnen zu. Auf seine Anregung und nach seinem Vorbild begann sie mit der zeichnerischen Bestandsaufnahme des alten Hamburger Stadtbildes während der großen städtebaulichen Umwälzungen in den 1880er- und 1890er-Jahren. Der Zollanschluss im Jahre 1888, der den Bau des Freihafens auf der Wandrahmsinsel zur Folge hatte, auf der viele der ältesten und vornehmsten Kaufmannshäuser standen, die großen Straßendurchbrüche, die neue Verkehrswege im Innern der Stadt schaffen sollten, sowie Sanierungsbauten führten zum Abbruch ganzer Stadtviertel. Fast 1000 Häuser verschwanden, und mehr als 20 000 Menschen mussten umgesiedelt werden. Lichtwark, der damalige Direktor der Kunsthalle, sprach spöttisch von der "Freien und Abbruchstadt Hamburg": "Wohl keine Kulturstadt der Welt hat je eine solche Selbstzerstörungslust entwickelt wie Hamburg. Hamburg hätte die Stadt der Renaissance sein können, des Barock und des Rokoko - doch all diese Schätze wurden stets begeistert dem Kommerz geopfert. An die Stelle barocker Wohnhäuser wurden neubarocke Kontorblocks getürmt und noch immer ist jeder Neubau ein Schlag ins Gesicht der Stadt."
Ebba Tesdorpfs Zeichnungen, die oft in letzter Minute vor dem Abriss der Bauten entstanden, sind Urkunden der Vergangenheit. Sie konzentrieren sich auf den Innenstadtbereich, auf dessen Straßen, Gassen und Winkel mit ihren dichtgedrängten Häusern, Fleeten, Brücken und dem lebendigen Treiben. Mit einer ungeheuren Liebe zum Detail zeichnete sie auch die prächtigen Kaufmannshäuser, die Geschäfts-, Wohn- und Lagerhaus zugleich waren, mit ihren reichverzierten Portalen und den typischen Dielen, die den Mittelpunkt des häuslichen Lebens bildeten. Sie nahmen die Breite des ganzen Hauses ein und gingen durch zwei Stockwerke. Die die Decke tragenden Eichenpfeiler sowie die sich längs der Seitenwand des Hauses hinziehende Galerie waren reich geschnitzt, zum Teil mit phantastischen und komischen Figuren. Die Decken selbst waren mit reichem Stuck verziert. Das Tageslicht kam durch eine riesige Fensterfront zur Hofseite herein. Zur Straßenfront gab es ein Zirbürken, einen Raum, in dem eine alte Frau das Gehen und Kommen überwachte.
Allem verlieh Ebba Tesdorpf ein idyllisches Leben; Veränderung und Abbruch oder gar Sozialkritik (die Enge der alten hamburgischen Bauweise, die schon Reisende im 18. Jahrhundert in Erstaunen versetzt hatte, trug 1892 zur rasanten Ausbreitung der Cholera-Epidemie bei) waren nicht ihre Themen. "Die Zeichnerin des versunkenen Hamburg" nannte Richard Stettiner sie 1925.
Vom privaten Leben Ebba Tesdorpfs ist wenig bekannt und vermutlich auch wenig zu erzählen. Die Familie duldete ihre Lebensweise, konnte aber eigentlich kein rechtes Verständnis für Ebba Tesdorpfs künstlerische Arbeit und ihre Interessen aufbringen. Umgekehrt war Ebba Tesdorpf die so genannte Hamburger Gesellschaft mit ihren Geselligkeiten und Vergnügungen fremd. Äußerlich nach damaligem Geschmack nicht mit besonderen Reizen bedacht, machte Ebba Tesdorpf auch nichts aus sich, lebte anspruchslos und zurückgezogen. "Weltfremd, würde man heute wohl sagen", meint die Großnichte Renata Klée-Gobert.
Als Ebba Tesdorpf nach dem Tod der Eltern (1881, 1885) Erbin eines bedeutenden Vermögens wurde, unterstützte sie Bedürftige, vor allem Künstler, und begann, eine Hamburgensien-Sammlung zusammenzutragen, die schließlich 5000 Blatt umfasste. Einen alten Hamburger Trödler namens Rathansen, der ihr anfänglich ein sachverständiger Berater war, stellte sie später als Bibliothekar ihrer Sammlung mit einem nicht unbedeutenden Jahresgehalt an.
Als Mitte der 1890er-Jahre ihre Arbeit abgeschlossen war, fasste Ebba Tesdorpf den Entschluss, nach Düsseldorf in das Haus ihrer Freundin, der Malerwitwe und Mutter des Dichters Hanns Heinz Ewers, zu ziehen und an der dortigen Akademie zu studieren. Vorher vermachte sie im Jahre 1894 ihre Hamburgensien-Sammlung und ihre eigenen Zeichnungen, ca. 600 Blätter, und einige Aquarelle dem Museum für Kunst und Gewerbe. Begeistert dankte ihr der damalige Direktor Justus Brinkmann: "Mit hellem Jubel nehme ich ihre wundervolle Schenkung an; eine Schenkung, wie sie gleich wertvoll dem Museum nicht zuteil geworden ist. Sie überragt alle übrigen Sammlungen durch die in sie einverleibten treffliche zeichnerischen Aufnahmen von ihrer Hand, in denen sie mit emsigem Fleiß und vollem Verständnis sowohl für die malerischen Seiten des Stadtbildes, wie für die baulichen Einzelheiten den Abbrucharbeiten Schritt für Schritt gefolgt sind." Und die "Gesellschaft Hamburgischer Kunstfreunde", deren Mitglied Ebba Tesdorpf seit der Gründung im Jahre 1893 war, machte sie aufgrund ihres "hochherzigen Geschenkes" 1895 zum Ehrenmitglied und würdigte aus diesem Anlass noch einmal ihre Arbeit: "Ihr und einer gleichstrebenden Freundin (vermutlich Marie Zacharias) verdanken wir die genaueste Darstellung des alten Hamburg, das durch die neuen Hafenanlagen und durch den Durchbruch der Kaiser Wilhelmstrasse zerstört ist. Obgleich eine umfassende photographische Aufnahme seitens der Behörden stattgefunden hat, lässt sich dieses Material doch nicht entfernt mit den Zeichnungen von Fräulein Tesdorpf vergleichen. In hunderten von Blättern sind alle die merkwürdigen alten Bauten dargestellt, die den verschwundenen Stadttheilen ihr eigenartiges Gepräge gaben. Und diese Aufnahmen, das Werk hingebender Arbeit vieler Jahre, sind nicht auf den malerischen Effect allein gezeichnet, sondern treue Documente bis auf jeden Balkonkopf und jede Bank vor der Thür. Nach diesen Zeichnungen könnte jede Fassade sofort wieder aufgebaut werden."2
Was in dieser Laudatio deutlich wird, heben auch alle anderen Kritiker und Rezensenten hervor: Ebba Tesdorpf war keine Künstlerin von zukunftsweisendem Rang, aber eine ausgezeichnete Dokumentaristin, deren Zeichnungen eine Vorstellung vom Aussehen Hamburgs in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts vermitteln.
In Düsseldorf studierte Ebba Tesdorpf an der Akademie bei dem Landschaftsmaler German Grobe und empfing von ihm Anregungen in der Aquarellmalerei. Nach dem Urteil von Renata Klée-Gobert zeigen ihre Aquarelle, die sich in erster Linie in Familienbesitz befinden, eine ganz andere Seite der Begabung Ebba Tesdorpfs. "In ihren Aquarellen ... verzichtet sie auf allzu große Genauigkeit in der Nachahmung der Natur... Hier verbindet sich ein eigenwilliges künstlerisches Talent mit feinem Farbempfinden und einem sicheren Blick für das Wesentliche der Komposition."1 Zu einer neuen Schaffensperiode kam es jedoch nicht mehr. Ebba Tesdorpfs Nervenleiden verstärkte sich zunehmend. Ab 1901 lebte sie zeitweise wieder in Hamburg und unternahm Reisen mit ihren Nichten. Später zog sie nach Ahrweiler, wo sie am 22. Februar 1920 starb.
Ebba Tesdorpfs Schenkung an das Museum für Kunst und Gewerbe wurde mit dem Bau des Hamburg Museums dorthin gebracht. Zusammen mit den Beständen der Sammlung Hamburgischer Altertümer des Vereins für Hamburgische Geschichte bildet sie den Grundstock der Graphiksammlung des Museums. Wer allerdings nun zu wissen glaubt, wem die Tesdorpfstraße in Harvestehude gewidmet ist, der irrt. Denn sie wurde nach einem Verwandten Ebba Tesdorpfs, dem Senator Adolf Tesdorpf, der von 1811 bis 1887 lebte, benannt.
Text, Brita Reimers
Quellen:
1. Die Kunsthistorikerin Renata Klée-Gobert über ihre Großtante Ebba Tesdorpf im Hamburger Abendblatt vom 21.1.1951.
2. Jahrbuch der Gesellschaft Hamburgischer Kunstfreunde. Bd. 1-2. Hamburg 1895.
3. Siehe auch: Gisela Jaacks: Diese Frau sah mehr. Mit Ebba Tesdorpf durch Alt-Hamburg. Von der Herrlichkeit bis zur Kehrwiederspitze. Hamburg 1978.
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Frieda Thiele, geb. Müller |
| 8.12.1896 - 30.4.1981 |
| Widerstandskämpferin |
Grablage Ohlsdorfer Friedhof: Geschwister-Scholl-Stiftung, Bn 73, 432
Hausfrau, Mitglied der SPD nach 1945, 1 Jahr 8 Monate Untersuchungshaft Reichenau, Berlin-Moabit, Gefängnis Waldheim 1935-1937 wegen Vorbereitung zum Hochverrat.
|
|
 |
 |
 |
| Magda Thürey |
 |

Bild aus: Ulrich Bauche u. a. (Hrsg.): Wir sind die Kraft. Arbeiterbewegung in Hamburg von den Anfängen bis 1945. Hamburg 1988. |
| 4.3.1899 Hamburg - 17.7.1945 Hamburg |
| Lehrerin, Politikerin (KPD), Mitglied der Widerstandsgruppe Bästlein-Jacob-Abshagen |
Ohlsdorfer Friedhof, geschwister-Scholl-Stiftung, Grab: Nr. Bn 73, 92
Thüreystraße, Niendorf, seit 1982, benannt nach Magda, geb. Bär und Paul Thürey (16.7.1903 - 26.6.1944, enthauptet im Untersuchungsgefängnis Hamburg).
Stolperstein vor dem Wohnhaus Emilienstraße 30.
Magda Bär verbrachte ihre Kindheit mit ihrem Bruder Curt (geb. 1901) im Hamburger Stadtteil Harvestehude und besuchte das Emilie-Wüstenfeld-Lyzeum.
Die Mutter entstammte einer Großkaufmannsfamilie, der Vater einer Arbeiterfamilie, arbeitete als Kapitän und verstarb kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
Von 1914 bis 1919 besuchte Magda Bär das Lehrerseminar Hohe Weide im Stadtteil Eimsbüttel. Sie war auch künstlerisch interessiert und schloss sich in der Studienzeit bohèmeartigen Kreisen junger Menschen mit kommunistischen Ideen an.
|
Außerdem arbeitete sie in der Wandervogelbewegung und der Freideutschen Jugend mit. Anfang der 1920er trat Magda Bär in die KPD ein und war kurz vor 1933 zeitweilig für ihre Partei in der Hamburgischen Bürgerschaft als Spezialistin für Schulfragen tätig.
In den Jahren von 1919 bis 1933 unterrichtete sie Volksschulklassen an den Schulen Lutterothstraße 80 und Methfesselstraße 28 (ab 1930) im Arbeiterviertel Eimsbüttel.
Sie nahm ihre Arbeit sehr ernst, orientierte sich an den Erziehungsidealen Pestalozzis und kümmerte sich gerade um die ärmsten Kinder. Außerdem trat sie der Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens bei, aus der später die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hervorging.
1933 wurde sie von den Nationalsozialisten sofort ohne jeglichen finanziellen Ausgleich aus dem Schuldienst entlassen. Als Begründung diente den Machthabern das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums", dessen Paragraph 2 den BeamtInnen eine Mitgliedschaft in der KPD verbot.
Magda Bär heiratete ihren langjährigen Freund Paul Thürey, der damals bereits arbeitslos war, so dass die Eheleute nun, um sich eine Existenz aufzubauen, von ihren Ersparnissen ein Seifengeschäft in der Osterstraße im Stadtteil Eimsbüttel kauften, welches sie später in die Eimsbüttler Emilienstraße 30 verlegten.
Als Paul Thürey 1939 in den Conz-Elektromotoren-Werken, einem Rüstungsbetrieb, Arbeit fand, führte Magda den Laden allein weiter.
Der Seifenladen war von vornherein nicht nur als Erwerbsquelle gedacht gewesen, sondern diente gleichzeitig als Treffpunkt für die illegale KPD. Nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges fungierte der Laden insbesondere als wichtige Verbindungsstelle für die kommunistische Bästlein-Jacob-Abshagen-Widerstandsgruppe. In Seifenkartons wurden Flugblätter und illegale Druckschriften versteckt; es fanden Treffs statt, bei denen Informationen ausgetauscht und neue Aktionen geplant wurden.
1942 nahm die Hamburger Gestapo Paul Thürey fest. 1944 wurde er bei den Hamburger Kommunistenprozessen zum Tode verurteilt und am 26. Juni 1944 im Alter von 41 Jahren im Hamburger Untersuchungsgefängnis enthauptet.
Die 44-jährige Magda Thürey war von der Gestapo am 30. Oktober 1943 in "Schutzhaft" genommen und ins Gefängnis Fuhlsbüttel gebracht, der Seifenladen von der Gestapo zu einer Falle umfunktioniert worden, so dass es zu weiteren Verhaftungen kommunistischer Widerstandskämpfer und -kämpferinnen kam.
Durch die Haftbedingungen verschlechterte sich Magda Thüreys Gesundheitszustand rapide - sie litt seit ihrem 31-sten Lebensjahr an multipler Sklerose. Aber erst nachdem sie fast völlig bewegungsunfähig geworden war, wurde sie 1944 in das Krankenhaus Langenhorn auf die Station für Nervenkranke verlegt. Auch dort erhielt sie nicht die notwendige medizinische Versorgung. Magda Thüreys Bruder, ein Lehrer, der ebenfalls 1933 von den Nationalsozialisten aus dem Schuldienst entlassen worden war, konnte sie erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs aus der Gefangenschaft holen. Kurze Zeit später, am 17. Juli 1945, starb Magda Thürey im Alter von 46 Jahren an den Folgen der Gestapo-Haft.
Ihr Begräbnis wurde die erste und einzige große Einheitskundgebung der linken Arbeiterparteien in Hamburg. Über ihrem Grab reichten sich die Vertreter der SPD (Karl Meitmann) und KPD (Fiete Dettmann) symbolisch die Hände und versprachen "den Bruderkampf niemals wieder aufleben zu lassen".
Text: Ingo Böhle
|
|
 |
 |
 |

Photo: Staatsarchiv Hamburg, Conti-Press. |
 |
Dr. Elsbeth Weichmann, geb. Greisinger |
| 20.6.1902 Brünn - 10.7.1988 Bonn |
| First Lady der Stadt Hamburg, Bürgerschaftsabgeordnete (SPD) |
Ohlsdorfer Friedhof, Grab-Nr.: AA 15, 66
Der 26.6.1902 ist Dr. Elsbeth Weichmanns offizielles Geburtsdatum. In Wirklichkeit wurde sie jedoch bereits zwei Jahre zuvor geboren. Das falsche Geburtsjahr wurde versehentlich 1940, als sie sich auf der Flucht vor der Gestapo in Frankreich befand, bei der Ausstellung neuer Papiere eingetragen. Eine sofortige Korrektur hätte die tödliche Gefahr einer Verzögerung der Abreise gebracht und eine Richtigstellung in den USA die dortige Aufenthaltsgenehmigung gefährdet.
Die Tochter eines Sparkassendirektors wurde hauptsächlich von ihrer Mutter geprägt. In einem Interview für die "Welt am Sonntag" sagte Dr. Elsbeth Weichmann: "Ich habe nie eine unselbständige Frau erlebt. Meine Mutter hatte immer ihren eigenen Schreibtisch."
|
Im Alter von 25 Jahren (1927) promovierte Elsbeth Weichmann in Graz zur Volkswirtin. 1928 heiratete sie Herbert Weichman, den ehemaligen Chefredakteur der "Kattowitzer Zeitung" und frischgebackenen Staatssekretär des preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun. Nachdem er diesen Posten erhalten hatte, konnten sie schließlich nicht mehr "in wilder Ehe leben", so Elsbeth Weichmann in dem Interview.
1933 floh Dr. Elsbeth Weichmann mit ihrem jüdischen Mann nach Paris und wurde Wirtschaftsjournalistin. Nach eigener Aussage lernte sie von Herbert Weichmann den Journalismus und soll sogar Berichte in seinem Namen geschrieben haben: "Ich schrieb sogar seine Meinung, auch wenn ich gar nicht damit übereinstimmte. Aber ich wußte ja, wie er dachte." 1940 ging die Flucht weiter über Spanien und Portugal in die USA, denn Präsident Franklin Roosevelt hatte an besonders gefährdete Politiker Sondervisen erteilen lassen. Dr. Elsbeth Weichmann studierte Statistik an der New Yorker Universität. Ihren Lebensunterhalt bestritt sie mit dem Anfertigen von Stoffpuppen, die sie in Kaufhäusern verkaufte. Herbert Weichmann arbeitete als Wirtschaftssprüfer.
Über ihre Jahre im Exil schrieb Dr. Elsbeth Weichmann später ein Buch, welches unter dem Titel "Zuflucht" 1983 im Todesjahr ihres Mannes erschien.
1949 kehrte das Ehepaar nach Deutschland zurück und zog nach Hamburg. Max Brauer, der sich in New York mit dem Ehepaar befreundet hatte, hatte sie nach Hamburg geholt.
Dr. Elsbeth Weichmann engagierte sich hauptsächlich im Verbraucherschutz. Unter ihrem Vorsitz entwickelte sich die Verbraucher-Zentrale Hamburg zu einer viele Bereiche umfassenden Institution. Dr. Elsbeth Weichmann wurde Vor-standsmitglied der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände in Bonn und 1964 Präsidentin des Brüsseler Büros der Verbraucherverbände der EWG-Länder. Außerdem war sie zweite Vorsitzende des Bureau European des Consom-mateurs und Mitglied des mit den europäischen Behörden in Verbindung stehen-den Kontaktkomitees der Verbraucherorganisation.
Neben ihrer Arbeit als VerbraucherInnenschützerin beschäftigte sie sich mit kul-turpolitischen Fragen: "Sie setzte sich mit Nachdruck dafür ein, neue breitere Kreise für die Kultur zu gewinnen. Die Tatsache, daß im Mai 1969 die `Arbeits-gemeinschaft zur Kulturförderung` ins Leben gerufen werden konnte, ist zu ei-nem beträchtlichen Teil den Anregungen und der Mitwirkung von Frau Dr. Weichmann zu verdanken. Nachdem es für die Arbeitsgemeinschaft zunächst darum ging, wichtige praktische Aufgaben zu erfüllen, erkannte Frau Dr. Weichmann bald die Notwendigkeit, in einem Kulturbericht die Situation, Ent-wicklung und Problematik der Kulturarbeit und -politik in Hamburg aufzuzeichnen. Auf ihre Initiative hin wurde in Zusammenarbeit mit der Behörde für Wissenschaft und Kunst ein Studienkreis der `Arbeitsgemeinschaft zur Kulturförderung` gebil-det, der 1975 eine Broschüre unter dem Titel `Zur Kulturpolitik in Hamburg - Anre-gung und Empfehlungen eines unabhängigen Studienkreises` der Öffentlichkeit vorlegte. Diese Bestandsaufnahme stellte für alle am kulturellen Leben Ham-burgs beteiligten Personen und Institutionen eine wichtige Diskussions- und Ar-beitsgrundlage dar." 1 Dr. Elsbeth Weichmann hatte den Kuratoriumsvorsitz im Pressezentrum, den Vorsitz des neuen literarischen Vereins und war im Aufsichts-rat des Deutschen Schauspielhauses tätig. Für ihre Verdienste auf dem Gebiet der Kultur erhielt sie 1978 die Senator-Biermann-Rathjen-Medaille und 1974 für ihre herausragenden Verdienste um Hamburg die Bürgermeister-Stolten-Medaille.
Sie agierte außerdem als Mitglied der Verwaltungsausschüsse des Amtes für Wirtschaft, des Amtes für Ernährungswirtschaft und des Amtes für Marktwesen. Darüberhinaus war sie Mitglied der Deputation der Behörde für Ernährung und Landwirtschaft, Vorsitzende des Fachausschusses der Gesamtleitung "Program-mausschuß" der IGA (Internationale Gartenbauausstellung) 1973 und Aufsichtsratsmitglied der Hamburg-Altonaer-Fischmarkt GmbH, und von 1957 bis 1974 übte sie das Amt einer Abgeordneten (SPD) der Hamburgischen Bürgerschaft aus. Dort beschäftigte sie sich hauptsächlich mit Kulturpolitik.
Während der Amtszeit ihres Mannes als Erster Bürgermeister von Hamburg fun-gierte sie sechs Jahre lang als First Lady. Sie begnügte sich nicht mit der Funktion der "Frau an seiner Seite", sondern sah sich und ihren Mann als Team an: "Wir sind beide in einem Geschäft tätig gewesen. Mein Mann als Bürgermei-ster. Ich bin in der Bürgerschaft und in den Ausschüssen."
Zum Thema "Geschlechterkampf" gibt es von ihr ein fast schon geflügeltes Wort, das vor ihr bereits die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach im 19. Jhd. ähnlich formuliert hatte: "Jede kluge Frau hat Millionen natürlicher Feinde ... nämlich alle Männer, die nicht so klug sind wie sie selbst."
Das Ehepaar Weichmann nahm den Neffen Herbert Weichmanns als Adoptiv-sohn an. Seine Eltern waren im Konzentrationslager umgebracht worden, während er sich in Holland versteckt gehalten hatte. Er wurde später Professor für Physik in Kanada.
Dr. Elsbeth Weichmann starb am 10. Juli 1988 in Bonn an den Folgen eines am 20. Juni erlittenen Gehirnschlages. Im März 1988 war ihr noch die Ehrensenatorwürde der Hamburger Universität verliehen worden.
Text: Rita Bake
Quellen:
1) Mitteilung des Staatsarchives Hamburg anläßlich der Verleihung der Bürgermeister-Stolten-Medaille für Dr. Elsbeth Weichmann, 1984.
|
|
 |
 |
 |
| Sidonie Werner |
 |
 |
| 16.3.1860 in der Nähe von Posen - 27.12.1932 Hamburg |
| Volksschullehrerin, Vorsitzende des Israelitischen Humanitäts-Frauen- Vereins und des Jüdischen Frauenbundes |
Jüdischer Friedhof Ilandkoppel, Grab.-Nr.: L 1, 2
Geboren in einer angesehenen jüdischen Gelehrtenfamilie, war Sidonie Werners Bildungsweg fast schon vorprogrammiert: Besuch der höheren Mädchenschule, dann Lehrerinnenseminar. Nach Abschluß der Lehrerinnenausbildung Arbeit als Volksschullehrerin zuerst in Altona, später in Hamburg.
Sidonie Werner blieb unverheiratet. Ihr Leitspruch hieß: "Gesegnet wer seine Arbeit gefunden."
|
Danach lebte sie, und als sie an ihrem 70. Geburtstag, zu dem neben dem Senat auch Emma Ender und Klara Fricke gratulierten, auf ihr Leben zurückblickte, kam sie zu dem Schluß, daß: "der Segen der Arbeit aus einem einsamen Leben ein reiches, beschwingtes, weitblickendes Leben" machen kann.
Neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin arbeitete Sidonie Werner aktiv in der bürgerlichen Frauenbewegung. Dort vertrat sie den keineswegs von allen Frauen getragenen Standpunkt, daß sich Frauen nicht nur auf charitative Aufgaben beschränken sollten. Sie sollten stattdessen verstärkt versuchen, in die hauptsächlich von Männern besetzten Verwaltungsausschüsse zu gelangen, um mehr politischen Einfluß zu bekommen. Zudem hielt Sidonie Werner eine qualifizierte Berufsausbildung für Frauen für unerläßlich. Deshalb gehörte sie 1893 auch zu den Mitbegründerinnen des Israelitischen-Humanitäts-Frauen-Vereins (IHF), der einen Schwerpunkt seiner Arbeit in der Förderung von Frauenbildung, Frauenberuf und sozialer Frauenarbeit sah. Von 1908 bis 1932 wurde sie dessen Vorsitzende.
Der Verein gründete eine Ausbildungs- und Arbeitsstätte für Frauen und Mädchen plus Mittagstisch, einen Arbeitsnachweis für weibliche kaufmännische Angestellte und ein Kindererholungsheim in Bad Segeberg, dem eine Haushaltungsschule mit Gartenbetrieb angeschlossen war. In dieser Zeit gehörte Sidonie Werner auch zu den ersten Mitgliedern des 1904 auf Reichsebene gegründeten "Jüdischen Frauenbundes", dessen Vorsitzende sie von 1915 bis 1925 war. Sidonie Werner schrieb für diesen Verein die erste Flugschrift über das Frauenwahlrecht.
Als der Erste Weltkrieg begann, schloß sich der IHF dem Frauenausschuß der Hamburgischen Kriegshilfe an. 1915 war Sidonie Werner Gründungsmitglied des Stadtbundes Hamburgischer Frauenvereine, dessen stellvertretende Vorsitzende sie wurde. Emma Ender wurde ihre Vorstandskollegin. Außerdem erhielt Sidonie Werner den Vorsitz im Vereinsheim für jüdische Mädchen.
1919 wurde Sidonie Werner auf die Kandidatenliste der DDP (Deutsche Demokratische Partei) zur Bürgerschaftswahl aufgestellt, erhielt allerdings nur den aussichtslosen Listenplatz 76.
Als Sidonie Werner starb, lobte der Hamburger Anzeiger nicht nur Sidonie Werners soziales Engagement, sondern auch ihre Verdienste für ihr Vaterland Deutschland: "Sie wollte nicht nur den Armen und Bedürftigen helfen, sie wollte auch die Wohlhabenden befreien von dem seelischen Individualismus, wollte sie hinführen zum Wirken für die Gemeinschaft. Das war das Ziel, das sie verfolgte mit zähem Eifer und unermüdlicher Tatkraft. Es würde aber ein wichtiger Zug ihres Wirkens fehlen, wollten wir nicht auch ihrer starken seelischen Verbundenheit mit deutscher Kultur und deutschem Vaterland gedenken. Diese Verbundenheit hat sich gezeigt in der Cholerazeit, als sie in vorderster Linie ihre Pflicht erfüllte; sie hat sich gezeigt während der Kriegszeit, als sie eine mustergültige Hilfsorganisation schuf, sie hat sich zuletzt gezeigt in der Winterhilfe für die deutsche Not". Sidonie Werner lebte zuletzt in der Husumerstr. 1.
Text: Rita Bake
|
|
 |
 |
 |

Photo: Staatsarchiv Hamburg |
 |
Alice Wosikowski, geb. Ludwig |
| 18.10.1886 Danzig -7.4.1949 Hamburg |
| Mitglied (KPD) der Hamburgischen Bürgerschaft, Mutter der Widerstandskämpferin Irene Wosikowski |
Ohlsdorfer Friedhof, Geschwister-Scholl-Stiftung, Grab: Nr. Bn 73, 406
Alice Wosikowski wurde 1886 als Jüngste von vier Geschwistern in Danzig geboren. Nach dem Abschluß der Volksschule absolvierte sie eine zweijährige Ausbildung als Kindergärtnerin, die ihr der Vater, ein Schneidermeister, finanziell ermöglichen konnte und arbeitete in diesem Beruf bis zu ihrer Heirat im Alter von 21 Jahren (1907). Ihr Mann, Dreher auf einer Werft, war aktiver Gewerkschafter und Sozialdemokrat, und auch sie wurde Mitglied der SPD.
Ein Jahr nach der Hochzeit kam Eberhard und zwei Jahre später Irene auf die Welt.
1911 zog die Familie nach Kiel, weil Alices Mann in Danzig wegen seiner Zugehörigkeit zu einem Streikkomitee auf einer Danziger Werft keine Arbeit mehr fand. In Kiel konnte er auf der Germania Werft arbeiten.
|
Gleich zu Beginn des Ersten Weltkrieges fiel ihr Mann im Oktober 1914. Die Kriegerwitwenrente war so knapp bemessen, daß Alice Wosikowski hinzuverdienen mußte - ein Jahr lang verrichtete sie Heimarbeit, später arbeitete von 1915 bis 1921 als Fürsorgerin beim Kieler Magistrat.. Dennoch reichte das Geld für das Schulgeld nicht, und der Sohn mußte vorübergehend die Mittelschule verlassen.
1921 zog Alice Wosikowski mit ihren Kindern nach Hamburg in die Seumestraße und heiratete den Bruder ihres verstorbenen Mannes. Nun brauchte sie nicht mehr erwerbstätig zu sein, ihr Mann, ein Ewerführer und Mitglied der KPD sorgte für das finanzielle Auskommen der Familie. Alice Wosikowski, die mitlerweile auch Mitglied KPD geworden war, engagierte sich nun verstärkt im Frauenbereich.
Als Alice Wosikowskis zweiter Ehemann starb, mußte sie wieder erwerbstätig werden und arbeitete von 1930 bis 1933 sowie von 1946 bis 1949 in der Buch-haltung der kommunistischen Hamburger Volkszeitung.
Über ihr politisches Engagement läßt sich ermitteln: Alice Wosikowski war von Ja-nuar 1927 bis zur Auflösung des Roten Frauen- und Mädchenbundes (RFMB) im Dezember 1930, Leiterin dessen Hamburger Ortsgruppe. Ziel dieser von der kommunistischen Frauenbewegung initiierten Vereinigung war es, hauptsächlich unorganisierte Arbeiterfrauen und Arbeiterinnen politisch zu aktivieren. Der RFMB war 1925 von der KPD als "Schwesternorganisation" des Roten Frontkämpfer-Bundes (RFB) gegründet worden. Vorsitzende wurde Clara Zetkin. Als Gegengewicht zu den bürgerlichen Frauenvereinen bot der RFMB "proletarische" Kultur und Unterhaltung an. In Hamburg gehörten allerdings nur knapp 3% aller weiblichen KPD-Mitglieder dem RFMB an. Die erste Vorsitzende war Maria Grünert, die 1927 von Alice Wosikowski abgelöst wurde. Der Schwerpunkt der RFMB, deren Mitglieder ca. 75% Arbeiterinnen waren, lang in der politischen Betriebsarbeit. Der RFMB forderte u.a. gleiches Recht auf Erwerbsarbeit für Mann und Frau, Verhinderung von Massenarbeitslosigkeit und Abschaffung des Paragraphen 218. Außerdem wandte er sich gegen den wachsenden Antifeminismus und das Frauenbild der NSDAP.
1929 wurde der RFB verboten, der RFMB daraufhin massiv behindert, seine Veranstaltungen verboten. Der RFMB arbeitete von nun an nur noch halblegal. Angesichts der drohenden Kriegsgefahr und des Einflusses der NSDAP beschloß der RFMB gegen Ende des Jahres 1933 seine Arbeit in "Frauen- und Mädchenstaffeln" des neugegründeten "Kampfbundes gegen den Faschismus" fortzusetzen.
In dieser Zeit - von 1927 bis 1933 - war Alice Wosikowski Abgeordnete der KDP in der Hamburgischen Bürgerschaft.
Nach 1933 beteiligte sie sich am Widerstand gegen das Hitlerregime. Sie wurde dreimal verhaftet und in Konzentrationslagern inhaftiert: 1933/34 in Fuhlsbüttel, 1936/37 in Moringen und von 1939 bis 1941 im KZ Ravensbrück. Auch ihre bei-den Kinder wurden verfolgt, ihre Tochter Irene 1944 von den Nazis hingerichtet.
Die Mutter erfuhr im Frühjahr 1944 von der Inhaftierung ihrer Tochter. In einer Erklärung vom 13.1.1948, die sie anläßlich des Prozesses gegen den Gestapomann Teege abgab, schrieb sie: "Im März 1944 erhielt ich von meiner Tochter Irene Wosikowski geb. am 9.2.10. die Nachricht, daß sie bei der Gestapo in Haft sei, und ich könnte sie dort besuchen. Ich war sehr überrascht, denn Irene war seit langer Zeit in der Emigration und im ganzen äußerst vorsichtig. Ich besuchte sie im Ziviljustizgebäude und konnte sie auch sprechen. Dort war der Gestapobeamte Teege, der die Vernehmung meiner Tochter durchgeführt hatte. ...
Nachdem ich meine Tochter gesprochen hatte, bot Teege mir an, für die Gestapo zu arbeiten. Er meinte, ich könnte dadurch den Kopf meiner Tochter retten. Ich lehnte jedoch dieses Ansinnen ab, und nachdem Teege nach 14 Tagen mir das Angebot wiederholte, gab ich auch dieses Mal nicht meine Zustimmung. Teege stellte dann seine Bemühungen ein und schloß das Verfahren für die Staatsanwaltschaft ab. ..."
In der Hamburger Volkszeitung vom 26.10.1946 ist zu lesen, daß Alice Wosikowski dem Gestapomann Teege mitgeteilt haben soll: "Meine Tochter würde mich verachten, wenn ich um solchen Preis ihren Kopf retten wollte." Ob oder wieweit sie diese Entscheidung verkraftet hat, ist nicht bekannt.
Infolge einer schweren Krankheit verstarb Alice Wosikowski im April 1949 im Alter von 63 Jahren. Sie wohnte zuletzt in der Simrockstraße 40 im Stadtteil Iserbrook.
Text: Rita Bake
Quellen:
Vgl.: Ein tapferes Leben ist erfüllt. Trauerfeierlichkeiten für Alice Wosikowsky. In: Hamburger Volkszeitung, April 1949.
und: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363;-1424.html?ID=5454
|
|
 |
 |
 |
| Irene Wosikowski |
 |

Photo: Gedenkstätte Ernst Thälmann Hamburg |
| 3.2.1910 Hamburg - hingerichtet 27.10.1944 Berlin-Plötzensee |
| Organisationsleiterin des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands, leistete in der Emigration illegale Widerstandsarbeit |
Ohlsdorfer Friedhof, Ehrenhain der Widerstandskämpfer 1933-1945, Grab-Nr: L5, 256-310
Irene, die Tochter von Alice Wosikowski, war politisch durch ihre Eltern geprägt. Im Alter von 14 Jahren wurde sie Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschland (KJVD) und war zwischen 1926 und 1930 politische Leiterin in der KJVD Gruppe-Hamburg.
Irene Wosikowski besuchte die zweijährige Handelsschule und war anschließend als Stenotypistin, zunächst in einer Exportagentur in der Mönckebergstraße, danach in der Sowjetischen Handelsvertretung in der Steinstraße, tätig.
1930 wurde sie in die Filiale der Handelsvertretung nach Berlin versetzt. Dort blieb sie bis 1934 und arbeitete auch hier in der KPD - ab 1933 in der Illegalität.
|
1934 sollte Irene Wosikowski verhaftet werden, sie wurde jedoch gewarnt und konnte noch rechtzeitig in die Tschechoslowakei emigrieren. 1935 kam sie in die Sowjetunion und studierte dort zwei Jahre an der Internationalen Leninschule der Kommunistischen Internationale in Moskau. 1937 ging Irene Wosikoski, die sich jetzt in der Illegalität Helga nannte, nach Paris. Dort arbeitete sie als Stenotypistin und politische Mitarbeiterin in der Zeitungsredaktion der "Deutschen Volkszeitung". Die französische Regierung gewährte ihr zwar Asylrecht, aber keine Arbeitserlaubnis. So mußte Irene Wosikowski starke Entbehrungen hinnehmen. Sie wurde zeitweilig durch die Liga für Menschenrechte und durch das Rothschild-Komitee unterstützt. Die finanziellen Zuwendungen waren jedoch sehr gering. Irene Wosikowski lebte deshalb in billigen Emigrantenhotels.
Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, mußten sich am 13. Mai 1940 alle deutschen Frauen den französischen Behörden stellen. Irene Wosikowski wurde in der Nacht davor verhaftet und in ein Internierungslager bei Bordeaux gebracht. Dort gelang es ihr und einigen ihrer Genossinnen nach einiger Zeit auszubrechen. Sie fuhren mit dem Zug nach Marseille, weil sie hofften, sich dort der Widerstandsbewegung anschließen zu können. Aber - gerade aus dem Zug ausgestiegen - wurde Irene von der französischen Polizei verhaftet und wieder für einige Monate inhaftiert.
Nach ihrer Freilassung schloß sich Irene Wosikowski der deutschen Widerstandsgruppe in Marseille an, die z.B. Eßpakete für die Gefangenen in den französischen Internierungslagern organisierten. Als 1942 die Hitlerarmee auch den Süden Frankreichs besetzte, änderten die deutschen Widerstandskämpfer- und -kämpferinnen ihre politische Arbeit. Sie gaben nun die Zeitung "Soldat am Mittelmeer" heraus, verteilten sie an deutsche Soldaten und versuchten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um sie von der Sinnlosigkeit dieses Krieges zu überzeugen. Bei solch einem Gespräch kam Irene Wosikowski in Konkakt mit einem Spitzel, der sie an die Gestapo verriet. In einem Vermerk der Sicherheitspolizei in Marseille vom 27.7.1943 heißt es: "Aufgrund der Denunziation des Matrosen Hermann Frischalowski erfolgte am 26.7.1943 die Verhaftung der deutschen Emigrantin Irene Wosikowski in Marseille." 1
Irene Wosikowski wurde nach Deutschland zurückgebracht und am 13. September 1944 vom Volksgerichtshof in Berlin wegen "Vorbereitung zum Hochverrat" zum Tode verurteilt und am 27. Oktober 1944 im Alter von 34 Jahren in Berlin-Plötzensee hingerichtet.
Text: Rita Bake
Quellen:
Vgl.: "Mutter, ich bleibe unserer Sache treu". Irene Wosikowski. Eine Dokumentation der DKP-Kreisorganisation Hamburg-Wandsbek, Mai 1985.
|
|
 |
 |
 |

Bild aus: Marie Kortmann: Emilie Wüstenfeld. Hamburg 1927. |
 |
Emilie Wüstenfeld, geb. Capelle |
| 17.8.1817 Hannover - 2.10.1874 Hamm |
| Gründerin des Paulsenstiftes, der ersten Gewerbeschule für Mädchen und Frauen und des Vereins zur Förderung weiblicher Erwerbstätigkeit, Mitbegründerin des Frauenvereins zur Unterstützung der Armenpflege, Mitbegründerin des Frauenvereins zur Unterstützung der Deutschkatholiken, Mitbegründerin des Sozialen Vereins zur Ausgleichung konfessioneller Unterschiede |
Ohlsdorfer Friedhof, Althamburgischer Gedächtnisfriedhof: Grabplatte "Herausragende Frauen"
Emilie Wüstenfeld geb. Capelle wurde besonders durch ihr Engagement im Bereich der Armenpflege und durch das Bestreben, Frauen und Mädchen durch eine bessere Schulausbildung zu finanzieller Unabhängigkeit zu verhelfen, bekannt. Sie gründete das Paulsenstift und die erste deutsche Gewerbeschule für Mädchen.
Marie Emilie Capelle wuchs in Hannover mit ihren drei Geschwistern in einer Kaufmannsfamilie auf.
|
Ihr Vater starb, als Emilie Capelle fünf Jahre alt war. Frau Capelle legte bei der Erziehung ihrer Töchter Marie, Emilie und Pauline großes Gewicht auf soziales Engagement und die Beherrschung aller Haushaltsgeschäfte. Die schulische Ausbildung an einer Bürgerschule wurde ergänzt durch Privat-unterricht in den Fächern Zeichnen, Musik und Fremdsprachen. Daneben wurde im Hause Capelle auf einen ungezwungenen und respektvollen Umgang zwischen den Geschlechtern geachtet. 1841 heiratete Emilie Capelle im Alter von 24 Jahren den angesehenen Kaufmann Julius Wüstenfeld aus Hannoversch-Münden. Fast zur gleichen Zeit ging auch ihre Schwester Pauline den Bund fürs Leben ein. Sie heiratete Wilhelm Kortmann aus Dortmund. Beide Paare zogen nach Hamburg. Das Verhältnis der Schwestern war sehr eng. Pauline stand ihrer Schwester bei allen Unternehmungen unterstützend und beratend zur Seite. So wurde sie z.B. Ehrenvorsitzende des Frauenvereins zur Unterstützung der Armenpflege, den ihre Schwester zusammen mit Charlotte Paulsen gegründet hatte.
Noch nicht lange in Hamburg, mußten beide Paare den großen Brand von 1842 miterleben. Nach dieser Katastrophe zogen die Wüstenfelds in eine größere Wohnung am Holländischen Brook 15. Emilie Wüstenfeld bekam drei Kinder, die alle sehr kränklich waren.
Durch die weltweite kaufmännische Tätigkeit ihres Mannes bekam Emilie Wüstenfeld schnell Kontakt zu anderen Hamburger Kaufmannsfamilien und zu aus-ländischen Geschäftspartnern. Im Hause Wüstenfeld wurde neben der üblichen Geselligkeit, die in Kreisen des gehobenen Bürgertums gepflegt wurde, auch sozialkritische und revolutionärliberale Themen diskutiert.
Bei einer Gesellschaft lernte sie Bertha Traun, die Frau eines Geschäftsfreundes, kennen, und gemeinsam wurden sie begeisterte Anhängerinnen der Deutschkatholischen Gemeinde. Emilie Wüstenfeld, die nach dem Tod zwei ihrer Kinder, außerhalb des Hauses eine Aufgabe gesucht hatte, hatte nun eine Vereinigung gefunden, mit der sie sich identifizieren konnte. Hier stand - im Gegensatz zum Amalie Sievekingschen Verein - die Nächstenliebe im Vordergrund, nicht die Forderung nach einem streng orthodoxen, nach kirchlichen Maßstäben ausgerichteten, Lebenswandel. Emilie Wüstenfeld hatte es sehr negativ berührt, als sie erleben mußte, wie der Sievekingsche Verein einer armen Familie die Unterstützung versagte: "weil man ihren Glauben nicht für den rechten hielt. Ebenso erging es einer alten Frau, die an einem Sonntag von der besuchenden Dame durch das Fenster mit einer notwendigen Flickerei beschäftigt gesehen, gleich darauf aber bei ihrem Eintritt eifrig in der Bibel lesend gefunden wurde. Sie gab als Erklärung an, daß ihr die Unterstützung sonst entzogen würde, was auch wirklich geschah. So zog sich Emilie auch hier zurück, denn solche Engherzigkeit war nicht nach ihrem, alle Leidenden mit Barmherzigkeit umfassenden Sinn". 1
Die Ziele der Deutschkatholischen Gemeinde überzeugten Emilie Wüstenfeld. Um die Gemeinde finanziell zu unterstützen, gründete am 10. Dezember 1846 Emilie Wüstenfeld zusammen mit Bertha Traun und weiteren Frauen den Frauenverein zur Unterstützung und Förderung der Deutschkatholiken. Zwei Jahre später rief Emilie Wüstenfeld zusammen mit anderen Aktivistinnen des Frauenvereins, so z.B. mit der Christin Bertha Traun und der Jüdin Johanna Goldschmidt, den So-zialen Verein zur Ausgleichung konfessioneller Unterschiede ins Leben. Als 1849 auch in Hamburg die Gleichberechtigung der Juden erklärt wurde, gab Emilie Wüstenfeld ein Fest zu Ehren der anwesenden Jüdinnen.
Ein weiteres wichtiges Lebensprojekt von Emilie Wüstenfeld war: die Errichtung einer Hochschule für das weibliche Geschlecht. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten neben Emilie Wüstenfeld und Bertha Traun: Emma Isler geb. Meyer, Elise Bieling geb. Ström, Mathilde Seybold geb. Mohrmann und Henriette Salomon geb. Goldschmidt. Den Plan für solch eine Hochschule: "hatte [Johannes] Ronge [ Prediger der Deutsch-Katholischen Gemeinde und späterer zweiter Ehemann von Bertha Traun] 1846 dem Breslauer Frauenverein vorgelegt, der aber nicht die nötigen Finanzmittel hatte. Ein Neffe von Friedrich Fröbel, Professor Karl Fröbel, hatte in Zürich den vollständigen Entwurf einer weiblichen Hochschule ausgearbeitet, bekam aber in der Schweiz nicht die nötige behördliche Zustimmung, um ihn zu verwirklichen". 3
Nun wollten Bertha Traun und Emilie Wüstenfeld Karl Fröbel als Leiter der Hochschule gewinnen. Deshalb reisten die beiden Frauen im September 1849 nach Zürich und nahmen Kontakt mit Fröbel und seiner Frau Johanna geb. Küstner auf.
Das Kapital für die Hochschule sollte durch den Verkauf von Hochschulaktien aufgebracht werden, wobei die Ehemänner der Hochschulgründerinnen die ersten Käufer waren. Die spätere Finanzierung wollte man durch Pensions- und Kursgebühren ermöglichen. Vom Staat erhielt die Schule keine Unterstützung, war jedoch auf die Tolerierung durch staatliche Instanzen angewiesen.
Der Name "Hochschule" war sehr hoch gegriffen, handelte es sich doch vielmehr um eine Weiterbildung für Frauen in den "klassischen" frauenspezifischen Gebieten wie der Kindererziehung.
Am 1. Januar 1850 wurde die Hochschule, der ein Kindergarten als Praxisfeld angegliedert war, auf dem Holländischen Brook Nr. 25 eröffnet. Knapp zwei Jahre später jedoch mußte die Schule aus zwei Gründen wieder geschlossen werden: Von Anfang an hatte die Schule im Kreuzfeuer der Kritik gestanden. Man fand sie zu freisinnig, da sie den Mädchen unabhängig von Konfession und sozialer Schicht eine gehobene Ausbildung ermöglichte. Amalie Sieveking, die selbst für eine Weiterbildung für Mädchen eintrat, warnte vor dieser Hochschule, weil hier der Geist des Antichristentums die Schülerinnen für seine Zwecke auszubeuten suche. Pamphlete, gedruckt in einer pietischen Druckerei, schürten Ängste. Resultat solcher Verunglimpfungen: das Bürgertum schickte ihre Töchter nicht mehr auf die Hochschule und die Sponsoren blieben aus.
Auch mit ihrer Einstellung zur Ehe verstießen Emilie Wüstenfeld und Bertha Traun gegen die herrschende Moral. Daß Bertha Traun sich scheiden ließ und Emilie Wüstenfeld diesen Schritt guthieß, sogar selbst Scheidungsabsichten hegte, stieß auf heftige Kritik. Emma Isler, ein Gründungsmitglied der Hochschule, schrieb tadelnd: "Frau Wüstenfeld billigte damals, was ihre Freundin that, war sie doch auch auf dem Punkt, eine Ehe zu lösen, in der sie nicht glücklich war. Darüber hätte Niemand ein Urtheil zugestanden; der Staat giebt das Mittel an die Hand, eine unglückliche Ehe zu trennen. Das hat Jeder mit sich und seinem Gewissen allein abzumachen, aber wenn jeder neuen Leidenschaft die Berechtigung zugestanden werden soll, die alte Treue zu verdrängen, so würde die Gesamtheit nicht gedeihen können, also unsittliche Zustände herbeigeführt werden. Frau Wüstenfeld wurde durch einen Freund von ihrem Entschluß zurückgebracht, aber das Auftreten beider Frauen traf starken Tadel, der sich auf ihre Unternehmungen übertrug und daran scheiterte die Hochschule. Die Freundinnen trennten sich, Frau Ronge folgte ihrem zweiten Mann nach England, wurde sehr unglücklich und starb nach einigen Jahren in Frankfurt." 4
Der Geldfluß der Gönner versiegte. Hinzu kam, daß nach dem Scheitern der bürgerlichen Revolution die Reaktion erstarkte und damit in der bürgerlichen Gesellschaft kaum mehr Platz für derartige demokratische Vorhaben war. Selbst Emilie Wüstenfelds Mutter wandte sich von ihrer Tochter ab. Zum endgültigen Ende der Hochschule kam es, als die meisten von auswärts kommenden Lehrer wegen ihrer politischen Gesinnung aus Hamburg ausgewiesen wurden. Damit wurde Emilie Wüstenfelds Schule auf subtile Weise die Existenzgrundlage entzogen.
Gezeichnet vom Scheitern der Hochschule, dem Verbot der freisinnigen Vereinigungen und den an ihr nagenden Zweifeln an ihrer Ehe, verschlechterte sich Emilie Wüstenfelds Gesundheitszustand. In dieser Situation nahm sie 1852 eine Einladung der Ronges nach London an. Dort fand sie Erholung und konnte ihre angegriffenen Nerven kurieren. Eine Reise in die Schweiz tat das übrige. Gestärkt kehrte Emilie Wüstenfeld nach Hamburg in ihre Wohnung in den Alsterarkaden 13 zurück. Sie blieb bei ihrem Mann, kam seinem Wunsch, die familiären Verpflichtungen nicht zu vernachlässigen, nach, schaffte es aber dennoch, ihre Eigenständigkeit zu bewahren: "überreich an wechselvollen Pflichten, reich in dem Streben nach Belehrung und Vertiefung, reich vor allem in dem vielseitigen Wirken auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege. Sie verstand es, das Recht auf ihre eigene Persönlichkeit, das sie nicht aufgab, mit den zu keiner Zeit hintenangesetzten Pflichten gegen die Familie zu verbinden. Fernerstehende konnten nicht begreifen, wie sie die Kraft und Zeit für ihre rastlose Tätigkeit fand, wenn nicht auf Kosten der Familie und Häuslichkeit. ... Sie verstand es eben, durch eine gute Zeiteinteilung allen Anforderungen gerecht zu werden. Eine im Grunde gesunde, kräftige Natur kam ihr zu Hilfe. Überfiel sie des Nachmittags eine, wie sie es nannte, `peremtorische Müdigkeit`, so legte sie sich für 20 Minuten zum Schlafen hin. ... Allerdings kamen wohl zuweilen rein konventionelle, gesellschaftliche Rücksichten etwas zu kurz bei ihr, niemand nahm es ihr aber übel," 1 vermerkte Marie Kortmann über ihre Tante.
Nachdem Emilie Wüstenfeld ihr rebellisches Verhalten aufgegeben, sich mit ihrem Mann arrangiert und der Armenpflege zugewandt hatte (gemeinsam mit Charlotte Paulsen hatte sie 1849 - als Folge der bürgerlichen Revolution von 1848 - den Frauenverein zur Unterstützung der Armenpflege gegründet, äußerte sich Emma Isler sehr zufrieden über Emilie Wüstenfelds Lebensweg: "Frau Wüstenfeld hatte sich selbst gefunden, als sie es aufgab, ihr eigenes Glück zu suchen. Als die Erhebung von 48 niedergeschlagen war und die Verfolgung der Freiheitskämpfer begann, verdankte Mancher ihrer Energie und ihrem aufopfernden Muth die Freiheit in Amerika, dem jahrelange Kerkerhaft gedroht hatte. Als die politische Aufregung vorüber war, wendete sie sich ganz der Armenpflege zu und hier erst entwickelte sie ihre volle Bedeutung." 4
Privat lebte Emilie Wüstenfeld sehr zurückgezogen. Ihre Fürsorge galt der gesundheitlich angeschlagenen Tochter, außerdem nahm Emilie Wüstenfeld eine Pflegetochter auf, die 12jährige Marie Hartner, die die erste Klasse der Vereinsschule besucht hatte. Nun hatte Emilie Wüstenfeld wieder zwei Kinder - ein Pflegekind und ihr eigenes - beide hießen Marie. Und noch eine weitere Hausgenossin wurde in dieser Zeit aufgenommen: Miß Emma Howard, die in Privathaushaltungen Englischunterricht erteilte.
Um 1856 kauften die Wüstenfelds ein Grundstück auf dem Hammer Deich. Obwohl sie ihre Stadtwohnung in den Alsterarkaden Nr. 13 behielten, verbrachte Emilie Wüstenfeld die meiste Zeit in ihrem Haus auf dem Lande. Hier betrieb Herr Wüstenfeld eine Blaufärberei, die Emilie Wüstenfeld übernahm, um ihren an Hypochondrie leidenden Mann zu beruhigen, der sich Sorgen um die finanzielle Seite des Unternehmens machte. Emilie Wüstenfeld übernahm die Blaufärberei, entließ den Chemiker und senkte so die Betriebskosten. Daneben beherbergte sie auch noch Vereinszöglinge, die in den Ferien zu ihr kamen und hilfsbedürftige Freunde und Fremde. Sie versuchte auch, Landaufenthalte für arme Kinder zu organisieren.
Da Emilie Wüstenfeld sich nicht scheute, Menschen zu helfen, die vom Staat wegen ihrer religiösen und politischen Gesinnung verfolgt wurden, hatte sie immer noch mit Schikanen von Seiten der Polizei zu rechnen.
Ende der 50er Jahre traf sich bei den Wüstenfelds das Komitee zur Förderung der Gewissensfreiheit, die die in den Grundrechten von 1848 festgeschriebene Glaubens- und Gewissensfreiheit zu verwirklichen versuchte. Bei der Statutenberatung traten allerdings scharfe ideologische Gegensätze zutage, die Emilie Wüstenfeld schwer belasteten: "Sie [Emilie Wüstenfeld], der Toleranz für die Überzeugungstreue Andersdenkender Herzenssache war, litt schwer darunter, um so mehr, als die Kämpfe nicht von außen kamen, sondern durch den Konflikt sich achtender Menschen; sie beklagte, daß die Deutschen so gründlich und übergewissenhaft seien, daß zwei gute, edle Menschen, die dasselbe wollten, vor lauter Gewissenhaftigkeit sich nicht einigen könnten." 5 Man kam dennoch zu einer erhofften Einigung.
Neben ihrem Engagement auf diesem Gebiet verfolgte Emilie Wüstenfeld ihren Plan, Frauen und Mädchen eine umfassendere Ausbildung zukommen zu lassen, weiter mit großem Eifer. Nach dem Tode von Charlotte Paulsen erfüllte Emilie Wüstenfeld ihr postum einen lang gehegten Wunsch: ein Haus, in dem ein Kindergarten und eine Schule untergebracht waren. Im Herbst 1866 wurde die Schule des Paulsenstiftes bei den Pumpen mit 300 Kindern eröffnet. Ihr angegliedert war ein Kindergarten, der nach den Fröbelschen Erziehungsmethoden arbeitete.
Ein Jahr später wurde im Paulsenstift eine Fortbildungsklasse für Mädchen eröffnet, die bereits ein weiteres Jahr darauf in größere Räumlichkeiten am Großen Burstah Nr. 16 umziehen mußte und dort 1868 als erste deutsche Gewerbeschule für Mädchen eröffnet wurde. Um deren Finanzierung zu gewährleisten, hatte Emi-lie Wüstenfeld bereits am 18.2.1867 den Verein zur Förderung weiblicher Er-werbstätigkeit gegründet, dessen Vorsitzende sie wurde. Ihre umfangreichen und zielstrebig verfolgten Aktivitäten überzeugten schließlich auch den Senat, so daß Bürgermeister Kirchenpauer, die Senatoren Versmann und Petersen sowie einige Herren der Finanzabteilung ihr für den Bau eines größeren Schulgebäudes der Gewerbeschule für Mädchen, einen Bauplatz an der Brennerstraße Nr. 77 zuwiesen.
Jetzt gab es für Emilie Wüstenfeld nur noch eins: den Bau ihrer Schule. Selbst die Diagnose drohende Herzverfettung hielt sie nicht ab. Verzögert wurde ihr Bauvor-haben durch den deutsch-französischen Krieg (1870-1871), durch familiäre Schicksalsschläge - ihre Enkelkinder starben - und durch die höheren Baukosten nach Kriegsende, so daß die Schule erst Ende 1873 in Betrieb genommen werden konnte. Die Eröffnung der ersten deutschen Gewerbeschule für Mädchen in Ham-burg, in der junge Frauen ausschließlich in Berufen ausgebildet wurden, die dem sogenannten weiblichen Charakter der Frau entsprachen, war der Höhepunkt Emilie Wüstelfelds gesellschaftlichen Wirkens.
Das 25jährige Jubiläum des Frauenvereins war das letzte offizielle Ereignis, das Emilie Wüstenfeld miterlebte. Als sie mit ihrem Mann zur Kur in Marienbad weilte, erkrankte sie so ernsthaft, daß ihr die Ärzte jegliche Vereinstätigkeit untersagten. Sie aber konnte nicht innehalten. Ihr Freund Dr. Ree erkannte klar: "Frau Wüstenfeld wird keine Ruhe finden, sie müßte denn den Umgang mit sich selbst aufgeben." Am 2. Oktober 1874, im Alter von 57 Jahren, starb Emilie Wüstenfeld auf ihrem Landsitz in Hamm nach einem Schlaganfall.
1875, ein Jahr nach ihrem Tod, wurde die bis heute existierende Emilie Wüstenfeld Stiftung gegründet, deren Zweck es ist, Stipendien für bedürftige und strebsame Schülerinnen zu vergeben.
Text: Rita Bake
Quellen:
1) Marie Kortmann: Emilie Wüstenfeld. Eine Hamburger Bürgerin. Hamburg 1927.
2) Ingeborg Grolle: Demokratie ohne Frauen? Fraueninitiativen in Hamburg um 1848. In: Inge Stephan, Hans-Gerd Winter (Hrsg.): Heil über Dir, Hammonia, Hamburg 1992, S. 319-344.
3) Ingeborg Grolle: "Auch Frauen seien zulässig". Die Frauensäule im Hamburger Rathaus. Erscheint 1997 als Aufsatz in dem von der Landeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Publikation: "Auf den zweiten Blick" zum 100. Geburtstag des Hamburger Rathauses.
4) Ursula Randt: Die Erinnerungen der Emma Isler. o.O. 1986.
5) Marie Kortmann: Aus den Anfängen sozialer Frauenarbeit. Hamburg 1920.
Vgl.: Elke Kleinau: Die "Hochschule für das weibliche Geschlecht" und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des höheren Mädchenschulwesens in Hamburg. In: Zeitschrift für Pädagogik 36, 1990, Nr. 1.
|
|
 |
 |
 |
| Marie Zacharias (Marie Anna Zacharias, geb. Langhans) |
 |
.jpg)
Bildquelle: Wikipedia |
| 11.11.1828 Hamburg - 15.2.1907 Hamburg |
| Zeichnerin und Mitbegründerin der Gesellschaft Hamburgischer Kunstfreunde |
Ohlsdorfer Friedhof, Grab Nr. R 25, 27-56
"Süße Mama! Freitag war ich bei Stillers. Als Onkel Luhmann mich abholte war ich in high spirits, denn ich glaubte, ich hätte mich gut amüsiert. Aber wie elend, wie spießbürgerlich kam mir dieses Vergnügen vor, als ich Deinen Brief las und es mit der Partie nach Lindenbach verglich! Welch eine Menge Herren habt ihr da dieses Jahr! Wie gerne würde ich alle Hamburger Vergnügen für ein Emser oder ein Gespräch mit dem Obristen hingeben.
Ich möchte Euch beiden nur einmal zusammen sprechen sehen, wie reizend muß das aussehen. Und alle diese Seligkeiten sind mir um ein paar lumpige Taler versagt! O ich könnte rasend werden! - Die ganze Welt reist. Nur wir in Billwärder werden wohl wie die Töchter der Hausgiebelschen Familie bei unseren Hühnern und Schweinen festschimmeln."¹
|
Diese Zeilen der 15jährigen lassen schon viel von der Energie, der Kraft und dem Sinn für Humor spüren, die Marie Zacharias zeitlebens zueigen waren und die sie bis ins hohe Alter an der Vervollkommnung ihrer künstlerischen Fähigkeiten arbeiten ließen.
Marie Zacharias wurde am 11.November 1828 in der Vorstadt St. Georg als Tochter des jüdischen Kaufmanns Carl Friedrich Langhans und seiner Ehefrau Auguste geb. von Horn geboren. Sie hatte drei jüngere Brüder, Julius (1830), Friedrich Wilhelm (1832) und Eduard (1837). Im Elternhaus ging es besonders dank des ungewöhnlichen Temperaments der Mutter unkonventionell und unbürgerlich zu: "Meine Mutter", schreibt Marie Zacharias in ihren ‚Familien-, Stadt- und Kindergeschichten', "nachdem die Kinder zur Ruhe gebracht waren, tat einen tüchtigen Schlaf, stand erfrischt auf, machte Toilette und empfing um 10 Uhr ihren Mann, der totmüde und sorgenvoll vom Kontor kam, wie eine junge Braut. Das Klavier stand offen, die Noten waren bereit, das einfache Mahl war schnell verzehrt, und dann sangen und spielten die beiden bis tief in die Nacht hinein. Unsere alte Köchin erzählte mir in späteren Jahren, wie die Leute auf der Straße spät abends gestanden und das Singen und das wunderschöne Pfeifen meines Vaters angehört hätten. Für die Kinder war die fröhliche Willkür, die die Losung im Hause war, weniger zuträglich. … Nie hat die Sorge ums Dasein ihr [der Mutter[ einen Augenblick ihren Frohsinn geraubt, nie hat Kindererziehung oder Hausstand sie tagelang beschäftigt. … Mit beispielloser Willkür wurden Schulen gewechselt, Berufsfragen bestimmt und Heiratsfragen erledigt."² Bei der Taufe des jüngsten Bruders, Eduard, wäre Marie fast erstickt, weil eine Aufwärterin die gesamte Garderobe der Gäste auf das provisorische Bett warf, in dem Marie schlief. "‚Heiliger Gott, da liggt en Kind', rief Tante Betty Langhans, die mich entdeckte und halb erstickt aus den Mänteln herausgrub."²
Diesem Boheme-Leben im Elternhaus stand das geordnete Leben im Hause der Großmutter Wilhelmine Greve, der Adoptivmutter von Auguste Langhans, gegenüber. Zu ihm fühlte sich Marie sehr viel mehr hingezogen: "In dem stillen, großmütterlichen Paradies, das meine Heimat wurde, konnte so etwas nicht vorkommen, hier ging alles nach ewigen, herkömmlichen Gesetzen. Ein vornehmer Geist der Ruhe und Ordnung schwebte darüber, und die Trägerin dieses Geistes war die vornehme, feine, gebildete, kindlich frohe, bescheidene, fromme Großmutter Greve. Fast täglich erinnere ich mich ihrer. Von ihr lernte ich alles: von dem Anrühren des englischen Senfs, bei dem ich Tränen weinte, wenn sie ihn mir plötzlich unter die Nase hielt, dem Legen der Servietten, dem ,Lichte-auf-die-Leuchter-stecken' und Stickgarnabwickeln bis zu den verfeinertsten Naturgenüssen, dem Abendrot, dem Rauschen des Herbstwindes in den dürren Blättern, dem Nachtigallengesang. Schreiben, wie die merkwürdigsten Eigennahmen geschrieben wurden, ,Davida', ,Pulcherie' usw., Zeichnen, wobei besonders eine große Kunst in langen, steifen Tannen entwickelt wurde, Singen, wobei sie mir zuerst ,ein Veilchen auf der Wiese stand' zu meinem größten Entzücken vorsang, Ausschneiden und tausend andere Dinge - halb Kinderspiel, halb spielendes Erlernen."² Die Sommer im großmütterlichen Haus zunächst im damals noch ländlichen Hamm, später in Billwerder, wo auch der eingangs zitierte Brief entstand, gehören zu den schönsten Kindheitserinnerungen von Marie Zacharias. "Billwerder, du Paradies der Kindheit, mit deinen Nachtigallen und deinen Mückenschwärmen, mit dem Blütenduft unter den alten Lindenalleen; den großen alten Landhäusern mit den gemütlichen Wohndielen, auf denen sich das ganze Familienleben abspielte."²
Die dritte Welt, die Maries Kindheit bestimmte, war die Schule. Zunächst ging sie als eins von drei Mädchen in die Jungenschule von Marianne Prell in der Holländischen Reihe. Hier wehte ein "fröhlicher gemütlicher Geist".² Später erhielt sie gemeinsam mit anderen Mädchen Privatunterricht, kam dann in die Schule von Maria Plath auf den Mühren, wo sie sich so unglücklich fühlte, dass der Privatunterricht wieder aufgenommen wurde.
Im Spätsommer 1850 heiratete Marie den Kaufmann Adolph Nicolaus Zacharias, den Sohn eines Zuckerraffineriebesitzers aus Königsberg. Er war ein geistreicher und gebildeter Mann, der eine vielseitige Bibliothek besaß und Kupferstiche sammelte. Er spielte aber auch in der Politik eine wichtige Rolle: "Er kämpfte mit scharfer Klinge in der Bürgerschaft gegen den Liberalismus. Er focht leidenschaftlich gegen den Zollanschluß und war ein großer Gegner Bismarcks. Sein Tod 1880 wurde in allen Zeitungen beklagt. ‚Einer unserer besten Bürger' wurde er bezeichnet",³ hielt Elise, die Schwiegertochter von Marie Zacharias, über ihren Schwiegervater in ihren Aufzeichnungen fest.
Die ersten Ehejahre verbrachte das junge Paar in Berlin, wo Adolph Nicolaus Zacharias als Kaufmann tätig war. Und wieder sind es Auszüge aus Briefen an die Mutter, die etwas von der jungen Ehefrau und dem unbekümmerten Eheleben der Anfangszeit erzählen: "Ich rufe immer abwechselnd Dich und Tante Line an, Tante Line, wenn er anführt: ‚und so ging ich und scherzte mit das Kind'. d.h. wenn er Ball mit mir spielt und mich durchschüttelt, u.s.w., wobei sich Tante Lines Haare sträuben würden, und Dich wenn wir so spät zu Bett gehen."¹ Ähnliches erlebte ein Herr, der bei dem jungen Paar einen Besuch machen wollte und lautes Getöse in der Wohnung hörte. Als er die ihm öffnende Köchin erstaunt ansah, hieß es: "Och, der Herr speelt man bloß mit de Madam." Die beiden hatten Kriegen um den Esszimmertisch gespielt. Wie Kinder zerrinnt ihnen die Zeit unter den Händen, er kommt zum Arbeiten ebenso wenig wie sie zu ihren Pflichten: "… ich nenne ihn immer Antonius, der auch nicht von Cleopatra weg konnte und sich dabei doch immer Gewissensbisse machte, denn er sagt jeden Augenblick: Nein das muss anders werden, ich kann nicht länger so herumbummeln. Glaubst Du vielleicht, dass ich irgend etwas tue? Klavier spielen oder lese oder häkle oder zeichne? Nichts, von dem Allen, wenn der Tag vorbei ist, wundern wir uns schrecklich, dass wir so wenig Zeit gehabt haben und dass wir überhaupt zu gar nichts kommen. Noch keinen einzigen Besuch haben wir gemacht …"¹
1853 kehrte das Paar mit dem ersten, 1852 geborenen Sohn Eduard, dem späteren Direktor der Botanischen Staatsinstitute, nach Hamburg zurück, wo Adolph Nicolaus Zacharias sich als Kaufmann niederließ. Die kleine Familie bezog ein Haus in der Fontenay. 1854 wurde die Tochter Marie Anne geboren, 1858 dann der Sohn Adolph, später Senatspräsident am Oberlandesgericht in Hamburg. Aus der unbändigen jungen Ehefrau wurde eine starke, geistvolle Persönlichkeit und das wohl nicht zuletzt durch den Einfluß ihres Mannes. Über die erste Begegnung mit der späteren Schwiegermutter schrieb Elise Zacharias: "Die vornehme, große, schlanke Gestalt, die etwas Imponierendes in ihrer ganzen Haltung hatte. Sie war ganz in schwarz gekleidet, hatte blonde, gescheitelte Haare, die in Flechten über den Ohren lagen. Sie war so ganz anders als alle älteren Damen, die ich kannte. Damals konnte ich noch nicht ahnen, wie eng wir beide zusammenwachsen würden. Ich ging mit fliegenden Fahnen ins neue Lager über. Ach, es war eine so ganz andere Luft, eine geistig anregende Atmosphäre, die mich hier empfing."³Und an anderer Stelle: "Übermütig und herrschsüchtig war sie nie. Die Ader des Sich -bewundern-Lassens hatte sie gar nicht. Sie blieb immer dieselbe vornehme, sich natürlich gebende Persönlichkeit. Und darin lag ihr Zauber! Und bis ins höchste Alter bewahrte sie sich eine mädchenhafte Unberührtheit, die sehr reizvoll wirkte, und über die man ganz ihr Alter vergaß."³
Marie Zacharias verstand es, das elterliche Erbe, die unbekümmerte Sorglosigkeit, mit einer maßvollen Haltung zu verbinden. In finanziellen Dingen beispielsweise bewahrte sie sich ihre Unbekümmertheit. Mit dem Auf und Ab des Kaufmannshaushaltes arrangierte sie sich dahingehend, dass sie in der Equipage fuhr, solange Geld da war, und ansonsten die Droschke nahm oder zu Fuß ging. Als ihr Mann 1880 unerwartet an einem Herzschlag starb, ohne finanziell für die Zukunft vorgesorgt zu haben, zog sie ohne große Umstände 1882 zunächst nach Hamm und später in verschiednen Wohnungen im Schultzweg 11 (heute Hansastraße) und An der schönen Aussicht. Erst 1891 lebte sie wieder in gewohnten Verhältnissen, als der Schwiegersohn Eduard Lippert - als wollte das Schicksal ihr Recht geben - ihr ein Haus am Mittelweg 48 kaufte und sie großzügig mit 10.000 Goldmark pro Jahr unterstützte. In anderen Dingen hatte sie sich jedoch zu einem maßvollen Verhalten diszipliniert. Der Urenkel Christoffer Zacharias-Langhans erzählt dazu folgende Episode: Anfang dieses Jahrhunderts starb die Enkelin von Marie Zacharias. Auf dem gemeinsamen Weg in die Kunsthalle forderte die Schwiegermutter die Schwiegertochter Elise auf, ihren Schmerz endlich zu überwinden, weiterzuleben. Die Schwiegertochter, im Temperament der Schwiegermutter durchaus ebenbürtig, war so wütend, dass sie aus der fahrenden Kutsche sprang. Doch dann stellten sich Gewissensbisse ein, die alte Frau alleine gelassen zu haben. Sie stieg in eine elektrische Droschke und stand bereits vor der Kunsthalle, als die Schwiegermutter vorfuhr. Als sie der Schwiegermutter den Schlag öffnete, sagte diese nur: Wie kommst du denn hierher? In eine ähnliche Richtung geht die folgende Eintragung der Schwiegertochter, die zugleich zeigt, dass nicht eine gewisse Gefühllosigkeit, sondern eine aus Klugheit geborene Selbstbeherrschung Beweggrund ihres Verhaltens war: "Wir sagten oft: ‚Sie legt ihr Leid in Schubladen fort.' Wehe, wenn sie dann krank wurde. Dann sprangen die Schubladen von selbst auf."³
Auch im Umgang mit anderen Menschen zeigt Marie Zacharias etwas von dieser Haltung. In ihrem Notizbuch hält sie fest: "Es ist eine große Torheit zu verlangen, daß die Menschen zu uns harmonieren sollen. Ich habe es nie getan. Ich habe einen Menschen immer nur als ein für sich bestehendes Individuum angesehen, das ich zu erforschen und in seiner Eigentümlichkeit kennen zu lernen erachtete, wovon ich aber durchaus keine weitere Sympathie verlangte, Dadurch habe ich es dahin gebracht, mit jedem Menschen umgehen zu können. Und dadurch allein entsteht die Kenntnis mannigfaltiger Charaktere, sowie die nötige Gewandtheit im Leben."4
Marie Zacharias war bis ins hohe Alter Mittelpunkt eines großen Kreises geistig und künstlerisch interessierter Menschen aller Generationen. "Junge Menschen fühlten sich ihr hingezogen. Sie hatte die seltene Gabe des Zuhörens und dadurch wieder das große Verständnis für das Erleben des Erzählers, dem sie das Erzählen leicht machte. Sie unterbrach nicht, gab kein vorschnelles Urteil ab. Nur zum Schluß antwortete sie auf ihre vornehme Art. Kein Wunder, daß Alt und Jung sie im Alter aufsuchten."³
In ihrem Haus am Mittelweg lud sie zu musikalischen Soiréen, zu denen sie professionelle Musiker engagierte. Die Tischkarten illustrierte sie selbst mit feinen Architektur- oder Landschaftszeichnungen. Ein häufiger Gast dieser Abende, der Jurist und Verfasser der "Hamburgischen Kulturgeschichte von 1890 bis 1920", Gustav Schiefler, berichtet: "Bei diesen Gesellschaften in den festlichen, mit weißer Lackfarbe gemalten und luftigen Tüllgardinen ausgestatteten Räumen, die im weichen Glanz einer Wachskerzenbeleuchtung strahlten, traf man einen Ausschnitt aus dem wahrhaft gebildeten Hamburg: Gelehrte, Künstler, Schriftsteller, Dichter, Kaufleute, Beamte und: schöne Frauen, so daß jeder - auch wer keine Freude an der vortrefflichen Musik hatte . auf seine Rechnung kam."5 Außerhalb solcher abendlichen Veranstaltungen spielte sie selbst leidenschaftlich Klavier: "Sie spielte alles aus dem Kopf. Oft setzte sie sich, aus dem Konzert kommend, in Hut und Mantel an den Flügel und spielte Motive in perlenden Klängen. Das war ein Genuß! Bis ins hohe Alter spielte sie mit fabelhaftem Schwung Militärmärsche und Walzer. Zu letzterem nahm sie jede Melodie, die ihr in den Sinn kam. Sie konnte jedes Thema in Walzer umsetzen. Und dabei kann ich sie mir gar nicht als flotte Walzertänzerin denken."³
Ihr Hauptinteresse aber galt einer anderen Betätigung, die sie als höhere Tochter seit ihrer Jugendzeit ausgeübt hatte: dem Zeichnen. Vermutlich angeregt durch den Malerkreis um die Gebrüder Gensler, der bereits vor dem Hintergrund des Abrisses der Klosterkirche St. Johannis im Jahre 1829 das Gefühl hatte, Zeuge einer untergehenden Epoche zu sein, die es galt festzuhalten, zeichnete Marie Zacharias Häuser und Straßen der Stadt. Auch in der Landschaftsmalerei wurde sie vermutlich von den Gebrüdern Gensler bestärkt. Insbesonders Jakob Gensler machte mit der Entdeckung der Schönheiten der norddeutschen Landschaft Natur zum Gegenstand seiner Malerei. Dazu kamen Marie Zacharias` eigene Erfahrungen mit dem Aufbau der Stadt nach dem großen Brand von 1842. In ihren "Familien-, Stadt- und Kindergeschichten" beklagt sie, dass die Wiedererrichtung der abgebrannten Stadtteile so rasch vonstatten ging, dass weder auf Schönheit noch auf Solidität geachtet wurde und dass auf dem Land eine veränderte Lebensweise entstand, die das geliebte Paradies ihrer Kindheit allmählich zerstörte. Die Städter, die ihre Landhäuser nur in den Sommermonaten benutzt hatten, wohnten nach dem großen Brand zum Teil zunächst gezwungenermaßen, dann aber mit Begeisterung ganzjährig draußen. Andere folgten.
Durch die Begegnung mit Alfred Lichtwark, der 1886 als Direktor der Kunsthalle nach Hamburg kam und dem Marie Zacharias bis zu ihrem Lebensende als mütterliche Freundin eng verbunden war, erfuhr ihre künstlerische Betätigung noch im fortgeschrittenen Alter neue Impulse.
Um seine Ziele als Museumsdirektor verwirklichen zu können, musste Lichtwark das ernsthafte Interesse des künstlerisch mangelhaft gebildeten Hamburger Bürgertums an der Kunst erwecken. Zu diesem Zweck nahm er sich der dilettierenden Gattinnen und höheren Töchter an und suchte durch einen geläuterten Dilletantismus das Verständnis der Kunst zu fördern: "Das Merkmal dieses neuen Dilettantismus ist nun vor allem, dass er nicht nur auf spielende Beschäftigung in müssigen Stunden ausgeht, sondern die künstlerische Erziehung ernst nimmt. Und gerade dies macht in werthvoll für die gesunde Entwicklung unserer künstlerischen und gewerblichen Produktion",6 schreibt Alfred Lichtwark 1895 im ersten Jahrbuch der "Gesellschaft Hamburgischer Kunstfreunde", die 1893 auf sein Betreiben hin gegründet worden war. Den Vorsitz übernahmen Eduard Lorenz Meyer und Marie Zacharias, Mitbegründerin und später Ehrenmitglied der Gesellschaft. Der Kreis der Mitglieder, der sich aus der führenden Hamburger Gesellschaft zusammensetzte, bestand aus Sammlern, Dilettanten und Kunstfreunden. Die Zahl der Mitglieder war auf einhundert beschränkt, um den persönlichen Zusammenhang zu wahren. Zweck der Gesellschaft war es, "die Freude am Sammeln von Kunstwerken zu erwecken und zu verbreiten und die dilettierende Kunstausübung mit ernster Absicht zu pflegen. Auf diesem Wege hofft sie dazu beizutragen, dass eine tiefere künstlerische Bildung in Hamburg gefördert wird und das Verständnis für die wirtschaftliche Bedeutung der Kunst in weitere Kreise getragen wird."6 Die Gesellschaft veranstaltete jährliche Ausstellungen in der Kunsthalle, in denen Kunstwerke aus Sammlungen der Mitglieder, vor allen Dingen aber eigene Arbeiten vorgestellt wurden. Bei den Produkten der Dilettantinnen ging es Lichtwark nicht darum, sie Kunstwerken gleichzustellen, sondern um künstlerische Vertiefung. Eine Äußerung von Marie Zacharias angesichts eines kostbaren gemalten Fächers macht die in Hamburg im 19. Jahrhundert stärker als im 18. Jahrhundert vorherrschende so genannte Pfeffersackmentalität, die Lichtwark beklagt, deutlich. "Solch einen Fächer dürfe in Hamburg kein junges Mädchen tragen; die bekäme keinen Mann, weil sie für zu anspruchsvoll gehalten würde."5
Die Jahrbücher (1895-1912) geben einen guten Einblick in die Arbeit der Gesellschaft. Neben der Amateurphotographie, die einen eigenen Komplex bildet, wurden Fragen der Buchausstattung, besonders aber die Themen Blumen und Gärten sowie Architektur und Innenausstattung immer wieder behandelt, um die Formen heimischer Kultur festzuhalten bzw. da, wo sie bereits verloren waren, ins Gedächtnis zurückrufen, um zu Neuem anzuregen. Marie Zacharias war neben Lichtwark die eifrigste Autorin. Bis zu ihrem Tode im Jahr 1907 war sie in fast jedem Jahrgangsband mit ihren Zeichnungen und Aufsätzen vertreten. 1899 schrieb sie einen Beitrag über die rücksichtslose Verwandlung der Hamburger Kaufmannsdielen, Ende des 18. Jahrhunderts noch "Stolz der Familie" (Marie Zacharias); 1900 dann "Von alten Landhäusern": "Nicht lange mehr, so wird auch dieses weltvergessene Stückchen Erde [Billwerder] von dem allgemeinen ,Aufschwung' des deutschen Reiches ergriffen werden. Wie böse Feinde stürzen die Fabrikanten hinein, schlagen im Interesse des Gemeinwohls die hundertjährigen Bäume nieder, die hohen Schornsteine erheben sich in immer kleineren Zwischenräumen, wir sehen auf dem Deich die schmutzigen, schreienden Kinder, statt der gewaschenen, ehrerbietigen Dorfkinder; die Fabrikarbeiterinnen in lehmfarbigen Regenröcken, statt der netten Bauernmädchen, die einförmigen Reihen öder Arbeiterwohnungen, statt der mit Blumen umwachsenen Dorfkathen, und über die blühenden Obstbäume wälzen sich die großen schwarzen Rauchwolken. So vollzieht sich geräuschlos aber folgenschwer die innere und äussere Umwandlung der Landschaft." Ähnlich wie Ebba Tesdorpf ging es Marie Zacharias um die Rettung eines Stückes Kulturgeschichte, denn "das 'unhistorische' Hamburg war zu allen Zeiten bereit, die Spuren seiner Vorväter mit der größten Kaltblütigkeit zu verwischen, und dachte sich nichts dabei".7 Soziale Fragen hatte diese Frau des 19.Jahrhunderts wohl nicht im Blick. 1905 dann schrieb sie über ein Landhaus, das "Herrenhaus in Gross Borstel", zu dem sie nicht nur einen kulturgeschichtlichen, sondern auch einen biographischen Bezug hatte. Es gehörte im 18. Jahrhundert Elisabeth Goßler geb. Berenberg (1749-1822), eine Frau "von männlichem Geist und hoher Bildung"8. Sie war die Mutter von Marie Wilhelmine Greve, geb. Goßler (1778-1865), der Adoptivmutter Auguste von Horns, die ihrerseits die Mutter von Marie Zacharias war. Auguste von Horn lebte in einem sehr armen Elternhaus und wurde von dem kinderlosen Ehepaar Johann und Wilhelmine Greve als Kind adoptiert: "Von allen [Geschwistern] war meine Mutter Auguste die hübscheste, lustigste, und eine in der Nähe wohnende Dame hatte eine große Liebe zu ihr gefaßt."² Beide Frauen Goßler werden auf dem Althamburgischen Gedächtnisfriedhof auf der Grabplatte "Gossler" als Angehörige der bekannten Senatoren- und Kaufmannsfamilie Goßler geehrt, die in der politischen und kaufmännischen Entwicklung Hamburgs eine führende Rolle spielte und nach der auch der Goßlersche Park an der Hoheluft benannt ist.
Kenntnisreich schrieb Marie Zacharias kleine kunst- und kulturgeschichtliche Abhandlungen über die "Kramer-Amts-Witwenwohnungen" (1901), "Das Hamburger Senatoren-Gestühl in der Kirche zu Bergstedt" (1901) "Das Elternhaus von Hermann Kaufmann" (1903), "die Mellenburger Schleuse" (1903) oder "Kloster Alpirsbach" (1904). In einem umfangreichen Plädoyer für die Musik Richard Wagners (1902) treten ihre musikalischen Interessen in den Vordergrund.
1905 berichtete sie in einem Aufsatz "Unsere Vasen" amüsant von der Suche einiger Mitglieder der Gesellschaft in ganz Deutschland nach Töpfern oder Töpferinnen, die anhand von Zeichnungen der Dilettantinnen in der Lage wären, Vasen preiswert herzustellen. Vasen waren, wie auch Blumentöpfe, als Zimmerschmuck aus den Häusern verschwunden. In mehreren Aufsätzen hatte Lichtwark diesen Zustand beklagt. Blumen in passenden Gefäßen sollten dazu beitragen, Schönheit in die Wohnungen zu bringen, den Alltag zu adeln, oder, mit der Antike gesprochen, zu heiligen. Marie Zacharias machte sich die Überwachung der Herstellung und die Verbreitung der Vasen und Töpfe zur Aufgabe. In einer eigens für diesen Zweck im Garten eingerichteten Topfkammer verkaufte sie "Tausende und Abertausende", wie die Hamburger Nachrichten in ihrem Nachruf am 15. Februar 1907 berichteten.
Bis zuletzt suchte Marie Zacharias unermüdlich ihre Fähigkeiten zu vervollkommnen. Sie vertiefte besonders ihre Fertigkeiten im Holzschnitt und schrieb die "Familien-, Stadt- und Kindergeschichten", die ebenfalls vor dem Hintergrund des Bewusstseins, einer vergehenden Epoche anzugehören, von ihrer Familie, der Franzosenzeit, dem Hamburger Brand im Jahre 1842 und der Revolution von 1848 berichten. In der Beschreibung der Zeichenstunden, die Schwiegermutter und Schwiegertochter gemeinsam nahmen, dokumentiert sich noch einmal der Schwung und die Energie, die diese ungewöhnliche und begabte Frau bis zu ihrem Lebensende besaß: "Bis zu ihrem Tode nahm sie Zeichenunterricht. Als sie am 15. Februar 1907 die Augen schloss, hatten wir, sie und ich, 14 Tage vorher unsere letzte Zeichenstunde bei Herrn Kuchel. Herr Kuchel schrieb auf seine Rechnungen nicht ‚für erteilten Unterricht' sondern ‚für Stunden der Anregung'. Das war richtig und humorvoll gesagt. Sie genoß diese Anregung intensiv, sie und der nette, stocktaube Max Kuchel kämpften leise miteinander. Sie hatte ihre Ansichten über Licht und Schatten und Perspektive und Max Kuchel hatte auch seine eigenen. Ich malte am anderen Ende des großen Esszimmers für mich und amüsierte mich dann immer über diesen stillen Kampf."³
Marie Zacharias starb im Alter von 78 Jahren. Die Begräbnisfeier fand in ihrem Haus am Mittelweg statt. Es waren der Bürgermeister Johann Georg Mönckeberg, Vertreter des Hamburger Senats und der Bürgerschaft und zahlreiche Personen aus Kunst und Wissenschaft zugegen. Pastor Cordes von der St. Johannes Kirche in Harvestehude hielt die Gedächtnisrede: "In ihrer Erscheinung mit jedem Zoll eine Dame aus alter Zeit, die trotzdem nicht fremdartig unter dem heutigen Geschlecht wirkte, weil sie dabei in seltener Weise sich aufgeschlossen erhielt für dies moderne Geschlecht mit seinen Interessen und Bestrebungen; selbst immer noch werdend, lernend, ohne je die wesentlichen Elemente ihrer Jugendbildung zu verleugnen; von großer Natürlichkeit, kräftig in ihren Zuneigungen und Abneigungen, allem Menschlichen offen; dabei doch aristokratisch in Gesinnung und Gebaren, von ausgeprägter Neigung für das Feine, Geistreiche, Ästhetische, ein Kind der Romantik."9
Marie Zacharias hatte einst in ihrem Notizbuch festgehalten: "Jung ist nur der Werdende, auch mit grauen Haaren. Wer in seiner Zeit erstarrt, mag zum Teufel fahren."4
Zeichnungen von Marie Zacharias befinden sich im Museum für Hamburgische Geschichte, im Staatsarchiv und in der Kunsthalle. Drei von Leopold von Kalckreuth auf Anregung von Lichtwark geschaffene Portraits Marie Zacharias' sind ebenfalls im Besitz der Kunsthalle. Sie entstanden 1904 in Bockwiese im Harz, wo Marie Zacharias ein kleines Sommerhaus besaß.
Text: Brita Reimers
Quellen:
1 Unveröffentlichte Briefe, Privatbesitz.
2 Marie Zacharias: Familien-, Stadt- und Kindergeschichten. Hamburg
1954.
3 Unveröffentlichte Aufzeichnungen von Elise Zacharias. Privatbesitz.
4 Unveröffentlichte Notizen von Marie Zacharias. Privatbesitz.
5 Gustav Schiefler: Eine Hamburgische Kulturgeschichte. 1890-1920.
Hrsg. Von Gerhard Ahrens u.a. Hamburg 1985.
6 Alfred Lichtwark. In Jahrbuch der Gesellschaft Hamburgischer
Kunstfreunde. Hamburg 1895.
7 Marie Zacharias: Von alten Landhäusern. In: Jahrbuch der Gesellschaft
Hamburgischer Kunstfreunde. Hamburg 1900.
8 Marie Zacharias: Das Herrenhaus in Gross Borstel. In: Jahrbuch der
Gesellschaft Hamburgischer Kunstfreunde. Hamburg 1905.
9 Unveröffentlichte Rede von Pastor Cordes am Sarg von Marie
Zacharias. Privatbesitz.
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
