- Der Garten
- Die Frauen
- Liste aller Frauen
- Historische Grabsteine
- Frauen auf der Erinnerungsspirale
- Frauen auf der Erinnerungssäule
- Verstorbene Vereinsmitglieder
- Frauen auf der Erinnerungsskulptur
- Erinnerungsrosen
- Gedenkglaswürfel
- Gedenktage
- Frauen auf anderen Hamburger Friedhöfen
- Erinnerungsstein: Getötet, weil sie Frauen waren
- Tipps: weitere Frauenbiografien
- Der Verein
- Aktuelles
- Veröffentlichungen/Reden
Historische Grabsteine

Jede Frau erzählt ihre eigene Geschichte – entdecken Sie ihr Vermächtnis.
- Mita von Ahlefeldt
- Anni Ahlers
- Grete Albrecht
- Valerie Alport
- Magda Bäumken
- Anne Banaschewski
- Emmy Beckmann
- Heinz Beckmann
- Ilona Bodden
- Julie de Boor
- Hannelore Borchers
- Freca-Renate Bortfeldt
- Karli Bozenhard
- Hedwig Wanda Anna Berta Marie von Brandenstein
- Hedwig Brandt
- Olga Brandt-Knack
- Anny Breer
- Dorothea Christiansen
- Hildegard (Hilde) Claassen
- Molly und Helene Cramer
- Minna Dittmer
- Minna Froböse
- Eva Gaehtgens
- Gabriela Giordano
- Maria Wilhelmine Gleiss
- Hanna Glinzer
- Marie Glinzer
- Gerda Gmelin
- Christel Grimme
- Marie Groot
- Martha Hachmann-Zipser
- Erna Hammond-Norden
- Julie Hansen
- Charlotte Hilmer
- Marie Hirsch
- Emma Israel
- Franziska Jahns
- Annie Kalmar
- Irmgard Kanold
- Erni Kaufmann
- Bertha Keyser
- Annie Kienast
- Clara Klabunde
- Katharina Klafsky
- Hilde Knoth
- Marie Kortmann
- Charlotte Kramm
- Philine Leudesdorff-Tormin
- Elena Luksch-Makowsky
- Marga Maasberg
- Wilhelmine Marstrand
- Lotte Mende
- Yvonne Mewes
- Antonie (Toni) Milberg
- Mathilde Möller
- Dr. h.c. Erna Mohr
- Domenica Anita Niehoff
- Hilge Nordmeier
- Hermine Peine
- Johanne Reitze
- Celly de Rheidt
- Lola Rogge
- Gerda Rosenbrook-Wempe
- Charlotte Rougemont
- Emmi Ruben
- Amelie Ruths
- Elisabeth Schucht
- Hanna Schüẞler
- Elisabeth Schulz
- Adele Schwab
- Anna Marie Simon
- Anna Simon
- Dr. Ellen Simon
- Elsa Teuffert
- Charlotte Thiede Eisler-Rodewald
- Marie Thierfeldt
- Leonore (Lola) Toepke
- Anny Tollens
- Antonie Wilhelmine Traun
- Dr. Marie Unna
- Anna Wilhelmine Catharina Veldkamp
- Anne-Marie Vogler
- Edith Weiss-Mann
- Bertha Wendt
- Paula Westendorf
- Adele Will
- Aenne Willkomm
- Marianne Wöbcke-Nagel
- Margarethe Wöhrmann
- Anna Cunigunde Wohlwill
- Gretchen Wohlwill
- Henny Wolff
- Hilde Wulff
- Inge Wulff
- Grete Marie Zabe
Historische Grabsteine
Mita von Ahlefeldt
Schauspielerin


13.12.1891
Hamburg
–
18.4.1966
Hamburg
Hamburg
–
18.4.1966
Hamburg
Mehr erfahren
Fast 50 Jahre lang spielte Mita von Ahlefeldt an Hamburger Theatern, und doch ist nur wenig über sie herauszufinden. Gerda Gmelin (ihr Grabstein steht im Garten der Frauen), die Prinzipalin des Theaters im Zimmer, erinnert sich gut an die Kollegin, mit der sie gemeinsam auf der Bühne stand. Aber näheres weiß sie nicht zu erzählen. Im Vordergrund stand ihre Arbeit.
Als Kind und Jugendliche besuchte Mita von Ahlefeldt eine Privatschule und danach die Selecta und das Lehrerinnenseminar. Ob sie dort ein Examen machte und zunächst als Lehrerin tätig war, ist unbekannt, aber durchaus möglich, da ihre spätere Schaupiellehrerin Mirijam Horwitz 8siehe zu ihr in der Rubrik: Frauen auf der Erinnerungsskulptur) sich zum Prinzip gemacht hatte, nur Schülerinnen und Schüler zu unterrichten, die vorher eine andere Ausbildung absolviert hatten oder gerade absolvierten, um ihre Schützlinge vor Arbeitslosigkeit zu bewahren.
Bei Mirjam Horwitz also und Erich Ziegel, die 1918 zusammen die damals engagierteste Hamburger Bühne, die Hamburger Kammerspiele, gegründet hatten, bekam Mita von Ahlefeldt 1919, im Alter von 27 Jahren, Schauspielunterricht. 1920 gab die kleine zierliche Frau hier ihr Debüt; ob in Arthur Sakheims Komödie „Pilger und Spieler“ oder als Puck im „Sommernachtstraum“, darüber gibt es verschiedene Meinungen. An den Kammerspielen erhielt sie auch ihr erstes Engagement. Später war sie Mitglied des Thalia-Theaters. 1927 ging Mita von Ahlefeldt für einige Zeit nach Riga und Reval.
[In der NS-Zeit lebte ihr von ihr geschiedener Mann (englischer Staatsbürger und jüdischer Herkunft) in London. Das für ihren Unterhalt von ihm bestimmte Geld beschlagnahmten die Nationalsozialisten unter dem Vorwand: das Geld würde zur Begleichung der Steuerschulden ihres Mannes benötigt. Mita von Ahlefeldt strengte daraufhin einen Prozess gegen den NS-Staat an, den sie aber 1937 verlor. Dazu schreibt sie in ihrem Entnazifizierungsfragebogen: „Da mir die beschlagnahmte Summe als (…) finanzieller Rückhalt bei Kriegsausbruch fehlte und jede Verbindungsmöglichkeit mit meinem in England lebenden Mann unterbrochen war, musste ich meinen Unterhalt selbst verdienen. Ich wurde durch das Arbeitsamt für den Rüstungsbetrieb verpflichtet.“ (Staatsarchiv Hamburg 221-11 Misc 14878).
Mita von Ahlefeldt arbeitete von 1939 bis 1941 als Angestellte in der Verwaltung bei der Firma Dynamit A.G. Krümmel. Aus gesundheitlichen Gründen wurde sie vom Arbeitsamt zum Reichsluftschutzbund in Hamburg versetzt. Dort war sie bis Ende Juli 1943 tätig und dann wieder als Schauspielerin am Thalia-Theater.
In der NS-Zeit trat Mita von Ahlefeldt nicht der NSDAP bei. Sie war seit 1939 Mitglied der DAF, was obligatorisch war durch die Verpflichtung im Rüstungsbetrieb zu arbeiten. Ferner war sie Mitglied im NS Reichsbund für Leibesübungen, da sie bereits Mitglied eines Turnvereins war. Außerdem war sie Mitglied im NSFK (Nationalsozialistischer Fliegerkorps), da sie Mitglied im Hamburger Aero-Club war. Der NSFK wurde 1937 gegründet und hatte paramilitärischen Charakter. Er war eine luftsportliche Kampforganisation zur Sicherung eines fachlich gut geschulten Nachwuchses für die deutsche Luftwaffe. Mita von Ahlefeldt schreibt zu ihrer Mitgliedschaft in ihrem Entnazifizierungsfragebogen, dass sie „automatisch angegliedert wurde durch Zugehörigkeit zum Hamburger aero-club.“ [Siehe: Staatsarchiv Hamburg 221-11 Misc 14878, Nachtrag v. R. Bake 2018]
Nach dem Krieg hatte sie Stückverträge an vielen renommierten Hamburger Bühnen und in Lüneburg: 1947 trat sie an der Jungen Bühne Hamburg als Großmutter in „Tod im Apfelbaum“ und als Mutter in „Raskolnikow“ im Theater im Zimmer auf. 1948 spielte sie dort die Generalin in „Major Barbara“ von Shaw. 1953 war sie in Lüneburg die Mutter Aase in Ibsens „Peer Gynt“, die Mutter Wingfield in Tennessee Williams „Glasmenagerie“ und 1954 Klärchens Mutter in „Egmont“. 1955 folgte die Mrs. Green in „Heimkehr der Helden“ bei Ida Ehre in den neuen Hamburger Kammerspielen in der Hartungstraße. Auch wirkte sie in verschiedenen Filmen, im Rundfunk und im Fernsehen mit.
Mita von Ahlefeldt starb am 18. April 1966 im Alter vor 74 Jahren im Krankenhaus St. Georg, im Januar hatte sie nach einer Aufführung im Jungen Theater einen Herzanfall erlitten. Ihre letzte Rolle: eine der beiden Giftmischerinnen in „Arsen und Spitzenhäubchen“. In diesem Stück hatte sie bereits 1950 und 54 im Theater im Zimmer gewirkt.
Text: Brita Reimers
Anni Ahlers
Operettensängerin



21.12.1902
Hamburg
–
14.3.1933
Hamburg
Hamburg
–
14.3.1933
Hamburg
Mehr erfahren
Anni Ahlers war Ende der 1920er-Jahre des 20. Jahrhunderts neben der Ungarin Gitta Alpar die gefeierte Operettendiva Berlins. Sie wurde in Hamburg geboren und wohnte mit ihrer Mutter Auguste, geb. Leeberg, ihrer zwei Jahre älteren Schwester Mia und ihrem Stiefvater, dem Maurermeister Cäsar Buschitzky, in der Annenstraße in St. Pauli. Ihr leiblicher Vater war Zirkusstallmeister. Dieser hatte seine Tochter im Alter von vier Jahren mit dem Bühnenmilieu vertraut gemacht. 1920 wurde Anni Ahlers als Tänzerin an die Hamburger Volksoper auf der Reeperbahn engagiert, an der sie bis zum Sommer 1924 blieb. Damit begann ihr Aufstieg von der Tänzerin zur Chor- und schließlich zur Solosängerin. Im Juni 1923 bekam Anni Ahlers ihre erste Solo-Rolle. Sie spielte die Rote Liesy in der Operette "Der fidele Bauer" von Leo Fall.
Zu Beginn der neuen Spielzeit, im September 1924, ging Anni Ahlers nach Itzehoe, wo sie bis April 1925 als Sängerin und Tänzerin am Stadttheater engagiert war. Als die Spielzeit im Herbst wieder begann, wechselte sie ans Stadttheater nach Dortmund. Hier blieb sie wiederum nur für eine Spielzeit und ging dann im August 1926 nach Breslau. Dort hatte sie ihren ersten größeren Erfolg in der Operette "Lady Hamilton" von Eduard Künneke. Die folgenden zwei Jahre blieb Anni Ahlers in Breslau.1929 kam sie nach Berlin, wo sie schnell zu einem der Stars der Operetten- und Revuebühnen avancierte. Ihre erste größere Rolle war die der Barbarina in der Operette "Casanova" von Ralph Benatzky, eine reine Tanzrolle. Doch bereits im Jahr darauf erhielt sie ihre erste große Tanz- und Gesangsrolle, verkörperte die Victoria in "Victoria und ihr Husar" von Paul Abraham. Diese Operette schlug bei den Leipziger Operettenfestspielen im Juli 1930 sensationell ein und wurde danach mit viel Erfolg im Berliner Metropoltheater gespielt.
Jetzt meldete sich auch der Film. Im Jahre 1931 spielte Anni Ahlers in vier Streifen, ("Marquise von Pompadour", "Der wahre Jacob", "Faschingsfee" und "Liebesfiliale"). 1932 wirkte sie in dem musikalischen Lustspiel "Die verliebte Firma" mit.
Im selben Jahr verließ Anni Ahlers Deutschland und ging ans His Majesty's Theatre in London, wo sie in der Rolle der Dubarry in der gleichnamigen Operette von Carl Milröcker Triumphe feierte. Diese Rolle wurde ihr möglicherweise zum Verhängnis. So jedenfalls sahen es manche Freunde und Kollegen, als Anni Ahlers infolge eines Sturzes aus dem Fenster starb. Sie meinten, Anni Ahlers habe, mondsüchtig veranlagt und überarbeitet, Rolle und Realität verwechselt. Als Madame Dubarry hatte sie durch ein Fenster über einen Balkon der Dekoration kriechen müssen. Die Kommission, die in England ungeklärte Todesfälle untersuchte, kam zu dem Ergebnis, es habe sich um einen Suizid gehandelt. Die Einäscherung von Annie Ahlers fand in London unter großer Beteiligung der Theaterwelt und im Beisein ihrer Mutter und Schwester statt, die die Urne nach Hamburg überführten.
Grete Albrecht
geb. Hieber
Neurologin, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes



17.8.1893
Hamburg
–
5.8.1987
Braunlage
Hamburg
–
5.8.1987
Braunlage
Mehr erfahren
Elfriede Margarete "Grete" Albrecht war die Tochter von Charlotte Emilie Hieber, geb. Kammann und des Brauereidirektors Albert Friedrich Hieber. Wenn in ihrer Kindheit über die zukünftigen Berufe der Geschwister gesprochen wurde, hieß es vom Vater: "Mädchen heiraten oder werden Lehrerin." Grete wollte aber weder Lehrerin werden, noch hatte sie als Kind den Wunsch, später einmal zu heiraten. Als sie ungefähr zwölf Jahre alt war, verkündete sie ihren Eltern, später Medizin studieren zu wollen. Ihr Vater nannte dies einen "Spleen", denn: "Mädchen können gar nicht Arzt werden." Als Grete Hieber fünfzehn Jahre alt war, starb der Vater und Grete konnte ihre Mutter überreden, sie Abitur machen
zu lassen. Da es damals noch keine Mädchengymnasien gab, besuchte sie eine Privatschule des Vereins für Mädchenbildung und Frauenstudium. 1913 legte sie als Externe das Abitur an einem Realgymnasium für Jungen ab. Um sie von ihrem Berufswunsch Ärztin abzubringen, schickte ihre Mutter sie zu ihrem alten Hausarzt, damit dieser ihr ins Gewissen rede. Doch auch ihm gegenüber äußerte Grete Hieber den Berufswunsch Ärztin, woraufhin sie eine kräftige Ohrfeige von ihm bekam mit der Bemerkung: "Dummes Gör…" Schließlich durfte Grete Medizin studieren, was sie bis 1918 in München, Freiburg i. Br., Kiel und Berlin tat. Als sie nach ihrem Medizinalpraktikum, das sie in einem Berliner Krankenhaus absolvierte, einen praktischen Arzt, der als Soldat eingezogen war, in dessen Praxis vertrat, wurde ihr klar, warum sie Medizin hatte studieren wollen. So schreibt sie in ihren privaten Aufzeichnungen: "Die Arbeit in der großen Kassenpraxis, die in einem Arbeiterviertel lag, mit fünfzig bis sechzig Patienten an einem Nachmittag, war neu und aufregend für mich. Zum ersten Mal war ich allein verantwortlich für alles was ich tat oder nicht tat." In dieser Zeit in Berlin wurde Grete Albrecht auch die "Rote Grete" genannt. Am Ende ihres praktischen Jahres heiratete sie im April 1919 den Juristen Siegfried Ludwig Hermann Albrecht (1890-1967). Im selben Jahr machte sie ihr Staatsexamen und erhielt ihre Approbation. 1920 wurde ihr erster Sohn geboren. Im selben Jahr promovierte sie. 1922 kam dann der zweite Sohn zur Welt. Zwei Jahre später übernahm sie zweimal wöchentlich Beratungsstunden in einer Beratungsstelle der Säuglings- und Kleinkinder-Fürsorge. Doch immer stärker wurde der Wunsch, sich mehr der Medizin widmen zu können. So fing sie in einem Hamburger Krankenhaus als Volontärärztin an und arbeitete auf der Inneren Abteilung und später auf der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Doch Ihr Interesse galt zunehmend den seelischen und neurologischen Erkrankungen. Deshalb absolvierte sie zwischen 1928 und 1929 eine Weiterbildung bei Ernst Kretschmer in Marburg. Ihre beiden Kleinkinder hatte sie nach Marburg mitnehmen müssen. Ende 1929 kehrte sie mit ihren Kindern nach Hamburg zurück und vervollständigte ihre Fachausbildung bei Prof. Nonne in der Neurologie der Universitätsklinik Hamburg Eppendorf. 1931 ließ sie sich dann als Neurologin nieder. Auch wurde sie Mitglied des Deutschen Ärztinnenbundes, dessen Geschäftsführerin sie 1935 wurde. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten trat der Erlass des Doppelverdiener-Gesetzes in Kraft, wonach u.a. Ärztinnen keine Kassenpraxis führen durften, wenn der Ehemann verdiente. Grete Albrecht verlor 1936 ihre Kassenzulassung, weil ihr Ehemann nach den Nürnberger Rassengesetzen als "Jüdischer Mischling ersten Grades" galt. Im selben Jahr verließ sie auch den Deutschen Ärztinnenbund. Noch 1934 hatte sie sich dort gegen die Diskriminierung verheirateter Ärztinnen eingesetzt. 1942 wurde ihr zweiter Sohn als Soldat getötet. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus nahm Grete Albrecht 1945 ihre Praxis in ihrer Privatwohnung wieder auf. Zwei Jahre später wurde die Ehe geschieden. Neben ihrer ärztlichen Tätigkeit baute sie nach dem Krieg die Hamburger Ärztekammer wieder mit auf. 1945 wurde sie in deren Vorstand gewählt und gehörte ihm bis 1962 an. Auch beteiligte sie sich an der Neugründung des Deutschen Ärztinnenbundes. Auch hier war sie ab 1945 im Vorstand tätig und von 1955 bis 1965 dessen Präsidentin sowie bis 1969 dessen Ehrenpräsidentin. Während dieser Zeit amtierte sie auch von 1958 bis 1962 als Vize-Präsidentin des Internationalen Ärztinnenbundes. Grete Albrecht wollte durch diese ehrenamtlichen Aktivitäten die Stellung der Frau als Ärztin in der Öffentlichkeit festigen und fördern. 1962 wurde sie mit der Paracelsus-Medaille der deutschen Ärzteschaft ausgezeichnet, weil sie auch in "schwerster Notzeit unbeirrt trotz ihr persönlich drohender Gefahren am Leitbild des Arztes als Helfer der sich ihm anvertrauenden Menschen festhielt".
Valerie Alport
geb. Mankiewicz
Kunstsammlerin und Mäzenin

© Kulturkarte.de/Hans-Jürgen Schirmer

Agnesstraße 1, Valerie Alport: Beate Backhaus

23.5.1874
Posen
–
11.12.1960
Marseille
Posen
–
11.12.1960
Marseille
Mehr erfahren
Valerie Aports Grabstein ist das Entrée zum Garten der Frauen. Von der Cordesallee kommend und dem Wegweiser zum, "Garten der Frauen" folgend, der an dem Fußweg steht, der direkt zum Garten der Frauen führt, befindet sich auf der linken Seite des Weges der Grabstein von Valerie Alport.
Valerie Alport, verheiratet mit Leo Alport, Aufsichtsratsvorsitzender der Firma Beiersdorf, hatte von ihrem Bruder Anteile der Firma geerbt. Das Ehepaar hatte zwei Kinder.
Vor dem Ersten Weltkrieg in Paris Kunstgeschichte studiert und mit der Sammlung von Kunstwerken begonnen,veranstaltete sie mit ihrem Mann in ihrer Hamburger Villa in der
Agnesstraße 1 Konzerte und Treffen kunst- und kulturinteressierter Menschen. Mit der jüdischen Malerin Anita Rée (ihre Urne befindet sich auf dem Althamburgischen Gedächtnisfriedhof des Ohlsdorfer Friedhofes) freundschaftlich verbunden, kaufte Valerie Alport ihr viele Bilder ab und schützte sie so vor Armut. Auch begleitete sie sie auf einer von ihr finanzierten Italienreise.
Nach Anita Rée`s Freitod im Jahre 1933 erbte Valerie Alport Bilder der Künstlerin. 1936 schenkte sie einen Teil der Bilder dem jüdischen Museum in Berlin und emigrierte 1937 mit Rèe-Bildern zu ihrem Sohn nach Oxford.
Nach dessen Tod kamen einige Rée-Bilder nach Hamburg zurück.
Magda Bäumken
(geb. Vahlbruch, verh. Bullerdiek)
Schauspielerin am Ohnsorg-Theater:
1921 bis 1959


17.10.1890
Hamburg
–
23.8.1959
Verona
Hamburg
–
23.8.1959
Verona
Mehr erfahren
Magda Bäumken, Tochter eines Klempnermeisters begann ihre Bühnenlaufbahn am Deutschen Schauspielhaus. Durch Zufall kam sie 1921 an die Niederdeutsche Bühne Hamburg, die sich seit 1946 Ohnsorg-Theater nennt.
1944 heiratete Magda Bäumken ihren Bühnenpartner Walther Bullerdiek.
Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten sich verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler der Entnazifizierung unterziehen, darunter auch Magda Bäumken. Sie wurde rehabilitiert und spielte bis zu ihrem Tode am Ohnsorg-Theater. Sie wurde eine der bekanntesten Schauspielerinnen ihres Genres und verkörperte ein Stück niederdeutsche Bühnen-Tradition.
Anne Banaschewski
Direktorin des Instituts für Lehrerfortbildung


16.5.1901
Welschbillig
–
4.5.1981
Hamburg
Welschbillig
–
4.5.1981
Hamburg
Mehr erfahren
"Wer nicht an Entscheidungen mitwirkt, über den wird verfügt. Das gilt im kleinen Rahmen der Schule und des Verbandes, wie es im größeren der Gesellschaft und des Staates gilt", schrieb Anne Banaschewski in einem Aufsatz, um Frauen zu motivieren, sich als Schulleiterinnen zur Verfügung zu stellen.
Anne Banaschewski, seit 1945 schulreformerisch tätig, stritt u. a. für einen höheren Anteil von Frauen in den Schulleitungen und für eine Bildung, die Mädchen nicht nur auf die "kurze Übergangszeit zwischen Schulentlassung und Ehe" vorbereitet, sondern schulisch und beruflich ausbildet, so dass auch Frauen die Möglichkeit des lebenslangen Lernens erhalten.
Anne Banaschewski wuchs mit fünf Geschwistern in einem bürgerlichen Elternhaus auf. Nach dem Abitur studierte sie Kunstgeschichte, Literatur und mittelalterliche Geschichte und promovierte 1923. Danach arbeitete sie bei einem Verlag, später als Redakteurin bei einer Literaturzeitschrift in München. 1926 wurde sie Mutter eines Sohnes. Nach freier journalistischer Tätigkeit, seit 1927 in Hamburg, konnte sie 1929 durch ein Stipendium ein Studium an der Uni Hamburg beginnen. Nach dem 1. Staatsexamen trat sie in den Volksschuldienst ein, alleinerziehend, promoviert und mit Berufserfahrung, aber lediglich als Hilfslehrerin. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus wurde sie 1945 Mitglied des Gründungsvorstandes der "Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens" ("Gesellschaft"). Zur gleichen Zeit berief die Schulbehörde sie zur Schulleiterin der Volksschule Wellingsbüttel und 1952 zur Direktorin des Instituts für Lehrerfortbildung. In der Zeit ihrer Leitung (bis zur Pensionierung 1966) wurde das Seminarangebot erheblich ausgeweitet, die Beratungsstellen ausgebaut. Anne Banaschewski forderte die ‚education permanente' auch für Lehrkräfte. Besonders engagierte sie sich in der Gewerkschaftsarbeit. Sie war lange Jahre im Vorstand der "Gesellschaft", gehörte seinem pädagogischen Ausschuss von 1945 bis zu seiner Auflösung 1976 an. Auch arbeitete sie in der pädagogischen Hauptstelle beim Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), von 1957 bis 1963 als Vorsitzende. 1958 berief die GEW sie in eine Kommission zur Erarbeitung eines Plans zur Neugestaltung des deutschen Schulwesens. Dieser 1960 vorgestellte Bremer Plan war damals in der Öffentlichkeit und auch in Teilen der GEW umstritten. So sah er z. B. die Verlängerung der Volksschuldauer unter Einbeziehung von Elementen der Berufsvor- u. -grundbildung auf 10 Jahre, die Reformierung der gymnasialen Oberstufe und die Neueröffnung eines 2. Bildungsweges vor. Anne Banaschewski, enttäuscht, dass auch viele Hamburger GEW Vertreter den Plan ablehnten, legte daraufhin sowohl den Vorsitz in der pädagogischen Hauptstelle, als auch ihr Mandat im Hauptvorstand der GEW nieder. Anne Banaschewski hielt Friedenserziehung und antifaschistischen Unterricht für notwendig. Neben der Vermittlung historischer Zusammenhänge gehörten dazu u. a. Schülermitverantwortung, die Zusammenarbeit mit den Eltern und vorgelebtes demokratisches Verhalten.
Wesentliches aus: Hans-Peter de Lorent: "Wer nicht mitwirkt, über den wird verfügt". Anne Banaschewski, ihre pädagogische Arbeit und die GEW. In: Monika Lehmann/Hermann Schnorbach: Aufklärung als Prozess. Festschrift für Hildegard Feidel-Mertz. Frankfurt a. M. 1992.
Emmy Beckmann
Politikerin, Hamburgs erste Oberschulrätin




12.4.1880
Wandsbek
–
24.12.1967
Hamburg
Wandsbek
–
24.12.1967
Hamburg
Mehr erfahren
Auf dem Grabstein ist auch Emmy Beckmanns Zwillingsschwester Hanna Beckmann verewigt.
Vor dem Garten der Frauen liegt der Grabstein des Bruders der Schwestern: Heinz Beckmann (siehe zu ihm unter historische Grabsteine: Politik und Soziales).
Emmy Beckmanns Mutter starb nach der Geburt der Zwillinge Emmy und Hanna an Kindbettfieber, der Vater ging eine neue Ehe ein. Zu den drei Kindern (es gab noch einen älteren Bruder, der später Pastor wurde) kamen im Laufe der Zeit vier weitere Geschwister hinzu.
Die Kindheit der drei Geschwister verlief recht lieblos, die neue Mutter kümmerte sich mehr um ihre eigenen Kinder, der Vater, ein Gymnasialprofessor, kam stets erschöpft von der Arbeit nach Hause, war nervös und reizbar. Emmy und Hanna Beckmann fürchteten sich vor ihm, wagten in seiner Gegenwart kaum zu sprechen. Obwohl zwei Dienstmädchen angestellt waren, mussten sie im Haushalt stark mithelfen und die jüngeren Geschwister hüten.
In die Berufslaufbahn der drei Geschwister aus erster Ehe griff der Vater allerdings nicht ein. Die leibliche Mutter hatte für den Zweck der Ausbildung und Bildung der beiden Mädchen eine Erbschaft hinterlassen.
Emmy Beckmann beschrieb 1914 ihren Ausbildungsgang, als sie sich an der privaten Hamburger Gewerbeschule für Mädchen bewarb. "Von 1886 bis 1895 besuchte ich die Höhere Mädchenschule von Fräulein Hübener in Wandsbek, ging dann in die Vorbereitungsklasse des Seminars der Klosterschule zu Hamburg und trat nach einjähriger Unterbrechung Ostern 1897 in das Seminar dort ein. Nach dem vorgeschriebenen dreijährigen Besuch des Seminars bestand ich Ostern 1900 das Examen für die Lehrbefähigung an mittleren und höheren Schulen. Ich war danach fast drei Jahre Erzieherin in England, wo ich drei Mädchen in den gewöhnlichen Unterrichtsfächern unterrichtete. Nach einem dreimonatigen Studienaufenthalt in Paris wurde ich Ostern 1903 Lehrerin an der Töchterschule in Husum, damals einer Kuratoriumsschule von fünf Klassen und neun Stufen. 1906 verließ ich Husum, um mich in Göttingen und Heidelberg auf das wissenschaftliche Examen vorzubereiten in Geschichte, Englisch und Philosophie. Ich habe sieben Semester studiert und bestand im Nov. 1909 das Examen in den genannten Fächern. - Von Ostern 1910 bis Ostern 1912 war ich als Oberlehrerin an der Privatschule von Fräulein Schneider angestellt, von 1912 bis Ostern 1914 an der Schule des Paulsenstiftes (siehe: Anna Wohlwill und Hanna Glinzer, historische Grabsteine im Garten der Frauen) zur Vertretung einer studierenden Lehrerin. Ostern 1914 kehrte diese Dame als Oberlehrerin an das Paulsenstift zurück - damit ist die Vertretung abgelaufen" 1).
Als Emmy Beckmann in Husum lebte, lernte sie „durch eine kritische Auseinandersetzung mit Peter Moors [Erzählung] ‚Fahrt nach Südwest‘, in der es unter anderem um die Frage geht, wie sich Kolonialpolitik und Glaube ans Evangelium vertragen oder nicht vertragen können“,1a) den Schriftsteller und ehemaligen Pastor Gustav Frenssen (1863-1945) kennen. Nach ihm, der lange Zeit in Blankenese gelebt hatte, wurde dort nach seinem Tod eine Straße benannt. In den 1980-er Jahren wurde die Straße wegen Frenssens nationalsozialistischer Nähe umbenannt.
Frenssen, der als Gegenpol seiner schriftstellerischen Arbeit „(…) das Spiel mit einem gesunden jungen Weib“ 1b) liebte, war, als er Emmy Beckmann kennen lernte, bereits seit 1890 mit Anna, geb. Warft, verheiratet. Das hielt Frenssen jedoch nicht davon ab, mehr mit Emmy Beckmann „im Sinn“ zu haben, wie Helmut Stubbe da Luz in seinem Aufsatz über Emmy Beckmann schreibt. „Ein Jahr lang diskutierten er und Emmy Beckmann (…), ob es moralisch vertretbar sei (…), daß ein ‚edles Weib‘ sich ‚ihrem Helden‘ hingebe, wobei Frenssen darauf brannte, die Rolle dieses Helden zu übernehmen und auch Wendungen genug fand, den beabsichtigten Ehebruch (einem von vielen, wie er 1941 in seinem Lebensbericht angegeben hat) in schönstem Licht erscheinen zu lassen: ‚Wenn ‚dieser Held‘ in das Leben eines Weibes nicht hineintritt, so wird sie mit Recht meinen, daß es ihr Schicksal ist, ohne Liebe durchs Leben zu gehen. Wenn er aber kommt und bittet sie um Liebe (…), so soll sie ihm ihre Liebe geben (…). Es ist wahr, daß sie [die Frau, wenn sie Liebe gibt] sich auch Leid und Not schafft; aber ich bin der Meinung, daß diese Not für die Seele fruchtbar ist, während die Not lebenslänglicher Jungfernschaft nach dem, was wir sehen, auf die Weiberseele verdorrend wirkt.‘ (…) Frenssen hoffte ganz allgemein, daß die gebildeten, berufstätigen Frauen, denen die Gesellschaft (…) formal oder informell den Ehestand bis zur Unmöglichkeit erschwerte, sich gegen diese ‚Unnatürlichkeit und Ungesundheit und ungeheure Ungerechtigkeit‘ wenden und ‚sich ein Liebesglück außerhalb der Ehe suchen‘ würden. Die ‚Lehrerinnen, Künstlerinnen, Krankenschwestern‘ hätten dafür nach Frenssens abstruser Erwartung auch bald weitgehende Billigung erwarten dürfen, ‚weil damit die Schweinerei der Prostitution so ziemlich abgeschafft sein‘ würde.“ 1c)
Bei Emmy Beckmann sah Frenssen die „Gefahr, ihr ‚Schönstes und Bestes als Schuld‘ anzusehen und ‚darüber zum Krüppel‘ zu werden. Diese mag ihrerseits in dem Dichter (…) jenen Typus des ‚ewigen‘ Mannes erblickt haben, den sie fast zwei Jahrzehnte später unter freilich fast ausschließlich politischem Aspekt geißeln sollte (…). ‚Der ‚ewige Mann‘ ist unbeirrbar eitel auf seine Überlegenheit als Mann, unbelehrbar durch eigenes Fiasko und skrupellos in der Behauptung seiner Machtstellung‘“. 1c)
Frenssen stellte auch pubertierenden Mädchen nach, weil er meinte, sich einer so genannten ‚Jungmädchennot‘ annehmen zu müssen. Er fragte sie nach ihren Vorstellungen von Liebe und Sexualität aus, ohne dabei auf ihre meist schamhaften Gefühle Rücksicht zu nehmen. Derartige „Beschäftigungen“ mit jungen Mädchen dienen oft der Befriedigung männlicher sexueller Lust und werden von jungen Frauen als sexuelle Übergriffe empfunden, über die sie aber oft schweigen.
1906 ging Emmy Beckmann nach Göttingen und Heidelberg und studierte sieben Semester Geschichte, Englisch und Philosophie. Gustav Frenssen, der nun doch gemerkt hatte, dass Emmy Beckmann mit ihm keine sexuelle Beziehung wünschte, stellte 1907 resigniert fest: „‘Ich sehe, daß da nichts zu machen ist (…). Es sind verschiedene Geister in uns. (…) Sie sind mehr Kultur, ich mehr wilde Natur (…).‘ “ 1c)
Zurück zum Jahr 1914. In diesem Jahr erhielt Emmy Beckmann eine Anstellung an der Gewerbeschule für Mädchen (siehe. Marie Glinzer, historischer Grabstein im Garten der Frauen und Emilie Wüstenfeld in der Rubrik: Erinnerungsskulptur) und war dort bis 1924 tätig - in den Jahren zwischen 1922, als die Schule verstaatlicht wurde und den Namen „Schule für Frauenberufe" erhielt, und 1924 als stellvertretende Direktorin.
1924 ging sie als Studienrätin an eine der neu eingerichteten Aufbauschulen für begabte Volksschüler und -schülerinnen. 1926 wurde sie von dem Kollegium der staatlichen Oberrealschule Hansastraße, der späteren Helene-Lange-Schule, als Schulleiterin berufen. Emmy Beckmann führte dort die Schülerselbstverwaltung ein und sorgte dafür, dass 1927 die Oberrealschule Hanastraße in Helene-Lange-Oberrealschule umbenannt wurde.
1927 wurde Emmy Beckmann Hamburgs erste Oberschulrätin. Ihre Nachfolgerin an der Schule wurde ihre Schwester Hanna, mit der sie zusammen in der Oberstraße 68 lebte. Über ihre Tätigkeit als Oberschulrätin und ihre Schwierigkeiten, in ihrer Leitungsfunktion akzeptiert zu werden, schrieb Emmy Beckmann in ihren unveröffentlichten Lebenserinnerungen: „Im August 1927 trat ich - zur Oberschulrätin ernannt - dies Amt als erste Frau an. Chef der Behörde war der SPD-Senator Krause. Die Kollegen kamen mir freundlich entgegen. Ich übernahm das Dezernat für die höheren Mädchenschulen, die fast alle noch Privatschulen waren und zugleich die Lichtwarkschule. Ich besuchte die mir unterstellten Schulen alle im Unterricht und in den Prüfungen, lernte auch die Kollegien gut kennen. Eine Reihe von privaten höheren Mädchenschulen entwickelten sich in diesen Jahren zu Vollanstalten. Sie bekamen nach einem von der Behörde unter Mitarbeit staatlicher Lehrkräfte veranstalteten Abiturientenexamen die Genehmigung als Vollanstalten. Die Kuratoriums - ebenso wie die Privatschulen sind in den 30er Jahren von dem Nazi-Regime aufgehoben oder verstaatlicht worden. Das hatte sicher - abgesehen von der politischen Tendenz - auch seine sachliche Berechtigung. Im ganzen glaube ich, dass die Übernahme der Verantwortung durch den Staat eine Notwendigkeit war und ist, wobei er den Weg zu pädagogischen Versuchen und Abweichungen von der Norm frei lassen und auch fördern sollte.
Auch in persönlicher Beziehung war die Arbeit erfreulich, sowohl im Kollegium der Schulbehörde wie auch im Verkehr mit den Direktorinnen und Direktoren, letztere kamen mir nicht alle freudig entgegen. Die Frau als Vorgesetzte erregte zunächst wohl Misstrauen und Ablehnung bei verschiedenen Leitern" 1).
1933 wurden Emmy Beckmann und ihre Schwester wegen „nationaler Unzuverlässigkeit" von den Nazis vorzeitig pensioniert.
Noch nach Mai 1932 hatte sie eine mutige „Anti-Nazi“-Schrift mit dem Titel „Um Stellung und Beruf der Frau“ verfasst und veröffentlicht. Darin heißt u. a.: „Es ist wieder einmal ein Kampf um Stellung und Beruf der Frau entbrannt, der alles in Frage stellt, was als sicherer Boden gewonnen zu sein schien (…) Wie diese ganze Ablehnung des neuen Frauentums, seiner Stellung und seines Einflusses aufgefangen und gesammelt ist in der Nationalsozialistischen Partei, ist allgemein bekannt und soll hier heute nicht im einzelnen erörtert werden. Auch handelt es sich nicht, darf sich in unserer neutralen Berufsorganisation nicht handeln um eine Stellungnahme zu den politischen Zielen der Partei. Nur Ausgang, Grundlagen und beherrschende Richtung der Gedankengänge und Stimmungen zur Frauenfrage sollen Gegenstand dieser Betrachtung sein. Ich glaube, daß es nötig ist, daß die Frau unserer Tage diese innere Einstellung weiter Kreise klar erkennt, um nicht vor der Geschichte ihres Geschlechts die Verantwortung auf sich zu laden für einen Rückschritt der Menschheit, wie er kaum je erlebt wurde.
In der Geschichte der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts (…) gibt es unter dem vielfachen Versagen im Menschlichen, (…) kaum etwas Beschämenderes als die Äußerungen von Politikern, Philosophen, Schriftstellern und Pädagogen über Stellung und Aufgabe der Frau. (…) Neben der beschämendsten Nichtachtung oder Verachtung der Frau als geistiger Persönlichkeit stand die Verhimmelung des jungen Mädchens, das sentimentale Preislied auf die Mutter, neben der bedenkenlosen Ausnutzung der Frauenkraft der Proletarierin, der Landarbeiterin die Theorie von der zarten, stets der Schonung bedürftigen Frau des Bürgertums. Dann aber kam die Befreiung und Reinigung der Atmosphäre durch die stetige Arbeit und den scharfen Kampf der Frauenbewegung und später im Weltkrieg die große Bewährung der Frau. Als die Grundlagen der deutschen Republik gelegt wurden, gab es keinen Zweifel: der Frau gebührte das volle Bürgerrecht. (…)
Es ist bekannt, wie die Entwicklung seit Begründung der Verfassung gegangen ist. Wie wenig in dem allmählich sich wieder verfestigenden und erstarrenden, in alte Geleise abrutschenden Parteigetriebe die Frau ihre Auffassungen und Ziele zur Geltung bringen konnte, wie bald die anwachsende Arbeitslosigkeit die Berufsarbeit der Frau nur noch unter dem Gesichtspunkt der Konkurrenz erscheinen ließ. Gleichzeitig sind nun junge Frauen herangewachsen, die – ausgestattet mit der von der vorhergehenden Generation schwer erkämpften Bildung, mit neuen Rechten und Freiheiten – in der ihrer wartenden, Lebensform und den ihnen zufallenden Aufgaben nur Belastung und Verantwortung sehen, die sie nicht wünschen, die ihnen gegenüber dem beglückenden frieden eines Heims, einer engen Familienzusammengehörigkeit von Mann, Frau und Kind als kalter und inhaltsleerer Ersatz erscheint. Und wie überhaupt in unserm Volk in diesem letzten Jahrzehnt der Begriff der Freiheit, der Persönlichkeit am Himmel der Werte niederging und von andern Sternen überstrahlt wurde, so im besonderen für diese jungen Frauen der Stern der Befreiung zu geistigem Menschentum, dem die vorhergehende Generation so gläubig gefolgt war. (…) Es scheint, als ob unsere Zeit sich anschicke, die Aussagen über die Frauen, deren Einseitigkeit und vorurteilsvolle Traditionsgebundenheit uns im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entsetzte, zu überbieten in brutaler Verständnislosigkeit gegenüber dem geistig-seelischen Menschentum der Frau. (…)
Aber täuschen wir uns nicht! Solche Brunnenvergiftung tut ihr Werk; und die jungen Mädchen, die durch Sehnsucht und Ideale, die aus ganz anderen Bereichen stammen, in die Nationalsozialistische Partei hineingezogen sind, werden ihr Bild von Wesen und Ziel der Frauenbewegung doch wohl in erster Linie von den Frauen und Männern empfangen, die ihrer Partei angehören. Können und dürfen wir dem zusehen? Es ist mehr als eine Dankespflicht gegen unsere Vorkämpferinnen und Führerinnen, was uns zur Abwehr solcher Geschichtsfälschung aufruft, es sind die gefährlichen Verirrungen eines jugendlichen begeisterten Idealismus, der durch Zerrbilder abgeschreckt, sich in Haß und Gegnerschaft verliert, wo er verehren und nacheifern müßte. (…)“ 2)
Dennoch beantragte Emmy Beckmann Anfang Januar 1934 ihre Aufnahme in den NS-Lehrerbund. Warum sie dies tat, als, wie Helmut Stubbe-da Luz schreibt, „(...) über die ‚neue gemeinsame Erzieher-Gemeinschaft' Illusionen nicht mehr möglich waren, darüber kann nur gemutmaßt werden: Wahrscheinlich wollte sie eine Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf ihre Vortrags- und vor allem publizistische Tätigkeit treffen. Sie musste sich sagen lassen (was sie freilich schon gewusst haben dürfte), dass die sogenannten 'Paragraph-Vierer' (entfernt aus dem Staatsdienst wegen politischer Unzuverlässigkeit) von der NSLB-Mitgliedschaft ausgeschlossen seien" 1).
Die Schwestern zogen sich in die innere Emigration zurück. Emmy Beckmann hielt diverse Literaturabende bei Freunden ab. Dadurch konnte sie während der Nazizeit ein wenig ihren Lebensunterhalt finanzieren.
Nach 1945 setzte die Schulbehörde Emmy Beckmann wieder in ihr Amt als Oberschulrätin mit dem Ressort Mädchenschulwesen ein. Dort blieb sie, die eigentlich nur bis 1948 hatte arbeiten wollen, bis 1949 tätig.
Für ihre Verdienste in der Frauen- und Mädchenbildung erhielt sie 1953 als erste Hamburgerin das Große Bundesverdienstkreuz. Acht Jahre nachdem der Ehrentitel "Professor" erstmals vergeben worden war, erhielt Emmy Beckmann als erste Frau diesen Titel. 1955 verlieh ihr der Senat den Professorentitel, 1961 als erster Frau die Bürgermeister-Stolten-Medaille. Bürgermeister Paul Nevermann thematisierte in seiner Laudatio die Schwierigkeiten, mit denen eine Frau in einer Führungsposition zu kämpfen hatte: „Das war gewiss keine leichte Aufgabe, sondern ein unermüdliches, fortwährendes Ringen mit Vorurteilen, deren letzte Reste sich bis in unsere Zeit erhalten haben, trotz ungezählter Beispiele dafür, dass auch eine Frau an verantwortlicher Stelle durchaus ‚ihren Mann zu stehen vermag`, wobei Sie aus dieser bewusst gewählten Formulierung heraushören mögen, wie zäh solche Vorurteile sind und wie tief die Auffassung von der angeblichen Unterlegenheit des Weiblichen in die Redewendungen der Alltagssprache eingegangen ist" 1).
Einen Teil ihrer Zeit widmete Emmy Beckmann auch der Literatur. Von ca. 1914 bis in die 50er Jahre war sie Mitglied literarisch-philosophischer Kreise, in denen sie auch Vorträge hielt. Zudem trat sie vor allem in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts mit Veröffentlichungen von Aufsätzen und Literaturkritiken hervor. Meistens schrieb sie über Dichter, die die Themen Krieg, Niederlage und Revolution behandelten. Helmut Stubbe-da Luz schreibt dazu: „Ausschlaggebendes Bewertungskriterium war für Emmy Beckmann, ob in den Stücken ein `Strindbergscher Hass gegen die bestehende Welt sowie die vielfach diesem schwedischen Dichter entlehnte Neigung, Typen anstelle von Charakteren auf die Bühne zu bringen, die Oberhand behielten, oder ob nicht doch wenigstens ganz am Schluss der Wille zum Leben trotz allem in den Protagonisten - welche als ‚gestaltete Persönlichkeiten' individuelles Handeln erkennen lassen sollten - einen wenn auch nur knappen Sieg davontrug" 1). Emmy Beckmann liebte also keine einfachen, vorgefertigten Figuren, bei denen man schon im Voraus wusste, wie sie sich verhalten würden. Außerdem macht ihre Vorliebe für positive Dramenschlüsse deutlich, dass ihr eine zukunftsweisende Lebensweise näher lag - ein Zug, den sie als Politikerin wohl auch brauchte.
Ihre ersten Berührungspunkte mit der bürgerlichen Frauenbewegung erhielt sie 1906 in Göttingen in den von ihr besuchten Oberlehrerinnenseminaren. 1914 gründete sie in Hamburg den Verband der akademisch gebildeten Lehrerinnen mit und wurde bald dessen Vorsitzende. Auch war sie 1915 Gründungsmitglied des Stadtbundes hamburgischer Frauenvereine, dessen stellvertretende Vorsitzende sie bis 1918 und in dessen Vorstand sie bis 1933 war. Ihre pädagogischen Fähigkeiten stellte sie der Frauenbewegung durch stundenweisen Unterricht an der Sozialen Frauenschule zur Verfügung. Außerdem war sie in der 1912 gegründeten Vereinigung für Frauenstimmrecht aktiv, der es in erster Linie um die Gleichstellung von Frau und Mann im vorgegebenen Wahlrecht ging. Die Forderung nach Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts stand erst an nächster Stelle. Emmy Beckmann wurde Helene Langes Nachfolgerin als Bundesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnen Verbandes. Dieser Verband forderte neben dem gleichberechtigten Zugang von Mädchen zu allen Bildungseinrichtungen auch die gesonderte Mädchenschule. Er war der Überzeugung, dass nur in einer gesonderten Mädchenschulen dem „spezifischen Wesen der Frau" Rechnung getragen werden könne. 1933 löste sich der ADLV auf.
Emmy Beckmann schrieb weit über 100 Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, u. a. für die Zeitschrift der bürgerlichen Frauenbewegung „Die Frau". Zudem verfasste sie Broschüren, und zwischen 1926 und 1936 gab sie zusammen mit Irma Stoß die Reihe Quellenhefte zum Frauenleben in der Geschichte (26 Bände) heraus. 1955 setzte sie die Arbeit auf diesem Gebiet fort und gab, zusammen mit der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für Mädchen- und Frauenbildung, Dr. Elisabeth Kardel, die Quellen zur Geschichte der Frauenbewegung heraus, die vornehmlich für Schulen gedacht waren. 1956 und 1957 veröffentlichte sie die Briefsammlungen von Gertrud Bäumer und Helene Lange.
1945, gleich nach dem Krieg bildete Emmy Beckmann u. a. mit Olga Essig (siehe zu ihr in der Rubrik: Frauen auf anderen Hambruger Friedhöfen, hier Friedhof: Bornkamp/Altona) den Frauenausschuss. 1946 gehörte sie zu den Mitbegründerinnen des Hamburger Frauenringes, in dem sie bis 1952 im Vorstand tätig war. 1948 gründete sie den Hamburger Akademikerinnenbund mit. Von 1949 bis 1952 leitete sie den Deutschen Akademikerinnenbund. 1947 war sie auch an der Bildung der Arbeitsgemeinschaft für Mädchenbildung beteiligt.
Ihren politischen Weg schlug Emmy Beckmann wohl erst ein, nachdem sie in der bürgerlichen Frauenbewegung führende Positionen errungen hatte. Durch ihren Bruder lernte sie die Schriften des Liberalen Friedrich Naumann kennen. 1914 besuchte sie eine Veranstaltung der Hamburger Vereinigten Liberalen, und 1918 nahm sie an einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Fortschrittlichen Volkspartei (FVP) teil. Als Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) wurde sie 1921 in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt. Dort war sie hauptsächlich für Schul- und Bildungsfragen zuständig. Sie wehrte sich auch gegen die Kampagne gegen das Doppelverdienertum, wonach verheiratete Beamtinnen kündigen sollten. Sie erreichte es sogar, dass in Hamburg eine Widerspruchskommission zur Prüfung von Härtefällen eingerichtet wurde. Außerdem sprach sie sich für Frauen in leitenden Positionen aus und forderte, dass analog zu Männern auch Frauen im gleichen Maße verbeamtet werden sollten. Bis 1932 stieg sie innerhalb ihrer Bürgerschaftsfraktion auf den zweiten Platz. Nach 1933 saß Emmy Beckmann nicht mehr in der Bürgerschaft. 1949 nahm sie ihre Tätigkeit aber wieder auf, diesmal für die FDP.
Als 1952 über die einzelnen Abschnitte der neuen Hamburger Verfassung abgestimmt wurde, beantragte Emmy Beckmann den Artikel 33 um den Satz „Dem Senat müssen Frauen angehören" zu erweitern. Damit forderte sie schon damals das, was später mit der Frauenquote erreicht werden sollte. Diese Forderung löste jedoch damals nur „allgemeine Heiterkeit" im Parlament aus.
1957 schied Emmy Beckmann aus Altersgründen aus der Bürgerschaft aus. Ihre Bitte, als Politikerin ihre Nachfolgerin bestimmen zu dürfen, wurde von der FDP-Bürgerschaftsfraktion ignoriert.
Seit 1980 gibt es im Hamburger Stadtteil Niendorf eine Straße, die nach ihr benannt ist: Emmy-Beckmann-Weg.
Text: Rita Bake
Zitate:
[1] Wesentliches aus: Helmut Stubbe-da Luz: Emmy Beckmann, Hamburgs einflussreichste Frauenrechtlerin. In: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 73, 1987.
1a) Kay Dohnke, Dietrich Stein (Hrsg.): Gustav Frenssen in seiner Zeit. Von der Massenliteratur im Kaiserreich zur Massenideologie im NS-Staat. Heide 1997, S. 44.
1b) Kay Dohnke, Dietrich Stein, a. a. O., S. 37.
1c) Helmut Stubbe- da Luz, a. a. O., S. 105f.
[2] Emmy Beckmann: Um Stellung und Beruf der Frau. o. O., o. J. [nach Mai 1932]
Heinz Beckmann
Hauptpastor, Protagonist für die Gleichberechtigung der Theologinnen in der Kirche


8.6.1877
Wandsbek
–
12.8.1939
Sülzhayn/Südharz Sein Grabstein liegt direkt vor dem Garten der Frauen.
Wandsbek
–
12.8.1939
Sülzhayn/Südharz Sein Grabstein liegt direkt vor dem Garten der Frauen.
Mehr erfahren
Heinz Beckmann war der Bruder von Hamburgs erster Oberschulrätin, der Frauenrechtlerin und liberalen Politikerin Emmy Beckmann, und deren Zwillingsschwester Hanna. Der gemeinsame Grabstein der Schwestern steht im Garten der Frauen.
Heinz Beckmanns Grabstein ließ der Verein Garten der Frauen direkt vor die Hecke zum Garten der Frauen verlegen, denn in Fragen der Frauenemanzipation wurde Heinz Beckmann sicherlich durch seine Schwestern sensibilisiert. So setzte er sich für die Gleichberechtigung der Theologinnen ein. Solcherart "Beeinflussung" durch seine Schwestern wurde ihm von einigen Kollegen angelastet. Darüber hinaus vertrat er - wie auch seine Schwester Emmy - liberal demokratische Überzeugungen. So war Heinz Beckmann Sprecher der liberalen Fraktion in der Synode.
Nachdem er 1899 das theologische Examen abgelegt und einige Zeit als Hilfsredakteur für die liberal protestantische Zeitschrift "Christliche Welt" und danach als Pastor an der Wiesbadener Marktkirche gearbeitet hatte, kam er 1920 nach Hamburg an die St. Nikolai-Kirche, wo er als Hauptpastor wirkte. Ethische und religionsphilosophische Fragestellungen waren seine Schwerpunkte. Das Alte Testament war das zentrale Thema, mit dem er sich beschäftigte. "In den zwanziger Jahren setzte Beckmann sich insbesondere dafür ein, dass auch Frauen nach dem Theologiestudium die beiden kirchlichen Examina ablegen und in den kirchlichen Dienst übernommen werden konnten"1). Dazu verfasste er auch Aufsätze in der Zeitschrift der bürgerlichen Frauenbewegung "Die Frau", für die auch seine Schwester Emmy Artikel schrieb. Dass die Theologinnen "(…) wie er es gefordert hatte - auch ordiniert und gleichberechtigt neben den Pastoren tätig werden sollten, war jedoch weder in Hamburg noch in einer andern deutschen Landeskirche zu diesem Zeitpunkt mehrheitsfähig"1). So hielt z. B. Pastor Heinrich Wilhelmi (1888-1968) den weiblichen seelsorgerlichen Einfluss für eine "gefällige sentimentale Modemeinung" und "argumentierte", die Frau sei zwar dem Manne religiös gleichwertig, aber "in der ersten Christengemeinde" sei sie von der öffentlichen Wortverkündigung ausgeschlossen worden. Und so solle es auch bleiben. Mit dieser Einstellung stand er nicht allein. Auch andere Theologen sahen in ihren Kolleginnen Konkurrentinnen nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene. Die Ablehnung der Theologinnen als gleichberechtigte Berufskolleginnen war auch Ausdruck tief verunsicherter Männer, die in Zeiten der Moderne und der aktiven bürgerlichen sowie proletarischen Frauenbewegung in einer Identitätskrise steckten und deshalb die alte, unhinterfragte dominante männliche Geschlechtsidentität aufrechterhalten wollten. Dennoch gelang es mit Heinz "Beckmanns Unterstützung, 1927 ein Pfarramtshelferinnen-Gesetz durchzusetzen, das den Theologinnen nach Ablegung beider Examina eine Tätigkeit mit eingeschränkten Rechten ermöglichte"1). Ein Jahr zuvor hatte Heinz Beckmann aus Wiesbaden die Theologin Margarete Braun an die St. Nikolai-Kirche geholt und für sie eine Pfarrstelle zur Verfügung gestellt. Er ermöglichte es ihr, das zweite theologische Staatsexamen abzulegen und bis 1934 als Pfarramtshelferin zu arbeiten. Für Margarete Braun befindet sich im Garten der Frauen ein Erinnerungsstein.
Dem Nationalsozialismus standen er und seine Schwestern ablehnend gegenüber. "Bei der Einführung des Bischofsamtes 1933 wurde er entgegen der Tradition der Anciennität wegen seiner liberalen Haltung übergangen und verlor fast alle öffentlichen Wirkungsmöglichkeiten" 1).
1) Rainer Hering: Heinz Beckmann, in: Hamburgische Biografie, Personenlexikon, Hrsg. von Wolfgang Kopitzsch und Dirk Brietzke, Bd.1. Hamburg 2001.
Der Grabstein von Heinz Beckmann befindet sich links vor dem Eingang zum Garten der Frauen
Ilona Bodden
Lyrikerin, Kinderbuchautorin und Übersetzerin


8.2.1927
Hildesheim
–
16.4.1985
Hamburg
Hildesheim
–
16.4.1985
Hamburg
Mehr erfahren
„Ich schrieb, wie man läuft, wie man springt. Ich war als Kind viel allein. Wir lebten in einer Gegend, in der es keine kleineren Kinder gab. Beim Schreiben erfand ich meine eigene Welt. Ich schrieb Geschichten, ohne ein bestimmtes Ende.“
Wer Geschichten „ohne ein bestimmtes Ende“ schreibt, hat kein geschlossenes, harmonisches Weltbild wie die Autoren und Autorinnen von Kitschromanen, deren Werke stets mit einem Happy-End vor dem Traualtar enden. Und doch muss es nicht so düster sein wie das Ilona Boddens.
Schon ihre Kindheit muss Illusionen über die Welt erst gar keinen Platz eingeräumt haben. Sie verlief offenbar nicht nur einsam und belastet mit der Pflege ihres kränkelnden Vaters, eines Hildesheimer Buchhändlers. Wenn Ilona Bodden später äußert, dass sie ihre Kinderbücher – etwa 20 – schreiben musste, weil sie nur so die entsetzlichen Verwundungen der eigenen Kindheit überwinden könne, ist zu vermuten, dass diese Kindheit noch ganz andere Zumutungen für sie bereithielt. Doch auch später scheint sich Ilona Boddens Verhältnis zur Welt nicht wesentlich geändert zu haben. Ihre Lyrik ist oft düster und trotz der Veröffentlichung ihrer Gedichte in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften, in Anthologien und selbstständigen Lyrikbänden, trotz der Übersetzungen ins Italienische und Ungarische und der Verleihung mehrerer Lyrik-Preise in Italien zog Ilona Bodden, die auch als Übersetzerin aus dem Englischen, Französischen und Italienischen gearbeitet hat, die erschütternde Bilanz:
„Zu früh
Viel zu früh –
Doch die gestundete Frist ist um.
Es gilt die Rechnung zu begleichen.
Aufrichtige Freunde: keine.
Wenig Freude.
Essen und Trinken: karg.
(Die letzten zwei Flaschen Wein waren geschenkte)
Die meisten Ausgaben für nutzlose
Medikamente verschwendet.
(Gegen Taubheit gibt es kein Heilmittel)
Summa summarum:
Die Kosten sind ausgeglichen –
Ich bleibe der Welt schuldig,
was sie mir schuldig geblieben ist.“
Ilona Bodden nahm sich am 16. 4. 1985, wenige Tage nach ihrem Mann, dem Journalisten Günter Löbering, in ihrer Wohnung in der Hoheluftchaussee im Alter von 58 Jahren das Leben.
Geblieben sind ihre Bücher: „Pappeln schwarze Federn aus Nacht. Gedichte“ (1960); „Erinnerung an einen Obelisken“ (1974); „Der gläserne Vogel. Gedichte gegen die Zeit“ (1980); „Schattenzonen. Gedichte außerhalb der Zeit“ (1981); „Die Gehäuse der Zeit. Neue Gedichte“ (1983).
Text: Brita Reimers
Quellen:
Ilona Bodden: Steinerne Gärten. Mit einem Vorwort von Ingeborg Drewitz. Karlsruhe 1987.
Julie de Boor
Portraitmalerin



21.7.1848
Hamburg
–
4.6.1932
Hamburg
Hamburg
–
4.6.1932
Hamburg
Mehr erfahren
Julie de Boor stammte aus einer angesehenen jüdischen Arztfamilie. Ihr Vater war der Arzt und Chirurg Dr. Moritz Unna, der Bruder der Dermatologe Dr. Paul Gerson Unna, nach dem der Unna-Park benannt ist. Sie besuchte Privatkurse bei Eleonore Göttsche und erhielt Zeichen- und Malunterricht bei Bernhard Mohrhagen und Herrmann Steinfurth. Es wird sich bei all dem vermutlich um die damals übliche Ausbildung für höhere Töchter gehandelt haben. 1873 heiratete sie den aus einem uralten holländischen Adelsgeschlecht stammenden Juristen und Bankier Adrian Ploos van Amstel und folgte ihm nach Heidelberg. Doch noch bevor die gemeinsame Tochter Paula am 20. November 1874 geboren war, erschoss sich Adrian Ploos van Amstel, vermutlich wegen finanzieller Schwierigkeiten.
Julie de Boor ging zunächst nach Berlin, um sich bei dem Genre- und Bildnismaler Karl Gussow ausbilden zu lassen, und später nach Paris zu dem gesuchten Portraitmaler Emile Auguste Carolus-Duran. Doch eigentlich verstand sie sich als Schülerin des spanischen Malers Diego Velásquez (1599-1660), der auch ihren Lehrer Carolus-Duran stark beeindruckt hatte. 1880 kehrte Julie de Boor nach Hamburg zurück. Mit ihrer Tochter Paula lebte sie im Hause ihres Vaters und arbeitete in Ateliergemeinschaft mit dem Schlachtenmaler Claus Herrmann de Boor in der Rothenbaumchaussee 197. 1889 heiratete das Paar und zog in das nach seinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen gebaute einstöckige Haus mit Atelier im Dach in die Moorweidenstraße 19 (heute steht dort das Elysée-Hotel). Paula wurde in die Obhut einer französischen Pastorenfamilie in Mailand gegeben.
Das gemeinsame Leben des Künstlerehepaares war nur von kurzer Dauer. Am 30. November 1889 starb Claus Herrmann de Boor.
Unterstützt durch ihre gesellschaftlichen Beziehungen, die ihr Haus zum Sammelpunkt künstlerisch interessierter Menschen machten, insbesondere aber durch ihren Mentor, den Bürgermeister Carl Petersen, war Julie de Boor schnell zu einer beliebten Portraitmalerin mit zahlreichen Aufträgen geworden. Ca. 500 Portraits und Kniestücke in Öl auf Holz oder Leinwand und in Kreide entstanden bis zu ihrem Tod, darunter auch ein Gruppenbild der sieben Rathausbaumeister, das Julie de Boor dem Rathaus zur Eröffnung 1897 stiftete und das im "Rosenkranz" im Ratsweinkeller hängt.
Trotz aller Anerkennung und Wertschätzung starb Julie de Boor als verbitterte Frau. Sie konnte oder wollte wohl nicht begreifen, dass ihre Kunst, die akademische Portraitmalerei, bereits zu ihren Lebzeiten einer vergangenen Epoche angehörte.
Hannelore Borchers
verh. Ausborn
Malerin

Buhnen 1961

Venezianischer Karneval 1979/81


20.11.1932
Warte
–
18.12.1990
Hamburg
Warte
–
18.12.1990
Hamburg
Mehr erfahren
"Die Hamburger Malerin Hannelore Borchers hat fast ihr ganzes Leben lag im Stillen gearbeitet und sich dabei dem herrschenden Kunstbetrieb verweigert, weshalb ihr Schaffen zu Unrecht in Vergessenheit geriet," 1) schreibt der Kunsthistoriker Hanns Theodor Flemming. Sie begann ihre künstlerische und Kunsterzieherinnen-Ausbildung im Alter von 20 Jahren und besuchte bis 1958 die Hochschule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg, wo sie bei den Malern Kurt Kranz und Willem Grimm lernte. Im Alter von 26 Jahren wurde sie Kunstpädagogin am Gymnasium für Mädchen in Hamburg Gross-Flottbek (heute: Gymnasium Hochrad). 1966 wechselte sie an das Emilie-Wüstenfeld- Gymnasium und war dort bis 1988 tätig. 2) Zwischen 1955 und 1961 führte sie eine Lebensgemeinschaft mit dem gleichaltrigen Maler Volker Meier, der ebenfalls an der HfbK bei Willem Grimm studiert hatte.
Ihr freies Schaffen begann Hannelore Borchers "mit
dunkeltonigen Strandbildern, Küstenlandschaften und Stillleben in denen noch spätexpressionische Stilelemente eines Willem Grimm auf veränderter Ebene fortleben. Ihre düster getönten Darstellungen von Fischernetzen, Buhnen, Metallgerüsten, Mauern und Häuserwänden sind von einer schwermütigen Stimmung erfüllt (…)." 1) Ihre zahlreichen Reisen nach Skandinavien, London und Irland inspirierten sie zu weiteren Bildern mit Motiven von Meeres- und Küstenpanoramen "aus Dänemark mit Sturmwolken und weiten Horizonten, die in nuancenreichen Farbvaleurs die spezifische Atmosphäre der skandinavischen Landschaft veranschaulichen. Das gilt nicht minder für die Bilder aus der Folgezeit, die durch Eindrücke von zahlreichen Reisen in den Norden, nach London und vor allem nach Irland geprägt wurden. Irische Moore und Kliffs sind in regnerisch verschwommenen Blaugraugrüntönen einer äußerst differenzierten Palette geschildert, in der die eigegenartige Stimmung des Insellandes zu autonomem malerischem Ausdruck gelangt." 1) Von 1963 bis 1988 war Hannelore Borchers mit dem ein Jahr älteren Maler Gerhard Ausborn verheiratet, der ebenfalls zur selben Zeit wie sie an der HfbK bei Willem Grimm studiert hatte. Im Jahr ihrer Heirat wurde das Ehepaar Gründungsmitglied der "Neuen Gruppe Hamburg", ein Zusammenschluss von ca. 22 jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, der auf keine bestimmte Kunstrichtung festgelegt war. In den 1970er Jahren wandte sich Hannelore Borchers "durch Eindrücke aus Prag, Venedig und Ephesus mehr und mehr [dem] Architektonischen und Figürlichen" 1) zu. "Die tänzerisch bewegten Barockfiguren auf der Prager Karlsbrücke, die antiken Statuen, Torsen und Ruinen der ionischen Tempel und Arkaden von Ephesus, besonders aber die venezianischen Figurinen der Commedia dell'Arte vor der sparsam angedeuteten Kulisse der Lagunenstadt, bilden nun die Themenkreise für anspielungsreiche Kompositionen in Öl oder Gouache, in denen das jeweilige Motiv oft symbolische Bedeutung gewinnt. Das gilt vor allem für die von surrealer Magie erfüllten Palazzi-Interieurs aus Venedig (…) Marmorsäulen und geometrisch gemusterte Marmorfußböden, zwischen denen sich bizarr maskierte Gestalten und seltsam verkleidete Paare des Carnevale di Venezia bühnenhaft bewegen, (…). In diesen Gemälden erreichte Hannelore Borchers einen Gipfel ihres eigenständigen Schaffens." 1)
Hannelore Borchers war auch eine hervorragende Zeichnerin. Sie schuf Bleistift- und Federzeichnungen sowie Schwarzweißradierungen. "Am Ende ihres Lebens wandte sich die Malerin schließlich noch dem bildnerischen Verfahren der Collage zu, deren Teile sie aus Ausschnitten illustrierter Zeitschriften symbolhaltig zusammenfügte, wobei aus Formen Bedeutungen entstanden und umgekehrt. Bildtitel wie ‚Adriatisches Unwetter', (…) ‚Götterdämmerung', ‚Gipfelstürmerei', (…) deuten auf derartige formal-motivische Wechselbeziehungen." 1)
Quelle:
1) Hanns Theodor Flemming: Hannelore Borchers 1932-1990. Eine Retrospektive, 28.10. bis 13.12.1991. Galerie Christian Zwang Hamburg. Katalog 6.
2) freundliche Auskunft von Renate Vidal, ehemalige Schülerin von Hannelore Borchers.
Freca-Renate Bortfeldt
verh. Lohkamp
Schauspielerin und Theaterregisseurin


5.5.1909
Hamburg
–
17.3.1986
Hamburg
Hamburg
–
17.3.1986
Hamburg
Mehr erfahren
Bevor Freca-Renate Bortfeldt in Hamburg ein Engagement als Schauspielerin bekam, war sie schon seit 1930 auf verschiedenen Bühnen Deutschlands aufgetreten, so in Stralsund, Bochum, Königsberg und Bremen. 1942 kam sie nach Hamburg ans Thalia Theater. Ein halbes Menschenleben gehörte die mit dem ebenfalls am Thalia Theater engagierten Kollegen Emil Lohkamp verheiratete Schauspielerin zum Ensemble. Auch ihr Bruder Hans-Robert Bortfeldt war dort eine Zeitlang engagiert. Als Salonschlange und elegante Gesellschaftsdame war Freca-Renate Bortfeldt eine Favoritin der Abonnentinnen und Abonnenten. Aber auch
moderne Regisseure schätzten ihr Talent. Unter Hans Neuenfels hatte sie als Großmutter in "Bernarda Albas Haus" einen herausragenden Erfolg.
Freca-Renate Bortfeldt trat auch im Fernsehen auf, so z. B. in: "Zwei wie wir... und die Eltern wissen von nichts" (1966), "Ein besserer Herr" (1973) und in der NDR-Kriminalhörspielserie "Die Jagd nach dem Täter" (1957-1964) sowie in dem Hörspiel von Karol Sidon "Göttin Welt".
Als Theaterregisseurin hatte Freca-Renate Bortfeldt ebenfalls Erfolg. So inszenierte sie zwischen 1949 und 1969 am Thalia Theater Kindermärchen. Unter dem männlichen Pseudonym Wilhelm Strahl übernahm sie auch deren Bearbeitung. Freca-Renate Bortfeldt inszenierte z. B. am Thalia Theater 1949 das Märchen "Aschenputtel"; 1951 "Der gestiefelte Kater" und "Schneewittchen"; ein Jahr später "Dornröschen" und 1968 "König Drosselbar". Das 1953 unter ihrer Regie aufgeführte Märchen "Schneeweißchen und Rosenrot" wurde von der ARD als Film aufgezeichnet und an den Weihnachtsfesttagen vom NWDR ausgestrahlt.
Diese Inszenierungen brachten ihr den Spitznamen "Pfefferkuchen-Fehling" ein.
Karli Bozenhard
(Karoline, geb. Hücker)
Schauspielerin am Thalia-Theater von 1889 bis 1930 und von 1941 bis 1943

Karli Bozenhard: Staatsarchiv Hamburg


11.6.1865/1866 ?
Wien
–
1.2.1945
Hamburg
Wien
–
1.2.1945
Hamburg
Mehr erfahren
Der Name Bozenhard ist aus der Geschichte des Thalia Theaters nicht wegzudenken. Über 40 Jahre gehörten Albert und Karli Bozenhard dem Ensemble des Thalia-Theaters an, hier lernten sie sich kennen und standen oft gemeinsam auf der Bühne, wobei allerdings Albert Bozenhard der talentiertere von beiden war und sich zudem einer ungewöhnlichen Beliebtheit beim Publikum erfreute.
Ihren Werdegang soll die gebürtige Wienerin im folgenden selbst erzählen, da ihre Worte viel von ihrer frischen und volkstümlichen Art und Begabung verraten: „Ich bin wie jeder Mensch geboren, und zwar in Wien, im Josefstädter Theater, somit ein richtig gehendes (d.h. gehend erst nach 11 Monaten)Theaterkind; mein Vater war am k.k. priv. Theater in der Josefstadt Hausinspektor, und ich war das, verzeihen Sie, zwölfte aber dafür auch das letzte Kind meiner Eltern, gerade gewachsen, nicht hässlich, nicht schüchtern – und schon mit 2½ Jahren spielte ich meine erste Rolle, einen Ritter in dem Kindermärchen ‘Der verzauberte Apfelbaum’; nach 5 Jahren sang ich schon Couplets, spielte alle Hauptrollen in den Kindervorstellungen und war in meinem 7. und 8. Jahr gleichzeitig an drei Wiener Bühnen engagiert. Es kam einmal vor, dass ich an einem Abend an allen drei Theatern spielte, im Josefstädter den kleinen Hamlet in ‘Therese Krones’, im Burgtheater das blutige Kind in ‘Macbeth’ und im Carltheater den kleinen Gottlieb in ‘Mein Leopold’ – immerzu im Fiaker hin und her – es war ein richtiges ‘Geriss’ um die kleine Hücker. Später reiste ich dann als so genanntes Wunderkind mit Soloszenen und Vorträgen und erspielte mir ein Vermögen; Nicht wie andere Kinder mit Puppen und Spielzeug verbrachte ich meine Jugend – mein Tummelplatz war immer das Theater! Trotzdem war ich eine Muster- und Vorzugsschülerin und durfte nach einer Extraprüfung die Schule ein Jahr früher verlassen – um gastieren zu können. Als erwachsener Mensch blieb mir nichts erspart in meiner Laufbahn, ich habe die Misere des Meerschweinchens (sprich: Schmiere) kennengelernt und könnte darüber Dramen und Humoresken schreiben – vielleicht tue ich´s auch noch. Dann kamen zwei herrliche Jahre mit dem Münchener Ensemble unter Max Hofpauer – das waren fortwährend Triumphzüge. Von da weg war wieder einmal das ‘Geriss’ um mich: Maurice engagierte mich für das Hamburger Thalia-Theater, gleichzeitig wollte mich Anno für das königliche Schauspiel in Berlin, und Förster vom Wiener Burgtheater bot Maurice eine Entschädigung, wenn er mich freiließ, aber Maurice bestand auf meinem Kommen und – ich bin froh – denn wie hätte ich sonst meinen Mann gekriegt? Was ich in den 28 Jahren meines Hamburger Wirkens teils gut, teils weniger gut, teils schlecht gemacht – ich weiß es nicht. Als ich herkam waren es die Louisen, die Galottis und Heros, später die Anzengruber-Jungfrauen, noch später die Röss'l-Wirtin, dann Gina (Wildente) und jetzt sind's die melierten, grauen und weißköpfigen guten und bösen Mütter – aber nur auf den Brettern -, sonst fühle ich mich noch wie in der Zeit meiner Wunderkindreisen, von denen ich immer noch meinem Mann erzählen muss“ 1)
Diesem autobiographischen Text aus dem Jahre 1917 ist nur noch hinzuzufügen, dass Karli Bozenhard anlässlich ihres 40. Bühnenjubiläums, 1929, als erste Frau am Thalia-Theater zum Ehrenmitglied ernannt wurde. 1930 trat das Ehepaar Bozenhard in den Ruhestand und verließ die Stadt, um sich in Stuttgart niederzulassen. Am 13.Januar 1939 starb Albert Bozenhard. Seine Frau kehrte nach Hamburg zurück und trat von 1941 bis 1943 erneut am Thalia-Theater auf.
Seit 1958 gibt es im Stadtteil Hohenfelde den Bozenhardweg. Er war nach Albert Bozenhard, dem Schauspieler und Ehemann von Karli Bozenhard,benannt. 2001/2002 wurde die ebenso bedeutende Ehefrau Karli Bozenhard miteinbezogen, so dass der Weg nun nach beiden Personen benannt ist.
Diese Erweiterung erfolgte auf Initiative von Dr. Rita Bake. Es gab in Hamburg vierzehn Straßen- und Wegenamen, die nach den Nachnamen beutender Männer benannt waren, deren weibliche Angehörige mit selben Nachnamen aber ebenso Bedeutendes geleistet hatten. Rita Bake hatte deshalb die Idee, diese Straßen, ohne dass die Namensgebung verändert werden musste – was immer zu erheblichen Schwierigkeiten mit den Anwohnerinnen und Anwohnern führt - auch nach diesen beutenden Frauen selben Namens zu benennen, und zwar indem die an den Straßenschildern angebrachten Erläuterungsschildchen mit dem Namen der Frau ergänzt werden. Der Senat nahm die Initiative auf und somit wurden durch diese Aktion vierzehn bedeutende Frauen durch einen Straßennamensgebung geehrt.
Text: Brita Reimers
Zitat:
[1] Zitiert nach: Richard Ohnsorg: Fünfundsiebzig Jahre Hamburger Thalia-Theater. Vergangenheit und Gegenwart. Festschrift zum 9. November 1918. Hamburg 1918.
Hedwig Wanda Anna Berta Marie von Brandenstein
Eine der ersten niedergelassenen Ärztinnen in Hamburg



13.06.1886
Hamburg
–
30.05.1974
Hamburg
Hamburg
–
30.05.1974
Hamburg
Mehr erfahren
Hedwig von Brandenstein war die Jüngste von zehn Geschwistern. Nur über den Beruf bzw. den sozialen Stand ihres Vaters erfahren wir etwas: er war Oberstleutnant gewesen.
Hedwig von Brandenstein besuchte in ihrer Jugend das Internat Stift Heiligengrabe in der Mark Brandenburg. 1905 machte sie an einem Erfurter Realgymnasium das Abitur. Danach absolvierte sie ein zehnsemestriges Medizinstudium in Straßburg, Freiburg, Heidelberg und Berlin. Während ihrer Straßburger Studienzeit musste sie die Erlaubnis jedes einzelnen Professors für den Besuch seiner Vorlesungen einholen. Oft wurde ihr dies abgelehnt.
Im Mai 1910 schloss sie in Heidelberg das Medizinstudium mit dem Staatsexamen ab. Nach dem Studium war sie als Medizinalpraktikantin an der Heidelberger Universitätspoliklinik und später an der Universitäts-Frauenklinik in Halle tätig.
1911 promovierte Hedwig von Brandenstein. Im selben Jahr erhielt sie ihre Approbation. 1913 wurde sie als Ärztin am Virchow-Krankenhaus Berlin und von September 1913 bis September 1914 als Hilfsärztin am Waisenhaus Berlin tätig. Danach war sie von 1914 bis 1918 Assistentin am Institut für Geburtshilfe Hamburg und von 1917 und 1961 niedergelassene Ärztin in Hamburg. Zwischen 1919 und 1951 fungierte sie auch als Postvertrauensärztin. Auch arbeitete sie nach dem Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Ausschüssen der Ärztekammer und fungierte einige Zeit als Vorstandsmitglied im Deutschen Akademikerinnenbund.
Insgesamt 47 Jahre lang war Hedwig von Brandenstein als Hausärztin und 40 Jahre lang als Geburtshelferin tätig. Nebenamtlich arbeitete sie als Vertrauensärztin. Hedwig von Brandenstein war wegen ihrer liebenswürdigen, menschlichen und geistigen Lebensart eine beliebte Nachbarin. Sie wohnte in der Fontenay 5.
Hedwig Brandt
geb. Stosch-Sarrasani
Die rechte Hand ihres Vaters, Direktor des Zirkus Sarrasani



1.3.1896
Berlin
–
28.2.1957
Hamburg
Berlin
–
28.2.1957
Hamburg
Mehr erfahren
Hedwig Stosch-Sarrasani war die Vertraute ihres Vaters Hans Stosch (1873-1934). Nach der Schule - anfangs besuchte sie ein Pensionat in Dresden, später ein Internat in der Schweiz - wurde Hedwig ab ihrem 14. Lebensjahr in die Arbeit des Zirkus mit einbezogen: als Kunstreiterin, Kassiererin und auch als ein Mitglied des "Putztrupps", der nach den Vorstellungen aufräumen und saubermachen musste. Doch das Verhältnis von Vater und Tochter trübte sich, als Hedwig auf einer gemeinsamen Reise mit ihrem Vater nach Hamburg, ihren zukünftigen Ehemann kennenlernte. Hans Stosch war mit seiner Tochter auf der Werft Blohm + Voss, um Verhandlungen
über einen Schiffstransport seines Zirkus nach Südamerika zu führen. Für diese Gespräche wurde ihnen "der beste Mann der Werft", der Leiter der Reparaturabteilung, vorgestellt.
1920 heiratete die 24-Jährige gegen den Willen ihres Vaters, der bereits während des Ersten Weltkrieges "einen Mann vom Fach" für sie ausgesucht hatte. Hedwig zog nach Hamburg und bekam ein Jahr nach der Hochzeit ihr erstes Kind, ein Mädchen, dem 13 Monate später ein Junge folgte. Diese Geburtenabstände glichen denen von Hedwig und ihrem Bruder und führten deshalb bei den Zirkusleuten zu abergläubischen Vermutungen; die Folge: Vater und Tochter versöhnten sich und fortan reiste Hedwig Brandt immer mal wieder für einige Monate zu ihrem Vater, um ihm bei der Zirkusarbeit zu helfen. Musste der Vater auf Reisen, war die Tochter die Generalbevollmächtigte des Zirkus. Zwischen 1920 und 1925 bekam Hedwig Brandt zwei weitere Kinder. Ein Dienstmädchen half im Haushalt, und während Hedwig Brandts Abwesenheit wurden die Kinder von der Schwägerin betreut. Nach dem Tod ihres Mannes stürzte Hedwig Brandt in eine schwere wirtschaftliche Krise: Blohm & Voss zahlte ihr nicht die (Witwen) Betriebsrente. Dies belastete sie sehr und machte sie krank. Trotzdem war sie voller Begeisterung dabei, als 1955 Fritz Mey, ein ehemaliger Mitarbeiter des 1945 in Dresden ausgebombten Zirkus Sarrasani, mit Spendengeldern versuchte, das Unternehmen wieder aufzubauen. Sofort gab sie ihr Einverständnis für den Zirkusnamen "Sarrasani" und reiste 1956 zu dessen Eröffnungsvorstellung nach Mannheim. Ein Jahr später verstarb sie.
Olga Brandt-Knack
Ballettmeisterin, Bürgerschaftsabgeordnete



29.6.1885
Hamburg
–
1.8.1978
Hamburg
Hamburg
–
1.8.1978
Hamburg
Mehr erfahren
Im Alter von zehn Jahren begann Olga Brandt in der Kindertanzschule des Hamburger Stadttheaters mit der Ballettausbildung in klassischem- und Ausdruckstanz. Sie gehörte dem Theater von 1900 bis 1933 an. Von 1901 bis 1922 tanzte sie dort im Corps de Ballet, avancierte 1907 zur Solotänzerin und 1922 zur Leiterin der Tanzgruppe des Hamburger Stadttheaters. Sie ging mit ihrer Gruppe auf Gastspielreisen, so nach Stockholm, Kopenhagen, Den Haag, Scheveningen und Lille.
Neben ihrer tänzerischen Arbeit engagierte sich Olga Brandt-Knack auch auf standespolitischem Gebiet. Sie gründete 1908 den „Deutschen Tänzerbund" und setzte sich als seine Sprecherin für die Belange ihrer Berufskolleginnen und -kollegen ein. Von 1918 bis 1933 war Olga Brandt-Knack kulturpolitische Referentin der „Genossenschaft der Bühnenangehörigen“.
Als Olga Brandt-Knack die Leitung des Balletts des Stadttheaters - unter ihrer Regie Tanzgruppe genannt - übernahm, wurde sie die Nachfolgerin von Alfred Oehlschläger. Unter ihm hatte sich das Ballett auf Tanzeinlagen in Opern und Weihnachtsmärchen beschränkt - von Reformbestrebungen im Tanz war noch nichts zu spüren. Aber auch unter der Leitung Olga Brandt-Knacks blieb es fast ausschließlich bei tänzerischen Einlagen in Operninszenierungen. Sie durfte nicht anders agieren. Rudolf Maack schreibt dazu: „Wer in den 20er Jahren in Hamburg Tanz sehen wollte, mußte ins Curiohaus oder zu Labans Vorstellungen gehen. Denn an der Dammtorstraße [dort stand das Stadtheater] führte Tanz nur ein Aschenbrödel-Dasein. Dafür sorgte Leopold Sachse [Intendant des Stadttheaters]. Olga Brandt (...) durfte ihre kleine Mädchenschar regelmäßig in Operneinlagen und allenfalls auf seltenen Matineen vorzeigen. Dabei hatte sie sich in Dolly Haas, Carmen Holtz und Lotte Krause aus ihrer Kindertanzgruppe einen tüchtigen Nachwuchs erzogen."1)
Ihr einziges selbstständiges Ballett war „Der Gaukler und das Klingelspiel", welches 1929 im Stadtheater aufgeführt wurde. Und auch nur einmal durfte sie in einer Abendveranstaltung nach „Don Pasquale" mit ihrer Tanzgruppe eine Pantomime aufführen.
Olga Brandt-Knack hielt aber mit ihren Reformideen nicht hinter dem Berg, sondern lieferte sich eine heftige Kontroverse mit ihrem Intendanten Leopold Sachse. Sie stritten sich besonders über die Bedeutung der Musik beim Tanz. Für Leopold Sachse, der von Haus aus Musiker war, stand natürlich die Musik im Vordergrund und nicht der Tanz - und so machte er 1930 - als er als Gastgeber des Internationalen Theaterkongresses in Hamburger Stadtheater fungierte, deutlich, dass er nicht der Ansicht sei, dass die Musik beim Tanz die Zubringerrolle spielen dürfe: „Wenn die Tänzer sich nicht scheuten, Beethoven zu vertanzen, dürften sie sich über die Ablehnung der Musiker nicht wundern. Er selbst als Musiker könne seiner großen Liebe zum Tanz naturgemäß nur in bescheidenem Maße nachgehen. ‚Ich sollte mir wohl von meiner Ballettmeisterin für den Tanz in der Oper die Regie vorschreiben lassen? Das wäre ja noch schöner!`"1) Olga Brandt-Knack, die gemeint war: „saß dabei, und ihre Miene sagte: Da hört ihr es." 1)
Olga Brandt-Knack stand dem modernen Ausdruckstanz sehr aufgeschlossen gegenüber. Er stellte den überlieferten Formen der Tanzkunst eine Bewegung gegenüber, die sich aus dem Eigenrhythmus des Körpers rekrutierte. In einem von Olga Brandt-Knack 1926 im Bühnenalmanach verfassten Artikel über „die Umgestaltung des Opernballetts" gab sie einen Blick auf die Entwicklung der neuen Tanzform: „Es ist fast als eine Selbstverständlichkeit zu bezeichnen, dass die neue Tanzform auch auf dem Theater Kräfte wachrief, die das innige Bedürfnis hatten, die im Schematismus erstarrte Ballettkunst neu zu gestalten. Der Tanz war im Laufe der Zeit zur schablonenmäßigen Einlage in der Oper herabgewürdigt. Gelegentlich gegebene selbstständige Balletts oder Pantomimen werden ihrer Einförmigkeit halber vom Publikum meist abgelehnt. Erst als der Siegeszug der Russen einsetzte, begann man zu ahnen, dass der Tanz nicht nur ein geist- und seelenloses Gehüpfe und einen Triumph der Beinmuskeln über den übrigen Körper bedeutet, sondern dass Ernsteres, Höheres die Triebfeder des Tanzes ist (...)." 2)
Um ihre Ideen der neuen Tanzform zu verwirklichen, zog sie in den 1920-er Jahren mit der Tanzschule des Stadttheaters ins Vogt`sche Konservatorium im Curio-Haus. Hier war auch schon Mary Wigmann mit ihren musiklosen Tänzen aufgetreten. Auch nahm sie Kontakt mit dem Tänzer und Choreographen des Bewegungstanzes Rudolf von Laban auf.
Es war Olga Brandt-Knack jedoch bewusst, dass es immer einen Unterschied zwischen dem Tanz im Konzertsaal und dem auf der Opernbühne geben wird. Denn: „Beim Tanz im Theater kommt es nicht nur darauf an, Musik zu tanzen, sondern der Inhalt des Tanzes muss sich auch dem gegebenen Milieu anpassen. Es wird deshalb die Tanzform im Theater immer eine andere sein und bleiben müssen, als der jetzt in den Konzertsälen gebrauchte Stil, der allerdings schon anfängt, bei einigen seiner besten Vertreterinnen stereotyp zu wirken. (...). Der Tanz im Theater will als Teil der Gesamtwirkung der Oper beurteilt sein. Es darf nicht, wie das bei früheren Balletts die Regel war, aus dem Gesamtbild besonders hervortreten, Rhythmus ist das oberste Gesetz, in dem sich Musik, Bewegung und Farbe zu vereinen haben. Dieses Ziel wird erst dann voll erreicht werden, wenn der tänzerische Nachwuchs unserer Opernbühnen in diesem Geiste erzogen ist. Die von mir gewollte Umgestaltung des Opern-Balletts bedarf eines Neuaufbaues von unten herauf. Erfreuliche Erfolge sehen wir bereits an manchem größeren Theater. (...) Auch am Hamburger Stadttheater wird die Tanzschule nach den von mir angedeuteten Richtlinien geleitet. Und ich darf wohl sagen mit zunächst bescheidenen, aber offensichtlichen Erfolgen."2)
Angesichts der unterschiedlichen Aufgaben, die der Tanz in der Oper und im Konzertsaal hatte, versuchte Olga Brandt-Knack eine Synthese von klassischem Ballett und Ausdruckstanz herzustellen. Dazu bekam sie 1930 mit ihrer Choreographie der Bewegungsszenen der Gluckschen Oper „Orpheus und Eurydike", die im Stadttheater zur Aufführung kam, Gelegenheit.
Olga Brandt-Knack hatte mit ihrer neuen Tanzform Erfolg. Hans Wölffer lobte Olga Brandt-Knacks Tanzgruppe 1926 im Bühnenalmanach: „Diese Gruppe ist nicht nur Tanzgruppe, nicht nur ‚Ballett`, sie ist darüber hinaus in stilistischer Hinsicht ein durchaus selbständiger Faktor im modernen Kunstleben. Diese Eigenschaft hebt sie aus der Masse der heutigen Tanzgruppen von vornherein heraus. Sie erfordert als Leiterin eine tiefgründliche stilistische Kapazität; nicht nur Olga Brandt sein, sondern jeweils etwa Mozart und Brandt; Verdi und Brandt oder Strauß und Brandt zu einer Schöpfung von eigenem Werte zu verbinden, wird ihre Aufgabe sein. (...) In der grundsätzlichen Tendenz ihres Schaffens teilt Olga Brandt die Bestrebungen des modernen Ausdrucksballetts. Doch wird man bei dieser Tanzgruppe nie den Eindruck uferlosen Experimentierens erhalten haben; den Blick unbeirrbar auf das Neue gerichtet, verliert sie nicht den Kontakt mit den überlieferten Werten klassischer Tanzkunst. Die ewige Antithese Oper und Drama, Ballett und Ausdruckstanz wird hier zur Synthese zwischen der Technik des klassischen Balletts als Mittel und dem Ausdrucksvermögen des modernen Tanzes als Zweck."3)
Als Olga Brandt-Knack 1918 Mitglied der SPD wurde, verband sie Politik und Tanz miteinander. Häufig trat sie mit ihrer Tanzgruppe auf der Bühne des Gewerkschaftshauses am Besenbinderhof auf, und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gründete sie zusammen mit dem Schauspieler Adolf Johannsson den Arbeiter-Sprech-und Bewegungschor, der dann Ende der 1920-er Jahre von Lola Rogge (siehe die Installion zu ihr im Garten der Frauen) übernommen wurde.
1932 gründete sie zusammen mit Lola Rogge und anderen die Vereinigung „Tanz in Hamburg e.V.", um „das am künstlerischen Tanz interessierte Publikum zu sammeln, ihm den Genuss regelmäßiger Tanzveranstaltungen zu verschaffen und wenn irgend möglich, ein eigenes Tänzerhaus zu errichten, das als eine Heimstätte für den Tanz und die Tänzerschaft gedacht ist." Im Januar 1933 veranstaltete „Tanz in Hamburg e.V." seine erste Matinee mit Hamburger Tanzkomponisten. Aber noch im selben Jahr wurde die Vereinigung in den „Kampfbund für Deutsche Kultur" gleichgeschaltet. Dieser „Bund" wurde von den Nationalsozialisten errichtet, um sich den Tanz dienstbar zu machen. Nach nationalsozialistischer Auffassung bestand die Aufgabe des Tanzes darin, „als ein guter Treuhänder echter deutscher Kulturentwicklung zu wirken, und dabei einerseits alle wirklich gesunden künstlerischen Strömungen zu unterstützen und zu fördern, andererseits aber auch strengstens darüber zu wachen, dass alle ungesunden Auswüchse vermieden werden und dass die deutsche Tanzkunst vor allem nicht durch das geschäftige Hintertreppenwirken artfremder Elemente verwässert und vergiftet werde (...), denn es geht nicht an, dass ausgerechnet ein kulturell so hochstehendes Volk wie das deutsche, seinen künstlerischen Weg von rassenfeindlichen Elementen vorgeschrieben erhält und auf tänzerischem Gebiet Prinzipien zu huldigen gezwungen wird, die alles andere als deutsch sind."1)
1933 wurde Olga Brandt-Knack wegen „politischer Unverträglichkeit" aus dem Stadttheater entlassen, auch musste sie ihre Tanzschule aufgeben. Sie wurde unter Gestapo-Aufsicht gestellt und vorübergehend verhaftet. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie bis zum Jahre 1942 zusammen mit ihrer Schwester als Sprechstundenhilfe. Dann zog sie bis Kriegsende zu Freunden aufs Land. Ihr ehemaliger Ehemann, Prof. Dr. Andreas Knack, der Leiter des Allgemeinen Krankenhauses Hamburg-Barmbek, den sie 1920 geheiratet hatte, und der 1928 Edith Hommes (1891- ?) geheiratet hatte, war ebenfalls fristlos entlassen worden und emigrierte mit seiner Frau nach China.4) Er wurde beratender Arzt am belgischen Missionshospital in Kweisui, praktischer Arzt in Peking und Mukden und in Shanghai ärztlicher Berater des „International Relief-Committee of China". 1948 kehrte das Paar nach Hamburg zurück. Hier zog sich Andreas Knack bald von seinen Aktivitäten zurück und fand, wie es in seinem Nachruf heißt: „einsam von den vielseitigen körperlichen und seelischen Belastungen, die das Leben ihm auferlegte, Ruhe".
Olga Brandt-Knack trat gleich nach der Befreiung vom Nationalsozialismus wieder der SPD bei, war als deren Referentin tätig und begründete die Jugendorganisation „Die Falken" mit. Seit 1948 arbeitete sie als Frauenreferentin der Gewerkschaft „Kunst". Neben ihren gewerkschaftlichen Aktivitäten betätigte sich Olga Brandt-Knack vom 30.10.1946 bis 1953 als Abgeordnete in der Hamburgischen Bürgerschaft mit dem Schwerpunkt „Soziales". Außerdem war sie bis 1961 Deputierte der Polizeibehörde. 1962 legte sie alle Ämter nieder.
Nach Olga Brandt-Knack wurde 2018 im Stadtteil Rothenburgsort die Olga-Brandt-Knack-Straße benannt.
Text: Rita Bake
Zitate:
[1] Rudolf Maack: Tanz in Hamburg. Hamburg 1975.
[2] Olga Brandt-Knack: Die Umgestaltung des Opernballetts. In: Bühnenalmanach. Hamburg und Altona 1926, S. 29-31.
[3] Hans Wölffer: Tanzgruppe Olga Brandt-Knack. In: Bühnenalmanach. Hamburg und Altona 1926, S. 32-34.
[4] Ansprache von Prof. Dr. med. A.V. Knack beim Amtsantritt als Präsident der Hamburgischen Gesundheitsbehörde am 20. April 1949. (unveröffentlichtes Manuskript)
Anny Breer
Porträtfotografin


Eine von der Fotografien Anny Breer gemachte Porträtaufnahme

27.10.1891
Hamburg
–
21.7.1969
Hamburg
Hamburg
–
21.7.1969
Hamburg
Mehr erfahren
Anny Breer wurde unter den Namen Agnes Else Breer am 27.Oktober 1891 als Tochter des 1. Schiffsvermessungsinspekteurs Theodor Wilhelm Breer und seiner zweiten Frau Agathe geboren, die er 1891 geheiratet hatte. Breers erste Frau und Mutter ihrer gemeinsamen fünf Kinder war etwa zwei Jahre zuvor verstorben.
Anny Breer schreibt über die Folgen dieser Ehe für ihre Mutter "Mit der Heirat begann dann ihr langes, qualvolles und einsame Leben…"
Über ihr Verhältnis zu Vater und Stiefgeschwister schreibt sie: "Als ich in der zweiten Ehe meines Vaters in Hamburg geboren wurde, stand meine Geburt schon unter so ungünstigen Aspekten, die mein ganzes weiteres Leben gekennzeichnet haben…" Damit
meinte sie u. a. die totale Ablehnung ihrer Mutter durch die Kinder aus erster Ehe, damals zwischen 14 und 9 Jahre älter als Anny Breer, und die notorische eheliche Untreue des Ehemanns. Auch sie hat unter den Launen und der Ablehnung ihres Vaters und den Kindern aus erster Ehe stark zu leiden.
1912 trifft Anny Breer auf ihre erste Liebe, einen 22 jährigen Pianisten, der ihr Klavierunterricht gibt. Er ist der Gegenentwurf zu ihrem Vater. Kein Wunder, dass sie sich schwärmerisch in ihn verliebt. Gegen den Willen des Vaters verloben sich die beiden im Februar 1915, mitten im Ersten Weltkrieg. Am selben Tag erleidet Theodor Breer einen Schlaganfall und stirbt wenige Tage später. Anny Breer fühlt sich "vom Tyrann befreit", doch der nächste Schicksalsschlag lässt nicht lange auf sich warten. Ihr Verlobter, Carl Rettbach, wird eingezogen und fällt am 26. November 1915 an der Ostfront.
Breers Vater war bei seinem Tod so hoch verschuldet, dass zur Abfindung der Gläubiger die Villa in der Fruchtallee 38 verkauft werden muss. Um finanziell über die Runden zu kommen, muss Anny Breer Arbeit annehmen und findet eine Stelle in der Militärverwaltung in Altona.
Dort tritt ein neuer Mann in ihr Leben. Er ist deutlich älter, ein jüdischer Reserveoffizier und im Zivilberuf Jurist. Später wird er von den Nazis deportiert und ermordet. Er sieht in ihr einen "Augenmenschen" und rät ihr zur Fotografie als Beruf. Über die Witwe von Ernst Juhl, einer Bekannten ihres Verlobten, lernt sie Minya Dührkoop kennen. Ernst Juhl war der Mitstreiter des Hamburger Kunsthallen-Direktors Alfred Lichtwark. Beide waren bemüht, die gewerbliche Fotografie ästhetisch zu reformieren. Als Fotosammler war Juhl mit vielen damals weltbekannten FotografInnen bekannt. Minya Dührkoop gehört mit ihrem Vater Rudolf zu diesem Kreis. Zu ihrem Kundenstamm gehören Kaiser und Präsidenten, hohe Militärs und berühmte bildende Künstler, Musiker und Schauspieler. Mit dem Atelier Bieber aus Hamburg und wenigen anderen im Deutschen Reich wetteifern sie um das Prädikat "bekanntestes Atelier Deutschlands." Anny Breer beginnt im Hamburger Atelier Dührkoop als unbezahlte Volontärin und bekommt innerhalb von zwei Monaten Gehalt, weil sie ihre Arbeit hervorragend erledigt. Als zeichnerisch sehr begabt, fällt ihr im Atelier Retusche zu, also die zeichnerische Manipulation der Fotonegative und der Papierabzüge. Aufgrund einer Neurodermitis muss sie ihre Arbeit aufgeben und begibt sich 1917 zur Therapie in ein Krankenhaus. Eine Rückkehr ins Atelier Dührkoop ist aufgrund der geschäftlichen Situation nicht möglich. Wahrscheinlich durch die Vermittlung von Minya Dührkoop, hat sie aber nun die Möglichkeit von deren Bekannten und Konkurrentin Emma Wiemann zu lernen. Anny Breer schreibt "Die künstlerische Auffassung ihrer Porträts hatte mich schon immer begeistert."
Dabei hat sich die junge Witwe selbst erst im August 1915 in Hamburg selbständig gemacht und ist nur knapp vier Jahre älter als Anny Breer, die hier erstmalig die Möglichkeit bekommt, Porträts als sogenannte Operateurin selbst zu verantworten. Sie ist mit sich zufrieden. Die Porträts sind: "alle gleich intuitiv erfasst … und im richtigen Blick für Aufbau, Beleuchtung und Komposition... Immer mehr spürte ich, dass dieser Beruf mein Schicksal wurde und ich eine Berufung dafür hatte."
Was Anny Breer nach ihrer Zeit als Volontärin bei Wiemann zwischen Sept. 1918 und Sept. 1922 getan hat, muss vorerst offen bleiben. Nach eigenen Angaben ist sie ab September 1918 ein paar Monate im Atelier Bieber tätig, wird dort aber nicht glücklich. 1922 macht sie sich inoffiziell selbständig. In der Villa ihrer Halbschwester in der Brahmsallee funktioniert sie das ehemalige Kinderzimmer zum Atelier um. Die ersten Kunden nimmt sie mit einer geliehenen 18x24cm Atelierkamera auf, die Negative und die Abzüge entwickelt sie in einem Mietlabor für Amateurfotografen. Mit der Erteilung eines Gewerbescheins macht sie sich dann in eigenen Räumlichkeiten in der Lübeckerstraße 78 im September 1922 offiziell selbständig. Fünf Jahre baut sie sich einen Kundenstamm auf. Erste Porträts erscheinen in der Fotobeilage des Hamburger Fremdenblattes. 1927 engagiert sie das Deutsche Schauspielhaus, um Bühnenaufnahmen und Rollenporträts anzufertigen. So entstehen Fotos von der Uraufführung von Erich Wolfgang Korngolds "Das Wunder der Heliane" und SchauspielerInnenporträts u. a. von Maria Eis. Diese werden in "Der Kreis. Zeitschrift für künstlerische Kultur" veröffentlicht, eine Publikation mit Schwerpunkt auf dem Hamburger Bühnengeschehen. Aber auch Musik, bildende Kunst, Tanz und Architektur werden von Autoren wie Hans Leip, Hans Henny Jahn, Max Beckmann und anderen unter avantgardistischer Perspektive diskutiert, bis die Zeitschrift 1933 verboten wird.
Um sich geschäftlich breiter aufzustellen, bemüht sich Anny Breer erfolgreich um Aufträge im Bereich der Sach- und Architekturfotografie. 1927 fotografiert sie ausgiebig und mit fachlichen Können die neuen Glocken der St. Nikolai-Kirche. 1929 begleitet sie den Um- und Erweiterungsbau des katholischen Marienkrankenhauses in Hohenfelde. In einer 1929 anlässlich der Fertigstellung des Krankenhauses publizierten Veröffentlichung erscheinen 74 Fotografien Anny Breers, die sämtliche Gebäude des Krankenhauses von innen und außen zeigen. Dazu die Bildnisse sämtlicher Oberärzte. An ihnen zeigt sich beispielhaft Breers fotografische Herangehensweise. Sie gibt nach dem Krieg zu Protokoll: "Wenn eine Bildnisphotographie…ein Photogramm der Persönlichkeit werden soll, und kein Zufallstreffer, …so läßt sich das Wesentliche eines Menschen nur erfassen, wenn das ICH des Photographen zurücktritt."
Die Oberärzte werden von ihr vor einen dunklen Hintergrund platziert. Ein Lichtakzent im oberen linken Quadranten vermeidet den Eindruck zu starker Eintönigkeit des Hintergrundes und dynamisiert das Bild. Mal kommt das Licht von rechts, mal von links. Die Herren sitzen im Viertelprofil, leicht eingedreht, oft etwas diagonal im Bild positioniert. Per Kadrage entstehen Brust- oder Hüftbilder. Die Gesichtsausdrücke reichen von müde über nachdenklich bis hin zu aufmerksam und konzentriert. Durch diesen Einsatz ästhetischer Gestaltungsmittel gelingt es ihr, die beruflich homogene Gruppe der Oberärzte trotzdem als Individuen in ihrer je eigenen charakterlichen Verfasstheit darzustellen. Im Gegensatz dazu fotografiert sie die Räumlichkeiten menschenleer, klinisch rein, funktional.
Auch Paul Frank, als Hamburger Protagonist des Neuen Bauens verantwortlich für die Laubenganghäuser in der Jarrestadt und am Dulsberg, beauftragt sie, letzteres fotografisch zu dokumentieren. Sie passt ihren Stil der neuen sachlichen Bauform an, da sie auch hier, wie bei den Porträts, das eigene Ich in den Dienst der Sache stellt und versucht auch hier den Charakter des Gebäudes bildmäßig zu erfassen.
Vielleicht dadurch für die Lebensumstände der weniger vermögenden Bevölkerungsschichten sensibilisiert, nimmt sie 1930/31 einen Auftrag vom "roten Grafen" Alexander Stenbock-Fermor für sein Buch "Deutschland von unten" an, in dem er die sozialen Verhältnisse anprangert. Eine Hamburger Arbeiterfamilie sitzt auf Breers Foto rund um den Küchentisch in einer alten, heruntergekommenen Wohnung. Ein Bild, das genau die Verhältnisse zeigt, die zu ändern sich der Autor des Buches und die Architekten des Neuen Bauens auf die Fahnen geschrieben haben.
Mittlerweile sind gut 10 Jahre seit dem Beginn ihrer Selbstständigkeit vergangen. Die Zeiten, in denen das Kinderzimmer als behelfsmäßiges Atelier herhalten muss, sind Geschichte. Stattdessen kann sie nun, im April 1933, mit vier MitarbeiterInnen mit ihrem Atelier an den Neuen Wall Nr. 2, Ecke Jungfernstieg, umziehen. Anny Breer hat die Räume von Hans Leip übernommen und bleibt dort bis zur völligen Ausbombung im Juli 1943. In den Jahren dazwischen beginnt sich ihr Ruf über die Grenzen Hamburgs auszubreiten. Seit mindestens 1927 stellt sie aus. So bei "Frauenschaffen des 20. Jahrhunderts" in Hamburg neben Paula Modersohn-Becker und Käthe Kollwitz und ihrer ehemaligen Lehrerin Minya Dührkoop. 1929 stellt sie in der Altonaer Kunstausstellung neben den FotografInnen der Neuen Sachlichkeit und des Neuen Sehens wie Renger-Patzsch, Herbert und Irene Bayer, Aenne Biermann, Hans Finsler, und den Geschwistern Leistikow aus, ohne sich jedoch in ihrem Stil durchgehend dem Neuen Sehen oder der Neuen Sachlichkeit verpflichtet zu fühlen. 1932 und 1933 zeigt sie Fotos neben den lokalen aber überregional bekannten FotografInnen Olga Linckelmann und Lotte Genzsch. 1936 stellt sie in den Räumen des Werkbundes an der Rothenbaumchaussee aus und veranstaltet selbst Atelierausstellungen und Künstlerfeste in ihrem neuen Atelier. 1938 erzählt sie im Rahmen der Rundfunksendung "Schaffende Frauen in Hamburg", wie sie zur Fotografie kam.
Durch die totale Zerstörung von Wohnung und Atelier 1943, die sie überlebt, weil sie zu der Zeit zur Kur in Marienbad weilt, ist sie erneut mit Existenzängsten konfrontiert. Als Notlösung zieht sie wieder in die Brahmsallee zu ihrer Stiefschwester. Erst 1946 findet sie neue Räume in einem teilzerstörten Gebäude am Speersort 8. Die Mühen der Reparaturen, die Existenzängste, eine Krankheit, verzögern die Ateliereröffnung bis zum 15.11.1947 in Mitten einer Trümmerlandschaft. Als ihr Erspartes 1948 durch die Währungsreform vernichtet wird, ist sie verzweifelt. Aber eine Ausstellung ihrer Fotos 1948 unter dem Titel "Köpfe aus dem kulturellen Leben Hamburgs " und Kredite helfen über das Ärgste hinweg, bis sie sich wieder gefangen hat. 1954 wird die letzte Baulücke am Ballindamm 35 geschlossen. Sie bekommt die Möglichkeit dort ein Atelier einzurichten. Zurück an der Alster, in ihrem Wohn- und Fotoatelier wird sie nun noch 14 Jahre ihrem Beruf nachgehen. Auf der "Bildausstellung deutscher Berufsfotografen" 1955 bekommt sie eine Ehrenurkunde für ihren Beitrag. Sie hat keine Altersversicherung und muss daher bis ein Jahr vor ihrem Tod arbeiten. Ihr Alter verschweigt sie, aus Furcht, es könnte geschäftsschädigend wirken. Aber die Kundschaft bleibt ihr treu. Neben der Hamburger Prominenz aus Kunst, Politik und Wirtschaft fotografiert sie nationale Bekanntheiten wie Marie Luise Kaschnitz und Werner Finck und Weltstars wie José Ortega y Gasset und Pierre Boulez. Ihre Assistentin, Waltraut Frisch, übernimmt das Atelier, als Anny Breer 1968 in den Ruhestand geht.
Breer schreibt an Fritz Kempe wenige Monate vor ihrem Tod:
"Das Leben ist nach meiner heutigen Erfahrung und im Rückblick auf alles Mühen absurd, nur auf den Tod hingelebt. Aber wenn der Mensch sich ganz auf sich selbst stellt, in eigener Verantwortung und im vollen Bewusstsein, dass er zuletzt doch allein ist, kann er daraus eine Kraft entwickeln, die ihm Widerstand verleiht." Widerstand auch gegen eine berufliche Konkurrenz, die über ihr 40 jähriges Berufsleben in kaum einer anderen Stadt, abgesehen vielleicht von Berlin und München, so hart ist wie in Hamburg.
Anny Breer stirbt an dem Tag, an dem mit Neil Armstrong zum ersten Mal ein Mensch seinen Fuß auf den Mond setzt, am 21. Juli 1969.
Text: Klaas Dierks
Dorothea Christiansen
Hamburgs erste Schulrätin


22.8.1882
Hamburg
–
11.5.1967
Hamburg
Hamburg
–
11.5.1967
Hamburg
Mehr erfahren
Die in der Curschmannstraße 27 wohnende Dorothea Christiansen schlug eine typische Lehrerinnenlaufbahn ein. Ausgebildet wurde sie am Hamburger Lehrerinnen-Seminar und unterrichtete von 1901 bis 1923 an der Volksschule für Mädchen in der Methfesselstraße 28.
Als es ab 1919 den Lehrern und Lehrerinnen durch die Schulreform möglich wurde, eine Selbstverwaltung einzurichten, (d. h. gemeinsam mit dem Elternrat konnte das Kollegium aus seinen Reihen eine Schulleitung wählen), fiel die Wahl in der Schule Methfesselstraße auf eine Frau, was ein Novum darstellte. Dorothea Christiansen wurde 1919 die neue Schulleiterin.
Sie engagierte sich in den folgenden Jahren besonders in der Schulreform und zwar so erfolgreich, dass die Schulbehörde sie 1923 zur Schulrätin ernannte. 10 Jahre - von 1923 bis 1933 - war Dorothea Christiansen als Schulrätin tätig. Die Autorin vieler Hamburgensien, Henny Wiepking, schrieb in einer kurzen Abhandlung über Dorothea Christiansen: "Nach außen wurde ihr Name wenig genannt, als sie diese gehobene Stellung innehatte. So bewährte sich für ihre Freunde die Lebenserfahrung: Das sind die besten Frauen, über die nicht viel geredet wird. Im Verkehr mit ihr, spürte man ihre innige Anteilnahme an alle an sie herangetragenen Nöte. In keinem Fall, wo sie um Rat und Hilfe angerufen wurde, versagte sie. In allen ihren Handlungen lebte der soziale Geist, der Geist der Menschenliebe, der Geist der Menschenwürde. So genoss sie bei ihren Kollegen und Kolleginnen ein hohes Vertrauen."
Während ihrer Tätigkeit als Schulrätin gab es viele Neuerungen in Hamburgs Schulwesen: So wurde z. B. die vierjährige Grundschule für alle Kinder eingerichtet, das Gesetz über die Einheitsschule erlassen, in 50 Volksschulen der Fremdsprachenunterricht eingeführt und die Abschaffung des Schulgeldes und der Lehrmittelbeiträge beschlossen.
Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, wurde Dorothea Christiansen wegen "politischer Unzuverlässigkeit" zwangspensioniert.
Dorothea Christiansen kümmerte sich um einsame Menschen, kinderreiche Familien. Ihre Devise lautete: "Sparen, für wen? Mit warmer Hand weggeben, ist mein Grundsatz."
Quelle:
Henny Wiepking: Frau Dorothea Christiansen. (Staatsarchiv Hamburg. Zeitungsausschnittsammlung)
Hildegard (Hilde) Claassen
geb. Brüggemann
Leiterin des Claassen Verlages



21.4.1897
Linnich
–
16.2.1988
Linnich
–
16.2.1988
Mehr erfahren
Ihr Grabstein steht im Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof
Hildegard Brüggemann entstammte einem Pastorenhaushalt. Von 1913 bis 1916 besuchte sie ein Gymnasium in Aachen; von 1916 bis 1920 studierte sie Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte an der Universität München. 1920 erfolgte die Promotion.
Hildegard Brüggemann war Mitbegründerin der Kunstgalerie Franz M. Zatzenstein/Matthiesen, "deren Inhaber 1934 nach London emigrierten".
Bis zu ihrer Eheschließung mit Eugen Claassen arbeitete sie in München und Berlin an Ausstellungen über Daumier und Toulouse-Lautrec mit." 1) 1925 zog Hildegard Brüggemann nach Frankfurt a. M. und heiratete 1926 Eugen Claassen, den Leiter des dortigen Societäts-Verlages. Kennengelernt hatten sich die beiden im "Bund freier Menschen" um Oskar Maria Graf, als Hildegard Brüggemann noch studierte und damals mit den Schriftstellerinnen Regina Ullmann und Hertha König zusammenwohnte. Über seine Freundin erhielt Eugen Claassen auch Kontakt zu Nolde, Kirchner und George Grosz.
Ein Jahr nach der Hochzeit wurde die Tochter Judith geboren.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde die Möglichkeit einer Emigration aus Deutschland diskutiert. "Ausschlaggebend für die Entscheidung des Ehepaares gegen die Emigration aber wird gewesen sein, daß Claassen, wie auch Hilde Claassen in ihren Erinnerungen notiert, die unter Intellektuellen sogar in Exilkreisen noch im Frühjahr und Sommer 1934 weitverbreitete optimistische Fehleinschätzung teilte, daß, ‚alles bald vorüber' sein würde." 2)
1934 gründeten H. Goverts und Eugen Claassen den Claassen Verlag. Die erste Verlagsadresse war die Hamburger Alte Rabenstraße 12: die Privatwohnung von Goverts.
Zur Verlagsgründung kam es, weil sich Eugen Claassen wie auch Henry Goverts: "nach 1933 in ihrer Arbeit stark eingeschränkt gesehen [hatten]; Goverts verlor seine Lehrerlaubnis an der Universität, Claassen konnte im Frankfurter Societäts-Verlag nicht mehr die Bücher herausbringen, die seiner liberalen Haltung entsprochen hätten. Die Gründung des eigenen Verlages war eine Art Flucht nach vorn ? Goverts sorgte für die finanziellen Voraussetzungen, Claassen für die nötige Verlagserfahrung, (…).3)
Hildegard Claassen war von der Idee einer Verlagsgründung anfangs nicht begeistert. Darüber schrieb sie 1972 "in einem Geburtstagsbrief an Henry Govers: '(…) als Du uns im Frühjahr 1934 in Frankfurt besuchtest, da bezogen sich unsere Gespräche alle auf ein einziges Thema: den Verlag, den Du mit Eugen gründen wolltest, und der in Hamburg seinen Sitz haben sollte. Ich weiß noch genau, wie erschrocken ich im Anfang über diesen Plan war, denn er durchkreuzte unseren Wunsch, aus Deutschland fortzugehen. Damals während eines Spazierganges über die Ginnsheimer Höhe, erzählte ich Dir, daß ich gerne wieder die Leitung einer Bildergalerie übernähme, ‚meiner' Galerie, wie Eugen sie immer genannt hat, die in London eine Filiale eröffnen wollte. Aber Du meintest, Hamburg sei immer noch imstande, es mit London aufzunehmen.'" 4)
Der Verlag wurde gegründet. "Gemeinsam suchten sie [die Verleger] einen Weg, ihrer politischen Haltung durch die Literatur Nachdruck zu verleihen, vermieden die Veröffentlichung nationalsozialistischer Autorinnen und Autoren, förderten junge und hielten Kontakt zu emigrierten Schriftstellern. Ein erster Bestseller gelang dem Haus 1937 mit der deutschen Ausgabe von Margaret Mitchells ‚Vom Winde verweht'. Bis zum Juli 1941 war das Buch 276.900 mal verkauft und finanzierte so das stetig wachsende Literaturprogramm, zu dem unter anderem Marie Luise Kaschnitz, Heinrich Mann, Elisabeth Langgässer, Elias Canetti, Erich Fried, Irmgard Keun und Marlen Haushofer gehören sollten. Auch das Werk Hermann Melvilles wurde hier für die deutsche Leserschaft entdeckt, nicht anders die Bücher von Evelyn Waugh, Cesare Pavese und Pablo Neruda.
Nach dem Krieg bekam der Verlag deshalb als einer der ersten von der Britischen Besatzungsmacht die Lizenz, sich unter der Firmierung Claassen & Goverts neu zu gründen. Bis sich die beiden Gründer 1947 trennten und Claassen seinen Verlag bis zu seinem Tod 1955 allein weiterführte." 5)
Zurück zu Hildegard Claassen: Im April 1936 zog sie mit ihrer Tochter nach Hamburg - ihr Mann war bereits ein Jahr zuvor dorthin gezogen. Die Claassens wohnten damals in der Körnerstraße 21, der Verlag befand sich nun in der Moorweidenstraße 14.
Hildegard Claassen wurde die engste Mitarbeiterin ihres Mannes. In den ersten Jahren des Bestehens des Verlages hatte sie entscheidend bei der Auswahl deutschsprachiger sowie englisch- und französischsprachiger Romanmanuskripte mitentschieden. Eugen Claassen verließ sich auf das Urteil seiner Frau. Lehnte sie ein Manuskript ab, dann wurde das Manuskript nicht angenommen. 6)
In der NS-Zeit war Hilde Claassen von 1936-1945 Mitglied der NSV (nationalsozialistische Volkswohlfahrt) und von 1940-1945 im Luftschutz. 7)
Nach dem Tod ihres Mannes im Jahre 1955 führte Hildegard Claassen den Verlag allein weiter. Dazu äußerte sie: "Für die Nachfolgerin [von Eugen Claassen] war es eine Selbstverständlichkeit, alles zu tun, um die vorgezeichneten Linien des Verlagsgesichts im Geist des Begründers weiterzuführen. Das sollte aber nicht heißen, daß ängstlich am Überkommenen festgehalten werden mußte, denn immer wieder machte ich die Erfahrung, daß ein Buch seine volle Wirksamkeit erst in einem bestimmten Zusammenhang, wie er etwa von den Zeitumständen oder den Strömungen in der Literatur bestimmt wird, zu entfalten vermag …
Der Hauptakzent lag auf der zeitgenössischen deutschen Literatur. Der Verlag brachte Prosa von Christian Geißler, Geno Hartlaub, Gustav Schenk, Thomas Valentin, Prosa und Lyrik von Marie Luise Kaschnitz, Lyrik von Cyrus Atabai, Erich Fried, Walter Helmut Fritz, Peter Jokostra, Urs Oberlin, Johannes Poethen. Besonders hingewiesen sei auf die Bücher von Ernst Weiß, die lange Zeit verschollen waren, und auf die großen Werksausgaben von Elisabeth Langgässer und Karl Wolfskehl und auch auf die Gesamtausgabe von Heinrich Mann, die als Lizenzausgabe vom Aufbau Verlag übernommen wurde. (…)." 8)
Das Verlagsgeschäft war in den 1960er ziemlich schwierig. "Mancherlei Überlegungen und Verhandlungen in den Jahren 1965 und 1966 galten darum der Zukunft des Verlages, für den Hilde Claassen auch ihres Alters wegen nicht länger allein die Verantwortung tragen wollte." 9) 1967 verkaufte Hildegard Claassen den Verlag an die Econ Verlagsgruppe, in der der Claassen Verlag unter seinem Namen fortbestand und Hildegard Claassen als Cheflektorin im Verlag tätig blieb. "Das Lektorat blieb deshalb noch bis 1972 in Hamburg. In dieser Zeit hat Hilde Claassen aus der historischen Verlagskorrespondenz die Briefwechsel ihres Mannes mit Autoren und Übersetzern ausgewählt, die dann zusammen mit seinen Aufsätzen 1970 zum 75. Geburtstag Eugen Claassens erschienen." 10)
Hildegard Claassen erhielt 1967 das Verdienstkreuz 1. Klasse.
"Seit 2004 gehörte Claassen zur Verlagsgruppe Ullstein Buchverlage, die es in der heutigen Zusammensetzung seither gibt. 2009 wurde dann das Programm von Claassen stillgelegt, (…), um das literarische Profil von Ullstein zu schärfen, Ullstein stärker für Literatur zu öffnen. Über zehn Jahre später wird das Imprint nun wieder belebt." 11)
Text: Rita Bake
Quellen:
1) Anne-M. Wallrath-Janssen: Der Verlag H. Goverts im Dritten Reich. München 2007, S. 23, Fußnote 17. (Archiv für Geschichte des Buchwesens, Studien 5.)
2) Anne-M. Wallrath-Janssen, a. a-. O., S. 40.
3) Börsenblatt des deutschen Buchhandels 27. September 2019, unter: https://www.boersenblatt.net/2019-09-27-artikel-ullstein_laesst_claassen_wieder_aufleben-erstes_programm_im_fruehjahr_2020.1733468.html
4) Eugen Claassen. Von der Arbeit eines Verlegers. Bearbeitet von Reinhard Taghrt unter Mitarbeit von Huguette Hermann, Gudrun Karlewski und Monika Waldmüller, in Marbacher Magazin, 19/1981.
5) Börsenblatt des deutschen Buchhandels, a. a. O.
6) Vgl.: Anne-M. Wallrath-Janssen, a. a. O., S. 102.
7) Staatsarchiv Hamburg, 221-11_74575
8) Hilde Claassen in dem Aufsatz: "Geschichte des Claassen Verlages" 1969. Zit. aus: Proben und Berichte. Ein Almanach zum fünfzigjährigen Bestehen des Verlages. 1934-1984.
9) Anne-M. Wallrath-Janssen, a. a. O. S. 27.
10) Marbacher Magazin, a. a. O., S. 30.
11) Börsenblatt des deutschen Buchhandels, a. a. O.
Molly und Helene Cramer
Malerinnen




25.6.1852
Hamburg
–
18.1.1936
Hamburg
13.12.1844
Hamburg
–
14.4.1916
Hamburg
Hamburg
–
18.1.1936
Hamburg
13.12.1844
Hamburg
–
14.4.1916
Hamburg
Mehr erfahren
Erst nach dem Tod ihres Vaters, des vermögenden Kaufmanns Cesar Cramer, konnten sich die beiden Schwestern Helene und Molly Cramer ihren Lebenstraum erfüllen und ihre Ausbildung als Malerinnen beginnen, denn der Vater war stets gegen diesen Beruf gewesen. So begannen die Schwestern 1883, ein Jahr nach dem Tod des Vaters, mit ihrer Ausbildung. Damals war Helene bereits 39 und Molly 31 Jahre alt.
Da in der damaligen Zeit eine Berufsausübung für bürgerliche Frauen noch als Ausnahme galt, und künstlerisch veranlagte Frauen des Bürgertums ihr Können meist nur dilettantisch ausübten, nicht aber als Beruf, waren die Schwestern Molly und Helene Cramer eine Ausnahme. Sie „wollten ihre Kunst nicht dilettantisch betreiben, sie wollten leisten, was sich erreichen lässt, und mit großer Energie sind sie an ihre Studien gegangen und haben ihre Kunst immer von diesem Gesichtspunkt betrachtet“, schrieb die Frauenrechtlerin und Schriftleiterin der Zeitschrift Frau und Gegenwart, Frieda Radel (ein Erinnerungsstein steht im garten der Frauen) im Hamburgischen Correspondenten vom 13. September 1904.
Helene lernte in Hamburg bei Carl Oesterley - ein in Hamburgs gutbürgerlichen Kreisen geschätzter Landschaftsmaler - und bei Carl Rodeck, der bekannt war für seine Darstellungen von Hafen und Stadt. Molly begann ihre künstlerische Ausbildung bei dem bekannten Zeichner Alt-Hamburger Szenen, Theobald Riefesell und den Malern Hinrich Wrage und Carl Rodeck.
Ab 1886 begann Helene Cramer ihre Bilder in ganz Deutschland und im Ausland auszustellen. Ihre Schwester tat dies deutschlandweit ab 1888.
Daneben bildeten sich die Schwestern weiter: Helene setzte ihre Studien 1887 in Den Haag bei Marguerite Roosenboom fort, die damals die bedeutendste holländische Blumenmalerin war. Um 1890 ging Helene mit ihrer Schwester Molly nach Antwerpen und lernte bei Eugène Joors Blumenstillleben unter Einfluss der alten holländischen Schule.
Dieses Thema verfolgten die Schwestern konsequent weiter. Damit trafen sie den Geschmack des damaligen Direktors der Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwark. 1895 erwarb er sogar für die von ihm begründete „Sammlung von Bildern aus Hamburg“, die die Entfaltung einer modernen Hamburgischen Kunst befördern sollte, für die Hamburger Kunsthalle je ein Blumenstillleben von Helene und Molly Cramer. Dazu schrieb er an die ‚Commission für die Verwaltung der Kunsthalle’: „Der Ankauf der Blumenstücke von Frl. Molly und Helene Cramer durch die Kunsthalle hat mich so herzlich gefreut (...). Einmal war es mir eine Genugthuung für die beiden Damen, die es mit der Kunst so ernst nehmen, wie wenige, die sich auf ein Gebiet, das dem Talente der Frau vor Allem zusagt, weise beschränkt haben, die jetzt in Deutschland die ersten in ihrem Fache sind, und die in Hamburg ihrem Werthe nach nicht anerkannt werden“ 1).
Helene Cramer zeigte in ihren späteren Werken auch impressionistische Tendenzen. Auch Molly beschäftigte sich mit dem Impressionismus und erweiterte ihr Können auch auf Landschafts- und Portraitmalerei.
1892/93 wurden die Schwestern Mitglieder im Verein der Berliner Künstlerinnen. Zwei Jahre später begannen sie in ihrem Elternhaus auf der Uhlenhorst, Karlstraße 18 gesellige Kulturabende und Diskussionsrunden zu veranstalten.
1895 fuhren die Schwestern mit Arthur Illies und Ernst Eitner zur Großen Kunstausstellung nach Paris. Danach folgten mehrere Auslandsaufenthalte in Paris und London.
Molly und Helene Cramer konnten es sich finanziell leisten, Ernst Eitner zu fördern und ihm auch die gemeinsame Reise zur Kunstausstellung nach Paris zu ermöglichen. Daneben wurden die Schwestern ab 1897 zu Gönnerinnen des „Hamburgischen Künstlerclubs von 1897“, in dem u.a. Arthur Illies und Ernst Eitner Mitglied waren und der ein Zusammenschluss der damaligen jungen Künstler Hamburgs war. Eine Mitgliedschaft lehnten die Schwestern jedoch ab, beteiligten sich aber mit ihren Werken an den Ausstellungen des Künstlerclubs. Mitglied wurden sie hingegen im Jahre 1900 in der Münchener Künstlergenossenschaft.
Der Hamburger Kunstverein verloste 1895 Molly Cramers Pastell „Austernschalen“ und 1903 ihr Bild „Primeln“. Helenes Bild „Rosen“ wurde 1900 im Hamburger Kunstverein verlost, und ihr Werk „Primeln“ kam 1911 in die Weihnachtsverlosung des Hamburger Kunstvereins.
Molly Cramer schenkte 1916 der Hamburger Kunsthalle 500 Mark, so dass damit der Ankauf eines Aquarells von Max Slevogt ermöglicht wurde.
„Das künstlerische Ziel von Helene und Molly Cramer war ‘nicht etwa niedliche Damenmalerei’. Alfred Lichtwarks Vision eines heimatverbundenen Naturalismus’ als Grundlage einer neuen Kunst und ihr ungewöhnliches, emanzipiertes Selbstbewusstsein haben die Schwestern zu einer - heute vollkommen vergessenen - Ausnahme innerhalb der Hamburger Kunstgeschichte werden lassen (...)“ 1).
Vier Jahre nach dem Tod ihrer Schwester Helene trat Molly 1920 der Hamburgischen Künstlerschaft bei. Sie überlebte ihre Schwester Helene um 20 Jahre.
Text: Rita Bake
Zitate:
[1] Ulrich Luckhardt: „Eine ganz neue Welt öffnete sich dem Auge und dem Herzen“ - Die Hamburger Blumenmalerinnen Helene und Molly Cramer und ihr Förderer Alfred Lichtwark. In: Künstlerinnen der Avantgarde in Hamburg zwischen 1890 und 1933. Katalog zum ersten Teil der Ausstellung vom 21. Mai bis zum 20. August 2006 in der Hamburger Kunsthalle. Bd.1. Hamburg 2006, S. 13-21.
Minna Dittmer
geb. Heerwagen Pseudonyme: Margot Werner u. Marie D.
Schriftstellerin


18.10.1840
Wandsbek
–
17.8.1923
Hamburg
Wandsbek
–
17.8.1923
Hamburg
Mehr erfahren
Über Minna Dittmers Herkunft und Lebensgeschichte ist leider nichts zu ermitteln. Der Eigenverlag für einige ihrer Publikationen (so für das Werk "Durch Mitteilung zum Verständnis, durch Verständnis zur Zufriedenheit. Eine philosophische Skizze." Hamburg 1888) in Harvestehude sowie Themen und Stil ihrer Veröffentlichungen legen die Vermutung nahe, dass Minna Dittmer gebildeten, wohlhabenden gesellschaftlichen Kreisen angehörte und sich in der bürgerlichen Frauenbewegung engagierte.
In ihrem unter dem Pseudonym Margot Werner erschienenen Werk "Eine Zeitfrage in 5 Bildern", Hamburg ca. 1888, fasst sie in fünf dialogischen Szenen ihre Philosophie der bürgerlichen Frauenbewegung unter der Fragestellung
zusammen: "Schafft es sittlichen Nutzen, wenn das weibliche Geschlecht gewerbliche, künstlerische, wissenschaftliche Vorbildung - unter Umständen Ausbildung - genießt zum Zweck selbständigen Schaffens?" So bessert in der zweiten Szene eine begabte Pianistin die familiäre Haushaltskasse auf, indem sie Töchtern aus dem Freundeskreis Musikunterricht erteilt. Sie überzeugt ihren Gatten, der bis dahin eine Erwerbsarbeit seiner Frau als demütigend empfunden hatte, vom Sinn eines solchen Tuns in einer wirtschaftlichen Notlage. In der dritten Szene setzt die Freundin einer gutbürgerlichen Tochter das Studium der Zahntechnik (!) durch und macht sich selbstständig. Obendrein ist sie glückliche Ehefrau und Mutter. Nachdem der eitle Vater der gutbürgerlichen Tochter als Wirtschaftsbetrüger entlarvt wird, verlässt er die Familie. Seiner Tochter ist es nicht möglich, etwas zum Unterhalt der Familie beizutragen, weil der Vater ihr ein Studium und eine Erwerbsarbeit verboten hat. In der vierten Szene bessert eine Mutter als Schneiderin diskret das schmale Lehrergehalt ihres Ehemannes auf. Sie kleidet die fünfköpfige Familie ein und sorgt für ein schönes Wohnungsinterieur. Alle ihre Kinder, auch die Mädchen, erlernen Berufe: Retuscheurin, Kalligraphin, Buchhalterin, Schriftsetzer. Zur Silberhochzeit der Eltern ermöglichen ihnen die Kinder einen dringend benötigten Kuraufenthalt. Die fünfte Szene spielt in einer antiken Republik und zeigt einen fiktiven Dialog zwischen einer "Frau Doktorin" und der Frau eines Handwerkers.
Minna Dittmers 56 Seiten umfassendes Büchlein "Maria. Eine Legende", Hamburg 1887, ist "Seiner Durchlaucht, dem Fürsten Bismarck, in Bewunderung und Ehrfurcht zugeeignet". Zitat aus dem Epos: "Kampf ist Beruf des Mannes zur Lösung der Probleme. Problem des Weibes ist: Sich selber zu erkennen und Wunden mild zu heilen, was feindlich, zu versöhnen."
Minna Dittmer verfasste auch Gedichte, so "Naturkinder. Gedichte", Verlag v. J. F. Richter, Hamburg 1887, oder das Buch "Philo-Sophia oder Weisheitsliebe, Lebensweisheit. Ein Versuch, dem weiblichen Geschlechte die Lehren und Schriften der Philosophen Sokrates und Plato durch Kürze und Einfachheit mehr zugänglich zu machen und dessen Aufmerksamkeit auf die Schriften selbst hinzulenken." Stuttgart 1889.
Minna Froböse
(geb. Schierloh)
Stifterin: Ernst und Minna Froböse Stiftung


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

22.2.1848
Hamburg
–
8.7.1917
Hamburg
Hamburg
–
8.7.1917
Hamburg
Mehr erfahren
Minna Froböse war die Tochter des Weinhändlers Claus Schierloh und seiner Ehefrau Elise Gätgens und erlernte den Beruf einer Schirmmacherin. 1875 heiratete sie den Schirmfabrikanten Ernst August Froböse. Das kinderlose Ehepaar widmete sich wohltätigen Aufgaben. Ernst Froböse spendete große Summen seines Vermögens der Arbeitslosenfürsorge. Minna Froböse, die ihren Mann um drei Jahre überlebte und zuletzt am Holstenwall 20 wohnte, stellte einen großen Teil ihres Erbes für bedürftige Kriegsversehrte aus dem Ersten Weltkrieg und deren Familien als jährliche Mietbeihilfe zur Verfügung. Daraus entstand 1917 die „E. M. Froböse-Kriegs-Invaliden-Mietehilfe“. Die Idee zu dieser Beihilfe kam Minna Froböse, als sie sich zu Beginn des Ersten Weltkrieges um Soldatenkinder gekümmert und später Kriegsverletzte im Marinelazarett besucht hatte. In ihrem Testament, welches sich im Staatsarchiv Hamburg befindet, heißt es, sie wolle durch ihre Stiftung, „für die sorgen, welche zum Schutz des Vaterlandes ihr Leben und ihre Gesundheit eingesetzt und die Feinde von den Grenzen Deutschlands ferngehalten haben. Aus diesem Grunde habe ich mich entschlossen, schon jetzt, soweit es in meinen Kräften steht, für unsere Kriegsbeschädigten zu sorgen, und zwar habe ich es unternommen, aus den reichen Einkünften meines Vermögens das Leben solcher Tapferen dadurch zu erleichtern. (...) Ich bin überzeugt, dass mein Mann meine Gedanken und Absichten nicht nur billigen, sondern auch mit zu verwirklichen bestrebt sein würde. (...) Sollten im Laufe der Zeit die Kriegsbeschädigten ausgestorben sein, so sollen die Einkünfte des Stiftungsvermögens verwendet werden, um andere Krüppel beiderlei Geschlechts in ähnlicher Weise zu unterstützen." Heute unterstützt die Stiftung Menschen, die durch Krankheit in eine finanzielle Notlage geraten sind.
Text: Rita Bake
Eva Gaehtgens
verh. Bertels
Schriftstellerin



4.11.1872
Hamburg
–
31.1.1951
Hamburg
Hamburg
–
31.1.1951
Hamburg
Mehr erfahren
Eva Gaehtgens war die Tochter des Gutsverwalters und Kreischefs in Wenden (heute: Cesis) im Norden Lettlands, Johann Friedrich Gaehtgens, und seiner Frau Caroline, geb. Schilling. Die Familie mit ihren acht Kindern lebte in der Nähe vom legendären Schloss Stomersee im damaligen Livland bzw. Kurland.
Die romantische Seite ihrer Kindheit beschreibt die Schriftstellerin in ihren Büchern mit Erzählungen wie "Alt Livland. Heitere Bilder aus dem Baltikum" oder den Bänden "Großmutters Landgut" sowie "Winterleben". Anschaulich und idealisiert schildert sie die Innenwelt ihrer Kindheit, "als Livland dem sorglos spielenden Kinde glich, das mit jedermann gut Freund ist. Damals gab es keinen Druck von oben, keine Feindschaft nach unten. Die gute alte Zeit!"
Ihre autobiographischen Erinnerungen, in denen sie z. B. auch volkskundliche Skizzen von Festen im Jahreslauf beschreibt, beziehen sich auf die Zeit etwa zwischen 1885 und dem Ende des 19. Jahrhunderts.
Die Bücher wurden ab 1918 in der Agentur des Rauhen Hauses, dem Verlag des Rauhen Hauses, Hamburg, verlegt. Sie erschienen in einer Reihe von Publikationen, die der Verlag im Rahmen der "Inneren Mission" als pädagogische Literatur vertrieb.
1906 heiratete Eva Gaehtgens im Alter von 35 Jahren Julius Bertels. Nach der Hochzeit soll sie ihrem Mann an seinen Wohnort Rostow am Don gefolgt sein und ihn während der Ehe auf seinen Reisen durch das damalige Südrussland und Persien begleitet haben. Das Paar soll sechs Kinder gehabt haben.
Vor dem Ersten Weltkrieg lebte die Familie Bertels wieder in Wenden. Während des Krieges hielt sich Eva Bertels bei ihrem Schwager, Pastor Max Glage, in Hamburg auf, und zwischen 1918 und 1919 wieder in Wenden, wo sie die für sie traumatischen Revolutionsereignisse erlebte, die sie in der 1925 erschienenen Schrift "Unter dem roten Grauen" verarbeitete. Ihr Mann Julius Bertels wurde 1918 auf dem Gut seines Cousins von Bolschewiki ermordet.
Nach 1919 siedelte Eva Gaehtgens endgültig nach Hamburg über. Dorthin bestanden enge verwandtschaftliche Verbindungen: So wohnte nicht nur ihr Schwager in Hamburg, sondern auch ihr Cousin, der Dramatiker und Erzähler Hermann Gaehtgens.
Im Zweiten Weltkrieg wurde Eva Gaehtgens zweimal ausgebombt und lebte danach in Posen.
In ihrer hauptsächlich an Kinder gerichteten Hamburg-Literatur sparte sie den Zweiten Weltkrieg nicht aus. Sie beschrieb ihn tröstlich als soziales Ereignis, das den Vater von zu Hause wegnimmt bzw. verändert zurückkehren lässt.
In ihren Kinderbüchern beschreibt Eva Gaehtgens Eltern und Erwachsene stets als einfühlsam, verständnisvoll und nachsichtig belehrend. Ihre beispielhaften Erzählungen sollen Kinder etwa zu Fairness, Mut, Sparsamkeit und Frömmigkeit anhalten.
Eva Gaehtgens' Kinderbücher erlebten eine weite Verbreitung, worauf hohe Auflagen von 10.000 Exemplaren hindeuten.
Gabriela Giordano
Malerin


Gabi & Frieda, gemalt von Gabriela Giordano


27.1.1946
Hamburg
–
20.2.1998
Hamburg
Hamburg
–
20.2.1998
Hamburg
Mehr erfahren
Gabriela Giordano war das jüngste Kind der Klavierlehrerin Lilly Giordano, geb. Seligmann-Lehmkuhl (16.1.1897 Hamburg – 1.1.1980 Hamburg) und des Pianisten Alfons Giordano. Für Lilly Giordano, die mit Gabriela im Alter von 48 Jahren schwanger wurde, befindet sich ein Erinnerungsstein in der Erinnerungsspirale im Garten der Frauen.
Gabriela Giordano hatte noch drei Geschwister, unter ihnen der spätere Schriftsteller Ralph Giordano (1923-2014).
Die Familie lebte nach dem Krieg in einer Wohnung an der Elbchaussee und war damals antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. „Gegen verleumderische Handzettel mit der Aufschrift ‚Judenschweine raus!‘ strengte [die Familie Giordano] (…) eine Strafanzeige gegen Unbekannt an, die zu Ermittlungen bis ins Jahr 1954 führte, ohne dass Täter gefasst wurden (…).“1)
In den 1960er Jahren zog Gabriela Giordano mit ihren Eltern in die Hufnerstraße 118. 1972 starb der Vater. 1978 kam Gabriela Giordano in die Alsterdorfer Anstalten. Ein Jahr später zog ihre Mutter, nun 82 Jahre alt, in das nicht weit von den damals so genannten Alsterdorfer Anstalten entfernte Pflegeheim Alsterberg, wo sie am 1.1.1980 verstarb.
Nach dem Tod ihrer Mutter lebte Gabriela Giordano in den 1980er Jahren im Stadthaus Schlump, damals eine Außenstelle der Alsterdorfer Anstalten (heute evangelischen Stiftung Alsterdorf). Zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Frida war sie regelmäßiger Gast im Atelier der Schlumper, hatte sich aber als bildende Künstlerin nie solch einen Namen gemacht wie zum Beispiel Inge Wulff.
Zu ihrem berühmten Bruder Ralph Giordano hatte sie zu ihrem Bedauern kaum Kontakt. In seinem autobiographischen Roman „Die Bertinis“ erwähnt Ralph Giordano seine Schwester, die im Roman Kezia genannt wird, und lässt den Arzt, der bei der Geburt dabei gewesen war, sagen: „‘Ihre Schwester ist ein mongoloides Kind. (…) Es war vorauszusehen. Das Alter der Mutter, die Erlebnisse während der Schwangerschaft, die Jahre davor. (…). Dieses Kind hätte nie geboren werden dürfen.‘ (…). Vielleicht hättet ihr vergessen können, was hinter euch liegt. Aber mit diesem Kind – nie.‘ (…).
Mit der Geburt dieses Kindes war also keine neue Zeitrechnung in der Chronik der Sippe angebrochen, wie er [Roman Bertini] gehofft hatte in der Stunde der Eröffnung, daß Lea schwanger sei. Es war nichts mit der Erwartung, daß mit diesem Kind nicht nur ein Bertini-Sproß ohne Verfolgung und Angst, in Freiheit und Sicherheit aufwachsen würde, sondern dermaleinst auch den Unterschied kennte zwischen seinem Leben und der Nacht der Brüder, Eltern und Großeltern, deren Geschichte ihm dann nur mehr klänge wie eine ferne Sage.“2) Zum Schluss des Buches schreibt Ralph Giordano wen Roman Bertini, der sich mit dem Gedanken getragen hatte, auszuwandern, schlussendlich doch in Hamburg hielt: „Lea hielt ihn, seine standhafte, hilflose, unermüdliche und schwache Mutter. Und Alf hielt ihn, (…) wie konnte er den Vater verlassen? Und Kezia hielt ihn, seine Schwester, die nie wissen würde, wer ihre Brüder waren: Kezia Bertini, deren Umnachtung ihre Angehörigen immer an die Vergangenheit erinnern würde, und die in Roman die wunderbar tröstliche Gabe des Menschen auslöste, Hilflose mehr zu lieben.“3)
Quellen: 1. Peter Petersen: Lilly Giordano, in: Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit, Claudia Maurer Zenck, Peter Petersen (Hg.), Hamburg: Universität Hamburg, 2014 (www.lexm.uni-hamburg.de/object/lexm_lexmperson_00005725).
2) Ralph Giordano: Die Bertinis. Frankfurt a. M. 1982, S. 788f.
3) Ralph Giordano, a. a. O., S. 809.
Maria Wilhelmine Gleiss
Hamburgs erster praktische Ärztin und eine der ersten deutschen Ärztinnen


19.9.1865
Hamburg
–
5.2.1940
Hamburg
Hamburg
–
5.2.1940
Hamburg
Mehr erfahren
Maria Wilhelmine Gleiss war Hamburgs erste Ärztin und hatte ihre erste Praxis als niedergelassene praktische Ärztin ab 1904 am Holzdamm 19. Ab 1907 praktizierte sie bis zu ihrem Tod 1940 in der Papenhuderstraße 42.
Geboren wurde sie als Tochter des Pastors Karl Wilhelm Gleiss (1818-1889), der Stiftsprediger der Kapellengemeinde in St. Georg war und Oberlehrer an der Sonntagsschule St. Georg und somit mit Elise Averdieck zusammenarbeitete. Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters starb auch Maria Gleiss' Mutter. Damals war Maria Wilhelmine Gleiss 24 und 25 Jahre alt.
Maria Gleiss, die noch einen Bruder hatte, begann nach dem Besuch der höheren Töchterschule in Hamburg und des Lehrerinnenseminars in Callenburg/Sachsen, welches sie 1886 mit dem Lehrerinnenexamen abschloss, als Lehrerin und Erzieherin sowie 1892 während der Choleraepidemie in Hamburg als Krankenpflegerin zu arbeiten. Letztere Tätigkeit, die sie bei ihrer Großtante Elise Averdieck in deren Diakonissenhaus Bethesda durchführte, führte bei Maria Wilhelmine Gleiss zu dem Entschluss, Ärztin zu werden. Dazu musste sie zunächst einmal Abitur machen. Deshalb besuchte sie zwischen 1994 und 1896 die Gymnasialkurse bei Helene Lange in Berlin. In Februar 1897 machte sie ihr Abitur. Zwischen 1896 und 1897 studierte sie Medizin in Zürich, ab 1897 dann in Halle und absolvierte 1901 ihr Staatsexamen in Freiburg. Im selben Jahr promovierte sie in Straßburg.
Maria Wilhelmine Gleiss gehörte "zu den ersten sechs Frauen, die1901 die deutsche Approbation erlangt hatten".1). Von November 1901 bis Ende September 1902 war sie als Assistenzärztin am Hilda-Kinderspital in Freiburg i. Br. tätig und dann in selber Funktion an den Frauenkliniken in Straßburg und Wien bis sie sich 1903 als praktische Ärztin in Hamburg niederließ.2) "Bis 1908 blieb Maria Wilhelmine Gleiss die einzige Ärztin Hamburgs. 1910 hatte sie drei Kolleginnen und 1914 standen 15 Ärztinnen in Hamburg 1862 Ärzten gegenüber" 3), schreiben Andrea Brinckmann und Eva Brinkschulte in ihrem Aufsatz über die ersten Ärztinnen in Hamburg und am UKE. Und beide verdeutlichen, dass die Etablierung und Anerkennung der Frau als Ärztin nicht ohne Schwierigkeiten vonstattengingen. "Ab 1903 musste sie mehrmals gerichtlich gegen die Ehemänner ihrer Patientinnen vorgehen, weil sie eigenmächtig Honorare gekürzt hatten. Maria Gleiss betreute komplizierte Schwangerschaften, führte Entbindungen und ärztliche Nachbetreuungen durch. Eine angemessene Bezahlung der von ihr in Rechnung gestellten Leistungen stimmten die Teils wohlhabenden Männer mit verschiedenen Ausflüchten jedoch nicht zu. Konsequent erstritt Maria Gleiss sich vor dem Amtsgericht auch kleine Beträge." 4)
Maria Wilhelmine Gleiss' Spezialgebiet war die Frauen- und Kinderheilkunde. In ihrer Promotion hatte sie sich mit der "Verhütung fieberhafter Infektionen im Kindbett durch hygienische Maßnahmen" beschäftigt.
Ein Jahr vor ihrem Tod wurde sie 1939 Besitzerin des Kinderheims Heidenheim in Hausbruch. 5)
Maria Wilhelmine Gleiss war in den 1920er Jahren Vorsitzende der Ortsgruppe Hamburg des "Bundes deutscher Ärztinnen", außerdem war sie Mitglied des 1914 gegründeten "Verein Krankenhaus weiblicher Ärzte".
Maria Wilhelmine Gleiss war 1902 dem Hamburger Senat vom Verein "Frauenwohl" als Gefängnisärztin für die weiblichen Gefangenen der Strafanstalt Fuhlsbüttel vorgeschlagen worden. Und Maria Wilhelmine Gleiss wollte diese Aufgabe auch gerne übernehmen. Doch der Verein scheiterte beim Senat mit seinem Gesuch. Der Senat bestätigte (zwar], dass der Antrag wohlwollend geprüft werden solle, ohne dass je Taten folgten, somit Zwangsuntersuchungen weiblicher Strafgefangener weiterhin von männlichen Ärzten durchgeführt wurden." 6)
Bereits zwei Jahre zuvor war der Verein "Frauenwohl" aktiv geworden und hatte an die Gefängnis-Deputation "konkrete Forderungen nach einer Gefängnisärztin für alle Frauen (gestellt], an denen Zwangsuntersuchungen vorgenommen wurden. Der Senat befand, dass der Antrag einer Begründung entbehrte und ‚dass auf das Gesuch um Anstellung eines weiblichen Arztes nicht einzugehen sei.'" 7)
Quellen:
1) Andrea Brinckmann, Eva Brinkschulte: Die ersten Ärztinnen in Hamburg und am UKE, in: Spurensuche - erste Ärztinnen in Hamburg und am UKE. Hrsg. Von Eva Brinkschulte. Hamburg 2014, S. 20.
2) Vgl.: https://geschichte.charite.de/aeik/biografie.php?ID=AEIK00385
3) Andrea Brinckmann, Eva Brinkschule, a. a. O., S. 20.
4) Ebenda.
5) Vgl. https://geschichte.charite.de/aeik/biografie.php?ID=AEIK00385
6) Andrea Brinckmann, Eva Brinkschule, a. a. O., S.19f.
7) Ebenda.
Hanna Glinzer
Direktorin der Schule des Paulsenstiftes



23.2.1874
Hamburg
–
1.4.1961
Hamburg
Hamburg
–
1.4.1961
Hamburg
Mehr erfahren
Am 23.2.1874 wurde Hanna Glinzer in der von ihrer Pflegegroßmutter Emilie Wüstenfeld (siehe zu ihr in der Rubrik: Erinnerungsskulptur) gegründeten Gewerbeschule für Mädchen (siehe dazu historischer Grabstein von Marie Glinzer) geboren, deren Leiterin von 1868 bis 1878 Hannas Mutter, Marie Glinzer geb. Hartner - die Pflegetochter Emilie Wüstenfelds - war. Hannas Vater, Dr. phil. Ernst Glinzer, war ebenfalls Lehrer und arbeitete von 1867 bis 1919 als Lehrer für Naturwissenschaften an der Gewerbe- und Bauwerkschule.
Hanna Glinzers Bildungsweg steuerte auch auf die pädagogische Laufbahn hin: Acht Jahre besuchte sie die private höhere Mädchenschule von Dr. Theodor Zimmermann. Zwischen ihrem 17. und 19. Lebensjahr belegte sie Abendkurse bei Herrn Pracht, um sich auf das Lehrerinnenexamen vorzubereiten. 1893 legte sie diese Prüfung am Seminar der Klosterschule ab. Im selben Jahr begann sie als Lehrerin an der höheren Mädchenschule von Antonie Casali im Hamburger Stadtteil St. Pauli zu arbeiten. Drei Jahre später erhielt sie eine Vertretungsstelle an der Schule des Paulsenstiftes (siehe dazu historischer Grabstein von Anna Wohlwill). Stets betonte sie, dass dies nicht durch Beziehungen erfolgt sei. Mit 23 Jahren ging sie für ein Jahr nach Frankreich, hörte Vorlesungen an der Sorbonne und am Collège de France und arbeitete zwei Monate als Erzieherin in einer normannischen Adelsfamilie. Ein Jahr später kam sie an die Schule des Paulsenstiftes zurück. Gleichzeitig bereitete sie sich auf ihr Studium in Deutsch und Geschichte vor, das sie ab 1901 in Berlin begann. 1904, im Alter von 30 Jahren, legte sie das Oberlehrerinnenexamen ab und ging wieder zurück an die Schule des Paulsenstiftes. Zwei Jahre später (1906) schaffte sie die Vorsteherinnenprüfung am Seminar der Klosterschule. Im Alter von 37 Jahren, im Jahre 1911, übernahm sie von ihrer Vorgängerin Anna Wohlwill die Leitung der Schule des Paulsenstiftes. Ab dieser Zeit mussten Schulleiterinnen die gleichen Qualifikationen - nämlich den Nachweis der Vorsteherprüfung und eines Studiums - erbringen wie ihre männlichen Kollegen. Hanna Glinzer erfüllte diese Voraussetzungen - gehörte sie doch schon der Generation von Frauen an, denen das Studium an einer Universität und der Besuch eines höheren Lehrerinnenseminars erlaubt war.
Bis 1937 war Hanna Glinzer Direktorin der Schule des Paulsenstiftes. Diese Position konnte sie deshalb einnehmen, weil es sich bei der Schule um eine private Lehranstalt handelte. An staatlichen Schulen waren ausschließlich Männer als Schulleiter vorgesehen. Die Erziehungswissenschaftlerin Elke Kleinau schreibt dazu: „In Preußen werden 88% aller privaten höheren Mädchenschulen von Frauen geleitet. Die öffentlichen Schulen haben dagegen zu 91% einen männlichen Leiter. In dieser Hinsicht ist die Paulsenstiftsschule mit ihrer Entscheidung für eine Schulleiterin ganz der Privatschultradition verhaftet. Nun handelt es sich aber bei der Paulsenstiftsschule um eine staatlich anerkannte, halböffentliche höhere Mädchenschule. Von daher ist es ungewöhnlich, dass an ihr fast ausschließlich Frauen beschäftigt sind"1). Solch eine - wie damals oft verlautete - Kuriosität hatte Programm. Schließlich war die Schule des Paulsenstiftes von dem Hamburger "Frauenverein zur Unterstützung der Armenpflege" gegründet worden, der sich nicht nur um einen höheren Frauenanteil in den Lehrkörpern bemühte, sondern in seiner Schule ausschließlich Frauen beschäftigen wollte. Und Hanna Glinzer setzte sich als Schulleiterin für die Durchsetzung dieser Forderung ein.
Als 1908 im Zusammenhang mit der preußischen Mädchenschulreform ein Gesetz erlassen wurde, dass die Stellen für die pädagogischen Kräfte geschlechtsparitätisch zu besetzten seien, löste dies im Schulvorstand der Schule des Paulsenstiftes heftige Debatten aus, war man doch gerade im Begriff, um eine staatliche Anerkennung zu ersuchen - damit wäre die Schule aber unter dieses Gesetz gefallen. Dennoch beschloss der Schulvorstand 1910, die staatliche Anerkennung zu beantragen, um damit seinen Schülerinnen bessere Berufschancen zu ermöglichen. 1912 erhielt die Schule die Lyzealberechtigung und damit gleichzeitig die Vorgabe, in Zukunft ein Drittel männlicher Lehrkräfte einzustellen. Der Schulvorstand wusste sich aber zu helfen: Er stellte zwar entsprechend viele männliche Lehrkräfte ein - diese aber nur nebenamtlich. Elke Kleinau erklärt dazu: „Dieses Verfahren, männliche Lehrkräfte ausschließlich nebenamtlich zu beschäftigen, wird möglich durch die Verknüpfung zweier Vorschriften über die Zusammensetzung des Lehrerinnen- und Lehrerkollegiums in privaten Mädchenschulen. Neben der Quotenregelung für männliche Lehrkräfte legen die Bestimmungen fest, dass nebenamtliche Kräfte engagiert werden können, die von ihnen erteilten Unterrichtsstunden aber nicht mehr als ein Drittel der Gesamtstunden betragen dürfen. Diese Regelung wird von der Schule bis Ostern 1932 praktiziert, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Staat den Lehrerinnen und Lehrern generell die Ausübung nebenamtlicher Tätigkeiten untersagt"1).
Unter Hanna Glinzers Leitung konnte die Schule in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts zur Oberrealschule ausgebaut und außerdem als zweiter Oberbau eine dreijährige Frauenschule angegliedert werden.
Neben ihrem Lehrerinnenberuf betätigte sich Hanna Glinzer auch stände- und frauenpolitisch. Sie wurde eines der führenden Mitglieder in den Hamburger Ortsgruppen des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins und des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins. Helene Lange wollte sie sogar für eine Kandidatur zur Hamburgischen Bürgerschaft gewinnen, was darauf schließen lässt, dass Hanna Glinzer zur Deutschen Demokratischen Partei tendierte. Aber Hanna Glinzer lehnte wegen ihrer Arbeitsbelastung als Schulleierin ab.
Hanna Glinzer gehörte zu denjenigen, die den Machtantritt der Nationalsozialisten und eine restriktive Politik vorausgesehen hatten. Als sich ihre Befürchtungen verwirklichten, sah sie die einzige Möglichkeit, ihre Schule zu retten, in der völligen Verstaatlichung. Dies geschah 1937 und bedeutete gleichzeitig das Ausscheiden Hanna Glinzers aus dem Schuldienst. Denn sie weigerte sich, den Treueeid auf Hitler zu schwören - ließ sich lieber zwei Jahre zu früh pensionieren.
Im Zweiten Weltkrieg wurden die Schule und auch Hanna Glinzers Wohnung ausgebombt. Hanna Glinzer musste Hamburg verlassen. Lange hatte sie nicht die Kraft, eine zielgerichtete Arbeit aufzunehmen, erteilte dann aber doch wieder Unterricht - und zwar Flüchtlingskindern. Erst 1949 konnte sie nach Hamburg zurückkehren und erhielt eine Wohnung in einem Blankeneser Gartenhaus.
Text: Rita Bake
Zitate:
[1] Elke Kleinau: Die Hochschule für das weibliche Geschlecht und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des höheren Mädchenschulwesens in Hamburg. In: Zeitschrift für Pädagogik 36, 1990, Nr.1.
Trauerrede für Hanna Glinzer an der Beisetzungsfeier am 7. April 1961, Privatarchiv Dr. Rita Bake
Marie Glinzer
Lehrerin, Leiterin der von Emilie Wüstenfeld gegründeten Gewerbeschule für Mädchen



3.12.1843
Hamburg
–
6.12.1921
Hamburg
Hamburg
–
6.12.1921
Hamburg
Mehr erfahren
Nach dem frühen Tod ihres Vaters wurde die 12jährige Marie Hartner als Pflegetochter in den Haushalt Emilie Wüstenfelds aufgenommen, um ihrer einzigen Tochter Marie Gesellschaft zu leisten. Sie besuchte die Schule des von Charlotte Paulsen und Emilie Wüstenfeld gegründeten "Frauenvereins zur Unterstützung der Armenpflege". 1860 begann ihre Ausbildung zur Erzieherin. Im Alter von 16 Jahren kam Marie Hartner zu Bertha Ronge gesch. Traun, geb. Meyer (siehe Grabstein: Antonie Traun und Erinnerungsstein: Margarethe Meyer Schurz) nach London, bei der sie die Arbeit in einem Fröbelschen Kindergarten kennen lernen sollte.
1861 engagierte Emilie Wüstenfelds Freundin Malwida von Meysenbug Marie Hartner als Gehilfin für die Erziehung der neunjährigen Olga Herzen, Tochter des im Londoner Exil lebenden russischen Revolutionärs Alexander Herzen. Nach vier Jahren Aufenthalt im Ausland kehrte Marie Hartner 1864 nach Hamburg zurück, wo sie zunächst bei der Familie Kortmann (siehe Grabstein: Marie Kortmann), dann wieder bei Emilie Wüstenfeld wohnte. Marie Hartner begann ihre Ausbildung zur gewerblichen Lehrerin. Am 3. November 1866 weihte sie die vom Hamburger Verein zur Unterstützung der Armenpflege gegründete Schule des Paulsenstifts mit ein (siehe: Grabstein Anna Wohlwill) und unterrichtete an der neuen "Industrieklasse". Marie Hartner wurde 1867 mit der Leitung der Klasse betraut, die sich im dritten Stock des Hauses Großer Burstah 12/16 zu Hamburgs ersten Gewerbeschule für Mädchen entwickelte. Schneidertische und Nähmaschinen waren die erste Ausrüstung. Hand- und Maschinennäherei, Wäsche und Kleiderzuschneiden und -anfertigen waren die ersten Arbeiten, Musterentwerfen und Zierhandarbeiten, alle Ausbesserungen, Waschen und Plätten traten hinzu. Zeichnen, Körperzeichnen, Zeichnen nach Pflanzenmodellen und nach der Natur, Malen, Porzellan- und Holzmalerei, Lithographie wurden eingeführt. Die Anfangsgründe der Physik und Chemie, Deutsch, Rechnen und Elementargeometrie, Buchführung und Schreiben traten hinzu. Man arbeitete für Kunden. Im Herbst 1867 kam Dr. Ernst Glinzer aus Kassel als Lehrer an die Baugewerkschule nach Hamburg und unterrichtete auch an der Gewerbeschule für Mädchen. Marie Hartner und Ernst Glinzer wurden am 2.6.1870 standesamtlich getraut. Marie Glinzer wurde Mutter von 3 Kindern, Otto (Arzt, geb. 1871), Hanna (siehe Grabstein: Hanna Glinzer) und Dora (geb. 1878). Sie setzte ihre Arbeit als Lehrerin fort. Nach dem Tod von Emilie Wüstenfeld kollidierten die Pläne des Vorstandes des Frauenvereins mit Marie Glinzers Auffassungen. Um seiner Frau weiteren Ärger zu ersparen, kündigte Ernst Glinzer die Stelle seiner Frau, was seine Frau sehr kränkte. Die Arbeit der Schulleitung hatte Marie Glinzer besser vertragen als die der Hausfrau und Mutter. Der Abschied von der Erwerbsarbeit war Marie Glinzer zeitlebens nahegegangen.
Gerda Gmelin
Prinzipalin des "Theaters im Zimmer", Schauspielerin



Gerda Gmelin in ihrer Wohnung an der Alsterchaussee
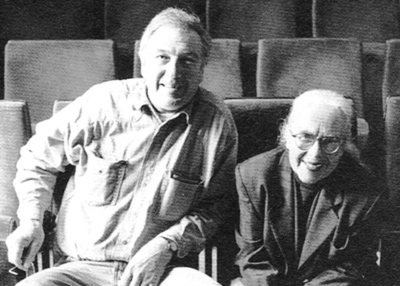
Gerda Gmelin mit ihrem Sohn Christian Masuth

23.6.1919
Braunschweig
–
14.4.2003
Hamburg
Braunschweig
–
14.4.2003
Hamburg
Mehr erfahren
Gerda Gmelin wurde im Garten der Frauen bestattet. Ihr Grabstein wurde von dem Steinmetz Bert Ulrich Beppler geschaffen und von der Steinmetzfirma Carl Schütt & Sohn gespendet.
Brief von Gerda Gmelin an ihren Vater, 2. November 1949. Lieber Vati! Seit Langem habe ich vor Dir zu schreiben, aber es fehlt mir wirklich die Zeit, ich muss mich auch jetzt kurz fassen. Aber ich habe das Gefühl, als müsste ich doch noch etwas von mir hören lassen, trotzdem ich von Dir gar nichts mehr höre, höchstens mal von der Aussenwelt, aber es ist anzunehmen, dass es Dir gut geht. Wenn ich es äusserlich nehme, kann ich von mir dasselbe behaupten. Aber wenn ich Dir schreibe was ich im Moment tue, wirst Du wirklich staunen. Ich fungiere seit 8 Wochen als Bardame, und zwar in einem der verrufensten Lokale von Koblenz. Es verkehrt bei mir zum grössten Teil die Unterwelt u. Leute, die Geld haben zum bummeln. In den ersten 8 Tagen hatte ich das Gefühl in der Hölle zu sein, ich kam hier hin, als es neu eröffnet wurde u. der Betrieb war unheimlich, allmählich hat es etwas nachgelassen, aber ich verdiene immer noch soviel, dass ich meine Kinder u. mich ganz gut durchbringen kann, u. uns das Notwendigste kaufen kann. Ich könnte das in keinem anderen Beruf verdienen. Es gibt natürlich Tage, die sind grauenvoll u. zum Davon-Laufen, andere Tage sind wieder ganz amüsant u. inhaltsreich, d. h. es sind ja die Nächte, ich fange nachmittags um 4 Uhr an u. komme vor 4 oder 5 Uhr früh morgens nicht raus hier. Der Sturm setzt erst um 12 Uhr ein. Zuweilen verlaufen sich auch Menschen unserer Klasse nach hier, u. ich darf sagen, dass ich wohl beliebt bin u. das Lokal, seit ich hier bin, einen etwas besseren Ruf hat! Nun wäre es ja auch traurig, wenn das nicht so wäre, denn ich bleibe trotz allem was ich bin, ich fasse alles rein geschäftlich auf u. habe den Bogen schon ganz gut raus, da, wo ich sehe, dass etwas ist, tüchtig zu kassieren. Im Trinken bin ich ja sehr fest u. kann viel vertragen. Äusserlich muss ich mich wohl sehr verändert haben, denn es heisst, ich sei eine ‚schöne Frau‘, u. ‚sehr charmant‘. Jetzt lachst Du! Ich bin allerdings durch das Nachtleben sehr schmal u. schlank geworden u. Kleider machen Leute. Ich habe jetzt einen Locken-Wuschelkopf, wie Theklachen. Mein Mann [Leo Masuth] (…) hat eine Gage von 250 M u. so habe ich von ihm auch für die Kinder kaum etwas zu erwarten, aber so lange ich es schaffe, ist es mir ebenso recht, wenn ich sie selber durchbringen kann. Verzweiflung u. Träumereien gibt es jetzt nicht mehr. Z. zt. geht es mir um’s Verdienen. Ich denke bewusst nicht mehr an irgendwelche Ideale, denn sowie ich diesen Gedanken nachgehe, habe ich keine Energie mehr u. es muss ja weitergehen. Es wird schon einmal der Tag kommen, wo man wieder sich selbst leben kann. Ich muss dankbar sein, dass ich nach all den Ereignissen noch die Kraft habe, auf diese nervenaufreibende Art mein Geld verdienen zu können. Einen besonderen Verehrer habe ich hier in einem älteren Herrn, der früher Sänger u. Theaterhase war, er kennt Stiebner u. die Laja sicher gut von Berlin, u. hat soviel Ähnlichkeit mit Dir, ein netter Komödiant u. Bohèmiens geblieben, trotzdem er jetzt in der Industrie ist. Es ist sehr gut, dass ich an ihm einen Halt hab‘, er ist vielleicht nur ein paar Jahre jünger wie Du u. besorgt u. grosszügig zu mir. Im Laufe der nächsten Zeit werde ich es wohl auch zu einer Wohnung bringen u. die Kinder zu mir nehmen können, u. diesen Winter muss ich durchhalten, bis zur nächsten Saison, vielleicht gibt’s dann ein Engagement. Nun schreib‘ mir doch endlich auch einmal. Ich hätte schon so oft Gelegenheit gehabt mit Geschäftsleuten nach Hambg. fahren zu können, aber wenn ich ein paar Tage aussetze, verliere ich zuviel. Also schreib‘ endlich mal. Es ist doch zu traurig, wenn wir so auseinanderkommen. (…) Es grüsst u. küsst Dich herzlich Dein Gerdachen 1) Der Name Gerda Gmelins und ihre Person sind untrennbar mit dem Theater im Zimmer in Hamburg verbunden. Die Gründung des kleinen Theaters geht auf ihren Vater Helmuth Gmelin zurück. Er eröffnete das Theater am 24. März 1948 in seiner Wohnung an der Alsterchaussee 5 und verwirklichte damit seine lang gehegte Idee, ein „Theater ohne Vorhang und Rampe“ zu gründen - in einer zwanglosen, privaten Umgebung, im direkten Kontakt zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. Brief Helmuth Gmelins an seine Tochter Gerda, Hamburg Sonnabend 23. Februar 1952 Mein liebes, gutes Gerdalein! Der verfluchte Hetzvater dankt Dir mal wieder für alle Deine lieben Briefchen und besonders für den letzten, woraus ich wieder ersehe, wie tapfer Du Dich durchschlägst durch Dein schweres Leben. Ich fände es für unsere Beziehung sehr, sehr schön, wenn Du mit den Enkeln i. Lüneburg landen würdest u. habe darum gleich meine Fühler bei Arnemann ausgestreckt. (…) Arnemann wird, ohne daß Deine Sache berührt wird, dieser Tage bei Schmidt vortasten, wen er für die nächste Spielzeit wieder engagieren will u. meint daß es im Falle Masuth so sein wird. Ich schreibe Dir sofort, wenn ich es weiß. Feste Verträge laufen allerdings nur für eine 6 Monate Spielzeit, woraus sich aber nachher meistens noch 1-2 Monate Vor od. Nachspielzeit ergibt. Ich würde an deiner Stelle mich noch nicht selbst bewerben. Da könnte Schmidt stutzig werden wegen Doppelengagement u.s.w. So was mögen die Intendanten im allgemeinen nicht gerne. Aber nach Arnemanns Beschreibung fehlt i. so einem kleinen Ensemble oft eine Kraft so daß dann doch gute Aussicht besteht, daß Du für ein Stück geholt wirst. Vor allem aber wäre es, wenn Du so nahe bei Hamburg stationiert bist, für mich viel eher möglich, Dich auch mal bei mir auszuprobieren. Ich kenne Dich ja garnicht mehr in deiner Schauspielerei u. würde mich riesig freuen, wenn es mal klappte. (…) Ganz davon abgesehen, freue ich mich auch so, wenn ich Dich u. die Jungens öfters mal zu Besuch haben könnte. (…) Ich lebe z.Z. in sehr gemischter Stimmung. Mein Theater hat schöne Erfolge, die ich aber innerlich garnicht so als echten Erfolg sehe, da sie meinem Wesen nicht entsprechen. Aber seit ungefähr 1 Jahr habe ich i.d. Presse immer dann Ablehnung, wenn ich selbst etwas inszeniere od. spreche. Es ist schwer darüber hinwegzusehen – trotzdem die Zeitungsleute ja nicht immer u. in allem recht haben. Der Ärger ist nicht gekränkte Eitelkeit, sondern die Tatsache, daß man sich mit dem, was man eigentlich will, nicht durchsetzt. – Nun, es muß durchgestanden werden. Jedenfalls wird ab 6. März angefangen mit dem Umbau des neuen Hauses und wenn Gott will steht es Mitte Mai zum Besprechen frei. Herzliche Grüße von allen. Sei innigst umarmt vom bösen Vati. Vielen Dank für Christians schönen Brief. Küsse ihn u. Mathias vom Opa.“ 1) Im März 1955 - das Theater im Zimmer hatte inzwischen sein neues Domizil in der Alsterchaussee 30 bezogen - holte Helmuth Gmelin seine Tochter mit ihren beiden Söhnen an sein Theater. Gerda Gmelin war inzwischen Schauspielerin geworden und hatte ein Engagement an einer Wanderbühne in Neuwied. Sie war verheiratet mit dem Schauspieler Leo Masuth, dessen Namen sie nach der Scheidung 1958 ablegte, um wieder ihren Geburtsnamen anzunehmen. In Hamburg wohnte Gerda Gmelin mit ihren beiden Söhnen über dem Theater in den Garderoben. Der ältere Sohn Christian kam bald auf ein Internat, Matthias, der Jüngere, blieb in Hamburg und schlief hinter einem Paravent. Auch Gerda Gmelin lebte sehr beschränkt. Der Begriff des Wohnens konnte hierfür kaum angewendet werden. Gerda Gmelin lernte den Theaterbetrieb in allen seinen Facetten kennen und musste auch alles, was zum reibungslosen Ablauf dazugehörte, mitmachen. So äußerte sie sich einmal dazu: „Schauspielerin war ich zu aller-, allerletzt, zu 99 Prozent war ich halt Regieassistentin, Requisiteuse, Souffleuse, Tonmeister, Inspizientin - alles, was es so gab.“ Ihre ersten kleinen Rollen bekam sie nach Vater Helmuths Motto: „Och, das kann Gerdachen spielen, die ist ja sowieso da.“ Zehn Jahre arbeitete Gerda Gmelin unter diesen aufgezeigten Bedingungen rund um die Uhr. Sie betonte, dass sie weder von großen Rollen noch von Regieführung träumte. Sie fühlte sich wohl in der Verantwortung für einzelne Bereiche, freute sich, guten Regisseuren zu assistieren, war weit entfernt von dem Gedanken, das Theater eines Tages selbst zu leiten. Allmählich veränderte sich die Sicht Helmuth Gmelins auf das schauspielerische Talent seiner Tochter. Gerda Gmelin bekam größere Rollen und wurde von den Assistenz- und Inspizienzaufgaben befreit. Nach dem plötzlichen Weggang einer engen Mitarbeiterin übte sie sich nun in ersten Engagements. In diese Zeit fiel eine schwere Erkrankung Helmuth Gmelins, die 1959 zu seinem Tode führte. Von dieser Zeit an begann für Gerda Gmelin ein neuer Lebensabschnitt. Ohne dass sie es je beabsichtigt hatte, war sie nun die Prinzipalin, die Intendantin des Theaters im Zimmer. Zuerst fühlte sie sich nicht wohl mit dieser neuen Aufgabe, wollte „gehen“, doch die nächsten Aufführungen (z. B. von Anouilh) waren solch ein großer Erfolg, dass sie sich dem Publikum verpflichtet fühlte. So wuchs sie in die größere Verantwortung hinein - unterstützt vom Freundeskreis des Theaters, von der Volksbühne und von langjährigen Theaterweggefährtinnen und -gefährten, weiterhin geleitet von der Idee Helmuth Gmelins. Gerda Gmelin pflegte einen familiären Stil im Umgang mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jede und jeder war ihr wichtig für das Gelingen der Theaterarbeit. Sie zeigte ein ausgesprochenes Gespür für avantgardistische, wenn auch nicht immer publikumswirksame Stücke, gute Regisseure und Schauspielerinnen und Schauspieler. Brecht, Miller, de Sade u. a. standen auf dem Spielplan. Im Winter 1967 begann sie eine erfolgreiche jährliche Agatha-Christie-Krimireihe, später folgte ein sonntäglicher Jazz-Frühschoppen, inspiriert durch Gottfried Böttger (Piano) und Andreas von der Meden (Banjo) - eigentlich der Beginn der Hamburger Musik-Szene, wie Gerda Gmelin einmal betonte. In dieser Zeit des Erfolgs hatte Gerda Gmelin einen schweren Unfall mit langer Rekonvaleszenz. Sie musste „kürzertreten“, erhielt aber viel Unterstützung für das Theater, besonders durch Friedrich Schütter und sein Ensemble. Sohn Christian Masuth, bis dahin zur See gefahren, kam zurück, übernahm die handwerklichen Arbeiten und entwickelte sich zum anerkannten Bühnenbildner des Theaters im Zimmer. Mit der Spielzeit 1977/78 übernahm Gerda Gmelin wieder die ganze Theaterarbeit mit der Aufführung „Gaslicht“ und weiteren Stücken von Ayckbourn, Pinter u. a. Die Volksbühne ehrte Gerda Gmelin mit der Silbernen Maske. 1982 begann Gerda Gmelin mit einem neuen Projekt: einer Musical-Tradition. Bis zur Schließung des Theaters im Zimmer im Jahre 1999 steuerte Gerda Gmelin immer wieder mit großem Elan, mit eigenen erfolgreichen Rollen in Stücken von Pinter, Beckett, Kroetz u. a. durch alle Fährnisse des Theaterlebens. Für ihre Verdienste erhielt sie die Medaille für Kunst und Wissenschaft des Hamburger Senats, die Biermann-Ratjen-Medaille und den Max-Brauer-Preis. Ihre letzte in der Winterhuder Komödie gespielte Rolle der „Winnie“ in Becketts „Glückliche Tage“ war eine ihrer Lieblingsrollen. Gerda Gmelin starb am 14. April 2003 in Hamburg. Text: Christian Masuth (†), Sohn von Gerda Gmelin Quellen: Briefe in Privatbesitz.Christel Grimme
geb. Hartner
Stifterin


8.9.1899
Hamburg
–
19.7.1984
Großhansdorf
Hamburg
–
19.7.1984
Großhansdorf
Mehr erfahren
Christel Grimme stammte aus einer kinderreichen Familie. Sie war die jüngste Tochter und wuchs zwischen zwei älteren Brüdern und den drei älteren Schwestern, in einer lebensfrohen, von harmonischem Geist geprägten Familie auf, in der man fest zusammenhielt und bereit war, sich gegenseitig zu helfen. Die Eltern waren Toni Hartner und der Maschinenfacharbeiter Wilhelm Hartner, ein Bruder von Marie Glinzer, deren historischer Grabstein ebenfalls im Garten der Frauen steht und die die Pflegetochter der Frauenrechtlerin Emilie Wüstenfeld gewesen war.
Christel Grimmes Brüder wurden Ingenieure und heirateten, zwei ihrer Schwestern blieben ledig.
Eine von ihnen wurde Hausdame, die andere Erzieherin. Niemand von den Kindern der Eheleute Toni und Wilhelm Hartner bekam später Kinder. Eine Cousine von Christel Grimme war die im Garten der Frauen bestattete Elisabeth Glinzer, die einen kurzen Lebensabriss von Christel Grimme verfasste. Darin heißt es: "Frau Grimme heiratete einen, von Jugend auf, hochgradig zuckerkranken Mann [Ernst August Grimme 1901-1973], einen Lehrer und später Schulleiter in Northeim. Trotz aller Warnungen hielt sie an ihrem Entschluss fest. Sie ist ihrem Mann durch die Jahrzehnte hindurch eine gewissenhafte, zuverlässige und fürsorgliche Hilfe gewesen. Durch strikte Einhaltung der Zuckerdiät hat sie sich und ihrem Mann ein erfülltes Berufs- und Freizeitleben ermöglicht. Nach ihrem Tod hinterließ Frau Grimme ein beträchtliches Vermögen. Sie stiftete ihr ‚Erbe' für die Unterstützung und Pflege zuckerkranker Kinder. Ich betone ‚Erbe', denn das Vermögen stammte aus den Hinterlassenschaften der vor ihr verstorbenen Geschwister, vor allem aus der Hinterlassenschaft des Bruders John Hartner (1883-1965). Ein Zeichen für den festen Zusammenhalt der Familienmitglieder bis zum Tode." Die Christel- Grimme-Stiftung gibt es noch heute. Sie dient der Unterstützung zur Heilung, Pflege und Betreuung von Kindern, vorzugsweise solcher, die in Heimen leben und die durch ihre Erkrankung an Diabetes mellitus eine geistige und/oder körperliche Behinderung erfahren haben.
Christel Grimmes Brüder wurden Ingenieure und heirateten, zwei ihrer Schwestern blieben ledig.
Eine von ihnen wurde Hausdame, die andere Erzieherin. Niemand von den Kindern der Eheleute Toni und Wilhelm Hartner bekam später Kinder. Eine Cousine von Christel Grimme war die im Garten der Frauen bestattete Elisabeth Glinzer, die einen kurzen Lebensabriss von Christel Grimme verfasste. Darin heißt es: "Frau Grimme heiratete einen, von Jugend auf, hochgradig zuckerkranken Mann [Ernst August Grimme 1901-1973], einen Lehrer und später Schulleiter in Northeim. Trotz aller Warnungen hielt sie an ihrem Entschluss fest. Sie ist ihrem Mann durch die Jahrzehnte hindurch eine gewissenhafte, zuverlässige und fürsorgliche Hilfe gewesen. Durch strikte Einhaltung der Zuckerdiät hat sie sich und ihrem Mann ein erfülltes Berufs- und Freizeitleben ermöglicht. Nach ihrem Tod hinterließ Frau Grimme ein beträchtliches Vermögen. Sie stiftete ihr ‚Erbe' für die Unterstützung und Pflege zuckerkranker Kinder. Ich betone ‚Erbe', denn das Vermögen stammte aus den Hinterlassenschaften der vor ihr verstorbenen Geschwister, vor allem aus der Hinterlassenschaft des Bruders John Hartner (1883-1965). Ein Zeichen für den festen Zusammenhalt der Familienmitglieder bis zum Tode." Die Christel- Grimme-Stiftung gibt es noch heute. Sie dient der Unterstützung zur Heilung, Pflege und Betreuung von Kindern, vorzugsweise solcher, die in Heimen leben und die durch ihre Erkrankung an Diabetes mellitus eine geistige und/oder körperliche Behinderung erfahren haben.
Marie Groot
geb. Schär


29.4.1898
Ohe/Kr. Stormarn
–
20.5.1946
Hamburg
Ohe/Kr. Stormarn
–
20.5.1946
Hamburg
Mehr erfahren
Marie Groot war verwandt mit den Inhabern der Kunsthandlung Groot am Klosterstern 6, die Henry Groot gehörte, und dem Postkarten-Großvertrieb und Verlag Martin Groot in der damaligen Königstraße 25 (Groot-Haus), der heutigen Poststraße in der Hamburger Innenstadt. Das Kunsthaus Groot in der Königstraße kaufte und verkaufte Brillanten, Gold- und Silberwaren, Orient-Teppiche und Gemälde bekannter Meister.
Unmittelbar nach Marie Groot's Tod im Jahre 1946 erhielten die Bildhauer Karl Tuchardt (1907-1984) und O.G. Hermann Perl (1878-1967) den Auftrag, das Grabmal für die Familiengrabstätte Groot herzustellen und schufen einen lebensgroßen marmornen weiblichen Akt, mit den Händen an Schulter und Schenkel ein großes Cape haltend, das die Gestalt hinterfängt. Zu Füßen der nackten Frauengestalt sitzt ein Dackel.
Die Skulptur wird unterschiedlich interpretiert. Einige deuten sie als eine Allegorie der "Tierliebe", zu Ehren einer Frau, die Mitgefühl für alle leidenden Wesen hatte. Als deren Stellvertreter schaut der kleine Dackel zu Füßen der weiblichen Figur aufmerksam zu ihr hinauf, während sie mit der rechten Hand schützend ihren Mantelsaum um ihn legt.
Diese Auslegung entspricht den Aussagen von Mitgliedern der Familie Groot. Sie berichten, dass es sich bei dem Dackel um Marie Groot's Hund Peppi handelt. Die Familie Groot schätzte Dackel als Haushunde. Ob die Skulptur Marie Groot selbst darstellen soll, ist nicht bekannt. Überhaupt ist bislang wenig über Marie Groot's Leben und Wirken in Erfahrung gebracht worden. Deshalb steht die Skulptur symbolisch für die vielen Frauen, denen wertschätzende Erinnerung nicht zuteil wird.
Andere interpretieren die nackte Frauengestalt mit Hund als Artemis, die Göttin der Jagd, des Waldes und des Mondes sowie die Hüterin der Frauen und Kinder. Die "Herrin der Tiere" wurde von jungen Frauen und Hunden begleitet. Artemis schützte Frauen jeden Alters sowie Kinder beiderlei Geschlechts.
Das Umsetzen der Skulptur in den Garten der Frauen sowie entsprechende landschaftsarchitektonische Maßnahmen und die Infotafel wurden gefördert durch die Freie und Hansestadt Hamburg, Kulturbehörde
Martha Hachmann-Zipser
Schauspielerin am Deutschen Schauspielhaus von 1900 bis 1940

Martha Hachmann-Zipser: Bild: via Wikimedia Commons, Jan Vilímek (Maler) / gemeinfrei


11.12.1864
Schmiedeberg/Schlesien
–
30.12.1940
Hamburg
Schmiedeberg/Schlesien
–
30.12.1940
Hamburg
Mehr erfahren
Als im Jahre 1900 das Deutsche Schauspielhaus in der Kirchenallee gegründet wurde, um das Theatermonopol Bernhard Pollinis zu brechen, der die drei führenden Bühnen – Hamburger Stadttheater, Thalia-Theater, Altonaer Stadttheater – in seiner Hand vereinigte und sie ausschließlich unter dem Gesichtspunkt größtmöglichen Profits führte, berief der erste Direktor des neuen Theaters, Alfred von Berger, den Regisseur Cord Hachmann nach Hamburg. Mit ihm kam seine Frau, die Schauspielerin Martha Hachmann-Zipser, die bereits erfolgreiche Bühnenjahre hinter sich hatte.
Den Anfang ihrer Theaterlaufbahn beschreibt Martha Hachmann-Zipser folgendermaßen: „Ich bin nicht, wie so viele meiner Kolleginnen und Kollegen heimlich dem Elternhause entlaufen, um auf die Bühne zu kommen, noch habe ich verborgen Rollen gelernt mit der stillen Sehnsucht, endlich das Ziel meiner Wünsche zu erreichen, sondern ich bin auf ganz natürliche Weise zum Theater gekommen. Eines Tages, ich war noch nicht ganz 15 Jahre alt, hatte meine Mutter einen Vertrag unterschrieben, der sie für komische Alte und Mütterrollen und mich für das Fach der jugendlichen Liebhaberin dem Direktor Paul in Torgau verpflichtete. Unterricht hatte ich natürlich nie gehabt, aber die Rollen meines Fachs kannte ich alle; denn als ich kaum lesen konnte, durfte ich ja schon meiner Mutter ihre Rollen abhören, und so habe ich mit dem Lesen sogleich auch das Theaterspielen gelernt.“ So freute sich Martha Hachmann-Zipser, als sie kurz nach ihrer Ankunft in Torgau in der Eröffnungsvorstellung als Preziosa einspringen sollte. In Windeseile besorgte sie sich ein Kostüm – damals mussten die Schauspieler die Kostüme selber stellen – und repetierte die halbe Nacht ihre Rolle: „… am nächsten Morgen stand ich dann als Preziosa auf der Bühne. Der Kapellmeister saß an seinem Pult und im Orchester war die Regimentskapelle der Garnison versammelt. Die Probe ging leidlich gut, bis auf das Melodram. Unkundig, wie ich war, hatte ich meinen Text ad libitum zur Musik heruntergesprochen. Der Kapellmeister klopfte ab und machte mühsame Anstrengungen, mir den Rhythmus und die Fermaten beizubringen. Allein der Wettkampf war aussichtslos. Der Kapellmeister schrie mich an, wie ich es wagen könnte, diese Rolle zu übernehmen, wenn ich keine Ahnung von Musik hätte; das Orchester wurde nach Hause geschickt und durch den Machtspruch des Direktors musste der Kapellmeister am Klavier mit mir Note für Note des Melodrams durchsingen. Am nächsten Abend war die feierliche Eröffnung des Theaters in Torgau. Die Vorstellung verlief ohne Störung. Als nach dem großen Gesang des Chors Preziosa auf den Schultern der Zigeuner abgetragen wurde, applaudierte das Publikum der Debütantin freundlich nach. Beglückt, von Hoffnungen selig geschwellt, sank ich meiner Mutter in die Arme. Damals glaubte ich, das Publikum hätte aus Begeisterung für meine Leistung applaudierte, später allerdings wagte ich zu zweifeln und glaube, dass es wohl Mitleid war, was das Publikum zu dieser Regung veranlasste“ 1).
„Glücklicher Beginn“ nannte Martha Hachmann-Zipser diese Darstellung, und glücklich entwickelte sich ihre weitere Bühnenlaufbahn. Nach Engagements an größeren und kleineren deutschen Stadttheatern kam Martha Hachmann-Zipser 1887 ans Residenz-Theater in Berlin, wo sie 1888 in einer Sondervorstellung von Ibsens „Wildente“ (Uraufführung) mit großem Erfolg die Hedwig spielte. In der Folgezeit half sie mit ihrer Darstellung manches zeitgenössisches Werk in der öffentlichen Meinung durchzusetzen und erntete den Dank der Autoren. Nach der Aufführung der „Wildente“ kam Ibsen selbst auf die Bühne, um ihr für ihre Leistung seine Anerkennung auszusprechen, und Gerhardt Hauptmann, dessen Hannele in „Hanneles Himmelfahrt“ zu ihren Lieblingsrollen gehörte, widmete der Künstlerin Verse.
Martha Hachmann-Zipser machte Gastspielreisen durch Deutschland und Österreich-Ungarn, trat in New York auf und spielte an fast allen Berliner Bühnen (Neues Theater, Deutsches Theater, Theater des Westens, Schillertheater). In Berlin lernte sie auch ihren späteren Ehemann, ihren Kollegen Cord Hachmann, kennen. 1900 folgte sie ihrem schwer nervenkranken Mann, den Berger mit den Worten „Ein kranker Löwe ist mir lieber als ein gesunder Esel“ verpflichtet hatte, nach Hamburg. Obwohl sie sich ganz in den Dienst ihres Mannes stellte, ihn aufgrund seines Gesundheitszustandes zu allen seinen Proben begleitete, fand sie auch noch die Kraft, ihre eigene Karriere zu verfolgen Als sie in Hamburg keine rechten Aufgaben auf ihrem eigentlichen Gebiet fand, wagte sie den kühnen Sprung vom Rollenfach der Naiven in das der Alten. Hatte sie im Alter von 23 Jahren die vierzehnjährige Hedwig in Ibsens „Wildente“ überzeugend verkörpert, so spielte die junge, blühende Frau jetzt alte Frauen, bald dämonisch, bald mütterlich-gütig. Die Mutter Aase in Ibsens „Peer Gynt“ gehört zu ihren großen Erfolgen.
Anlässlich ihres 70-jährigen Geburtstags wurde Martha Hachmann-Zipser in einem Festakt im Schauspielhaus vom Senat zur Hamburgischen Staatsschauspielerin ernannt, was um so bemerkenswerter ist, als dieser Titel zum ersten Mal vergeben wurde. Das Schauspielhaus verlieh ihr die Ehrenmitgliedschaft und den Ehrenring, und zum 75jährigen Geburtstag bekam sie einen lebenslänglichen Vertrag.
Der Theaterkritiker René Drommert schrieb anlässlich ihres 75. Geburtstags in einer Hommage an „Unsere Martha Hachmann-Zipser“: „Ja, sie hat neben den Tugenden des Alters, neben der weisen Herzlichkeit und ihrem schalkhaften Humor, noch deutliche Zeichen der Jugend, noch Skepsis und Kritik und auch noch ein ganz klein wenig Eitelkeit, die ihrer schlichten Würde zuweilen einen so charmanten Reiz gibt. Sie ist jung. Als ob die Erfahrungen, die das Leben und die Kunst brachten, nur dazu gedient hätten, sie freier, unbeschwerter und heiterer zu machen.“ 2)
Text: Brita Reimers
Zitate:
[1]Martha Hachmann-Zipser: Glücklicher Beginn. In: Der Almamach des Staatlichen Schauspielhauses Hamburg. Hrsg. von Henry Flebbe. Hamburg 1940.
[2] 11.12.1939. Zeitungsausschnittsammlung, Staatsarchiv, Hamburg.
"Wenn man nicht mehr spielt, dann ist man alt". Fast 40 Jahre, bis kurz vor ihrem Tod, stand Martha Hachmann-Zipser auf der Bühne des Schauspielhauses. Begonnen hatte die Tochter einer Schauspielerin mit 15 Jahren am Torgauer Theater. Ab 1887 spielte sie in Berlin. Ihre Gastspielreisen führten sie durch Deutschland, Österreich, Ungarn bis nach New York. 1900 folgte sie ihrem schwer nervenkranken Kollegen und Ehemann Cord Hachmann ans Hamburger Schauspielhaus. Obwohl sie sich aufopfernd um ihren Mann kümmerte, fand sie noch die Kraft für ihre eigene Karriere.
Anläßlich ihres 70sten Geburtstages ernannte der Senat sie zur Hamburgischen Staatsschauspielerin, was um so bemerkenswerter ist, als dieser Titel zum erstenmal vergeben wurde.
Erna Hammond-Norden
Kriegerwitwe, die Frau an seiner Seite



24.5.1906
Hamburg
–
6.1.1979
Hamburg
Hamburg
–
6.1.1979
Hamburg
Mehr erfahren
Im Jahre 2005 erinnerte Deutschland mit Feierlichkeiten an das Kriegsende vor 60 Jahren. Der Verein Garten der Frauen gedenkt mit dem Grabstein von Erna Hammond-Norden den vielen tausend Kriegerwitwen des Zweiten Weltkriegs. Sie und die vielen anderen Frauen waren es, die nach den oft unerträglichen Belastungen, Ängsten und Entbehrungen während des Zweiten Weltkriegs einen wesentlichen Anteil am Aufbau des neuen demokratischen Deutschlands hatten. Bei Kriegsende lebten in Deutschland rund 65 Millionen Menschen - mehr Frauen als Männer. Das neue Deutschland brauchte die Frauen als Überlebensarbeiterinnen.
Erna Hammond-Norden, geb. Michel, aus einer Arbeiterfamilie stammend, musste nach
ihrer Ausbildung zur Dekorateurin schon früh zum Lebensunterhalt ihrer Familie beitragen. So blieb denn auch ihr Wunsch, einen künstlerischen Beruf zu ergreifen, unerfüllt. Auf einem "Künstlerfest" im Hamburger Curiohaus lernte sie ihren späteren Mann Wilhelm Hammond-Norden kennen. Er, von Beruf Steinmetzmeister, war gleichzeitig Schriftsteller und Theaterkritiker. 1932 heiratete das Paar. Und obwohl bald darauf die Nazis die Macht ergriffen, begann für Erna die wohl schönste Zeit ihres Lebens. Man lebte sparsam und gesund, war ständiger Gast im Reformhaus, ebenso in den Hamburger Theatern und im legendären Bronzekeller. Das Paar war Mitglied der SPD. Zu seinen Freunden gehörten Hans Leip, Eugen Roth, Helmut Gmelin, Hans Harbek u.a. 1934 wurden die Tochter Renate und 1938 der Sohn Henning geboren. 1939 mit Kriegsbeginn erhielt Wilhelm Hammond-Norden den Einberufungsbefehl. Für seine Frau begann nun die schwere Zeit: Zwei Kleinkinder im Haus und der Mann im Krieg. Der Familienbetrieb lag durch verfehlte Betriebspolitik des Schwiegervaters darnieder und wurde zum Schleuderpreis von einem Wettbewerber übernommen. Und dann kam die schreckliche Nachricht: Ihr Mann wurde nach den Kämpfen um Stalingrad vermisst. Lange Jahre forschte Erna nach seinem Verbleib. Zahllose Gespräche mit heimkehrenden Soldaten wurden geführt, Briefe geschrieben - und immer wieder Hoffnung. Von ihrer kleinen Rente konnte sie sich und ihre beiden Kinder nicht ernähren. So übernahm sie neben der Erziehung ihrer Kinder die Büroarbeit in der nicht mehr der Familie gehörenden Steinmetzfirma. 1955 ließ der neue Firmenbesitzer ihren Mann für tot erklären, um den Namen Wilhelm Hammond-Norden aus dem Handelsregister löschen zu können. Für Erna Hammond-Norden ein Schock. Doch sie konnte nach zähen Verhandlungen erreichen, dass ihr Sohn als Partner in die Firma aufgenommen wurde. Im Alter erkrankte Erna Hammond-Norden an Hautkrebs. Kurz vor ihrem Tod am 6. Januar 1979 wünschte sie sich von ihrem Sohn sein Steinmetzmeisterstück als Grabstein.
Julie Hansen
Bibliothekarin



30.6.1883
Hamburg
–
5.2.1959
Hamburg
Hamburg
–
5.2.1959
Hamburg
Mehr erfahren
Wenige Monate vor ihrer Geburt starb ihr Vater, Kapitän Hansen, beim Untergang der „Cimbria“. Auch ohne den Ernährer gelang es der Witwe, dass ihre drei Kinder Privatschulen besuchen konnten, indem diese z. B. Stipendien erhielten. Julia Hansen erfuhr die Erziehung einer „höheren Tochter“. Doch mit ihrem Wunsch, auf eigenen Füßen zu stehen und einem Beruf nachzugehen, ging sie in Opposition zum Leben einer „höheren Tochter“. 1918 wurde Julia Hansen Leiterin der Barmbeker Bücherhalle - Hamburgs vierten Bücherhalle. Das Verhältnis der Leserschaft zu ihrer Bücherhalle und ihrer Bibliothekarin war sehr vertraut. Besonders zur Jugend hatte Julia Hansen ein besonders gutes Verhältnis. Sie konnte die Jugendlichen fürs Lesen begeistern. Ab 1914 widmete sich Julia Hansen auch der Bibliothekarinnenausbildung. Bereits 1910 hatte sie öffentlich die Gründung einer Bibliotheksschule angeregt, was jedoch am Mangel an geeigneten Dozenten scheiterte. 1940 erhielt Julia Hansen neben Marie Friedrichs die Leitung des gesamten Praktikantinnenunterrichts. Julia Hansen lebte in der Burgstraße, wo sie mit ihrer Freundin Anni Eschrich zusammen wohnte.
Charlotte Hilmer
Malerin, Expressionistin


4.5.1909
Hamburg
–
7.5.1958
Hamburg
Hamburg
–
7.5.1958
Hamburg
Mehr erfahren
Nach dem Abitur 1928 studierte Charlotte Hilmer von 1928 bis 1933 an verschiedenen Kunstschulen, so von 1928/29 an der Landeskunstschule in Hamburg; von 1929/30 an der Kunstakademie in Königsberg und von 1930 bis 1933 an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Während ihres Studiums beschäftigte sie sich hauptsächlich mit dem Aktstudium. Nach ihrer Ausbildung malte sie Personendarstellungen, Portraits und Stillleben. Nach 1941schuf sie auch Landschaften in Aquarell und Öl.
In der Zeit des Nationalsozialismus konnte sie sich künstlerisch nicht frei entfalten. Ihren eigenen auf dem Expressionismus basierenden Stil entwickelte Charlotte Hilmer erst ab 1950 bis zu ihrem Tod 1958.
Studienreisen führten sie nach Holland, Italien und Dänemark. Seit 1939 hatte sie Kollektiv- und Einzelausstellungen, so z. B. in der Hamburger Kunsthalle, in Lübeck, Darmstadt und Göttingen.
Werke von Charlotte Hilmer befinden sich in der Hamburger Kunsthalle, im Märkischen Museum Witten und in Privatsammlungen.
Verheiratet war Charlotte Hilmer mit dem Bildhauer Arnold Hilmer (1908-1993). Das Paar hatte eine Atelierwohnung in der Langen Reihe im Hamburger Stadtteil St. Georg. Später lebten beide in der Etzestraße in Hamburg Fuhlsbüttel.
Marie Hirsch
alias Adalbert Meinhardt
Schriftstellerin und Übersetzerin



12.3.1848
Hamburg
–
17.11.1911
Hamburg
Hamburg
–
17.11.1911
Hamburg
Mehr erfahren
„Marie von Ebner-Eschenbach ist keine zünftige Frauenrechtlerin. Nie hat sie absichtlich ihre Feder in den Dienst irgend einer Tendenz gestellt. Wenn wir dennoch uns aus all ihren Schriften sehr entschiedene Lehren ziehen können, so ist es eben ihre eigene starke Überzeugung, die sich nie verleugnen will. So sagt sie uns Frauen in jeder ihrer Frauengestalten (…). Vertrau auf dich und Deine Kraft! So sagt sie der Jugend (…). Sei Du selbst, sei Du selbst! – Ob Mann ob Weib, Dein ist das Recht der Selbstbestimmung, Deinem inneren Gesetz musst Du folgen. Es gibt kein höheres!
Aber aus dem Bewusstsein der Freiheit, tiefinnerlicher, vorurteilsloser Freiheit des Denkens, erwächst zugleich die Kraft sich zu fügen. Das, was man als Pflicht erkannt hat, fraglos tun ist höher, ist größer als Freiheitsstolz. Gerade ihre selbstherrlichsten Gestalten beugen sich eigene Sittengesetze“ 1).
Diese Worte, mit denen Marie Hirsch die Werke Marie von Ebner-Eschenbachs 1910 anlässlich des 80sten Geburtstags der Schriftstellerin im Hamburger Frauenclub charakterisierte, könnten fast ebenso gut ihre eigenen Arbeiten beschreiben. Marie Hirschs Bücher, zumeist Novellenbände, handeln von Glück suchenden Menschen, wie auch der Titel eines ihrer Bücher lautet. Da gibt es die Leidenschaftlichen, die unbedingt leben wollen. Die Zarten, Weichen, die zweifeln und zaudern, und die Stolzen mit ihren zerstörerischen Kräften. Keinem von ihnen wird Recht gegeben. Am Ende siegt immer die Besinnung auf die innere Pflicht, die Absicht, das Leben schön und würdig zu führen. Und häufig sind es die Frauen, denen das gelingt, die sich im Streit zwischen Liebe, Stolz und Würde auf letztere besinnen und handelnd in die Welt treten. „So lange du atmest, So lange du Mensch bist, das Leben ist golden, So lang du es willst“ 2), heißt es in einem Gedicht. Und an anderer Stelle bekennt sie: „Der Mensch selbst ist sein Schicksal. Ich liebe starke, hochgemute, stolze Menschen, die in sich so etwas wie einen kategorischen Imperativ tragen, der ihnen gebietet: Kopf hoch, die Zähne zusammengebissen und durch! –ob es weh tut oder nicht“ 3).
Ein solcher Mensch ist Heinz Kirchner, der Titelheld ihrer erfolgreichsten Erzählung, die fünf Auflagen erreichte. Gegen den Widerstand des Vaters setzt Heinz Kirchner seine Berufswahl, Arzt zu werden, durch. Er ist so erfolgreich, dass der Vater bald seinen Irrtum eingestehen muss. Und auch in der Liebe geht Heinz einen oder besser seinen zielstrebigen geraden Weg. Als er erfährt, dass die geliebte Frau verheiratet ist, versucht er nur kurz, sie zu einer Trennung vom Ehemann zu bewegen, leistet dann jedoch Verzicht, ohne eine andere zu heiraten. Erst nach dem Tode des Ehemanns handelt er, fährt nach Amerika, um die geliebte Frau zu holen. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Heinz Kirchner erfährt nach wenigen Jahren, dass er an einem Herzleiden sterben muss. Doch schnell gewinnt er seine Fassung wieder. Seinem Wunsch entsprechend, werden auf die Graburne die Worte gesetzt, mit denen auch der Roman endet: „Es war ein Mensch. Und Mensch sein, heißt enden müssen.“
Nach solchen Prinzipien scheint Marie Hirsch auch ihr eigenes Leben gestaltet zu haben. Sie entstammte einer großbürgerlichen Familie, die in Wien einem großen, sehr angesehenen Kreis angehörte, und nach Hamburg übersiedelte. Nach dem frühen Tod der Eltern lebte Marie Hirsch zusammen mit ihren älteren Geschwistern, dem Bruder Philipp (geb. 1834), einem Rat der Justizverwaltung, und der Schwester Johanna (geb. 1840) in der Tesdorpfstraße, „in einem Häuschen inmitten eines schattenreichen, tiefen Parks, von Schlingpflanzen verdeckt und eingehegt in ein grünes Gewirr von Ranken“, wie ihr Schriftstellerkollege Richard Huldschiner anlässlich ihres 60sten Geburtstags im „Hamburger Fremdenblatt“ schreibt (12.3.1908). Die Geschwister übten großen Einfluss auf das Denken und Fühlen Marie Hirschs aus. Ihnen widmete sie auch ihr erstes Buch „Reisenovellen“.
„P….. und J…….
Mit Euch, Ihr Zwei, lernt’ ich auf mancher Reise
Die schöne Welt genießen und verstehn,
Mit Euch sah ich daheim, im gleichen Gleise,
Die Jahre still an mir vorübergehn;
Ihr habt ein Jeder mich nach seiner Weise
Gefördert, mich geleitet klar zu sehn,
Drum soll auch Euer sein, Ihr meine Lieben,
Was ich mit Euch und für Euch nur geschrieben!“
Ein besonders inniges Verhältnis verband sie mit der Schwester. In der „aus dem Gedächtnis“ aufgeschriebenen Laudatio eines Freundes anlässlich des 60sten Geburtstags von Marie Hirsch heißt es: „Wer gleich uns über 30 Jahre in fast täglichem Verkehr und enger Freundschaft hier verbunden ist, der weiss, dass all die schönen und reichen Geistesgaben, die unsere Freundin Marie schmücken, dass all ihr Denken und Schaffen getragen wird von einer einzigen großen Leidenschaft, von der Liebe zu ihrer Schwester, einer Liebe, wie sie größer, reiner und hingebender nicht gedacht werden kann und diese, Marie´s ganzes Heim umfassende Liebe, die in vollem Masse ihr erwidert wird, (…) hat hier eine Verschmelzung geschaffen, ein Doppelleben, bei dem Empfangen und Geben nicht mehr zu unterscheiden ist. Ist aber auch die Grenzlinie zwischen Empfangen und Geben verwischt, in einem hat sich Marie ihre Eigenart (ein Wort das sie übrigens hasst) bewahrt, in einem ist sie die weitaus Gebendere und das ist in der sonnigen Auffassung des Lebens, in der wunderbaren Klarheit, mit der sie auch alles Dunkle und Schattenhafte durchleuchtet, in der frohsinnigen Heiterkeit ihrer Seele, die ihr das Leben so lebenswert macht“ 1).
Marie Hirsch war sehr gebildet. Sie konnte Griechisch und Latein, beschäftigte sich mit Renaissance, las Petrarca im Original und übersetzte Bücher aus dem Italienischen und Spanischen. Sie unternahm Reisen nach Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland. die Türkei, Marokko und kurz vor ihrem Tode nach Ägypten. Auf diese Reiselust geht auch der schon erwähnte Festredner ein, aber auch er sieht in dem selbst gewählten häuslichen Pflichtenkreis ihren wahren Ort: „Nun denn, meine Damen und Herren, da weiß ich, dass sie der Wünsche viele hat, sei es ein Automobil, um große weite Fahrten zu machen, sei es am Ende ein Luftballon, um Länder zu durchmessen und Neues kennen zu lernen. Alles, alles würde für sie Lebensreiz und Freude sein, aber nur eines weiß ich zu wünschen, was ihr Glück ausmacht und das ist, dass hier alles, alles ihr erhalten bleibe, wie es ist und dass der schöne Zusammenhang in diesem ihrem Heim sie bis in das späte Alter unverändert umgebe.
Stossen Sie mit mir an, unsere Freundin Marie oder besser gesagt Hanka-Marie soll leben“ 1).
Hanka-Marie ist vermutlich eine Anspielung auf das symbiotische Verhältnis von Marie Hirsch und ihrer Schwester Johanna. „Hanka zugeeignet“ ist auch die lange Erzählung „Stillleben“, die stark autobiographische Züge trägt.
Die Erzählung handelt von zwei Cousinen, die gleichzeitig enge Freundinnen sind und denselben Namen tragen: Eleonore. In Wirklichkeit also nur eine Person, aufgespalten in zwei Romanfiguren. Die eine, Nora genannt, ist dunkelhaarig, glutäugig und leidenschaftlich, geht in die Welt, um Sängerin zu werden, die andere, Ellen, blond und sanft, bleibt beim Großmütterchen. Aber auch sie hat ihre Träume, sie will Schriftstellerin werden. (Unter den vielen Künstlern, die Marie Hirsch beschreibt, ist sie die einzige Schriftstellerin!)
Und sie wird Schriftstellerin, sogar eine ganz erfolgreiche. Die Heiratsanträge des Arztes Dr. Küster lehnt sie zunächst ab: „Und das käme dabei heraus, wenn wir Mädchen uns einmal etwas Großes vornehmen? Nein, bei mir nicht!“ Am Ende aber wird sie doch die „Frau Doktor“ mit Heim und Kindern, wenn auch eine schreibende. „Und wenn ich Dich sehe, ruhig, gehalten, gesittet und kühl (…). Und in Deinen Büchern, - ich las sie alle, ich weiß wie sie bewundert werden, und bewundere sie selbst, - in deinen Büchern ist auch keine Silbe, die je gegen die gesetzmäßige Weltordnung verstieße“, sagt die gescheiterte Nora bei ihrer kläglichen Rückkehr aus Italien spöttisch zu Ellen. Sie möchte am liebsten gleich wieder weg, muss aber dann doch feststellen: „’Auch das ist schön hier.’ – ‚Siehst Du’, rief Ellen, ‚was erst nur grau in grau erscheint, zeigt doch, wenn man sich nur recht hineinsieht, dass es auch eine Poesie hat.’“ Ein Plädoyer für Mäßigung aus innerer Freiheit!
Die Erzählung zeigt, was schon an der Sympathie, mit der Marie Hirsch die Liebenden und Künstler zeichnet, deutlich wird. Nicht ihre zaghaften, zaudernden Romanfiguren sind es, die der Autorin nahe stehen, sondern die Leidenschaftlichen, um deren Gefühle sie weiß, auch wenn sie sie weder sich noch ihren Romanfiguren gestattet.
Die Romanfigur Ellen veröffentlicht, ebenso wie Marie Hirsch selbst, unter einem Pseudonym. Einen wichtigen Grund dafür nennt die Autorin selbst, wenn im Roman vor dem kritischen Auge eines Rezensenten nur männliche Autorschaft zählt: „Der Stiel dieses Autors ist von so ruhiger, ehrlicher Schlichtheit, er verhält sich so unpersönlich, erzählt objektiv, was sich begeben hat, dass man aufatmend denkt: Nun, endlich, da schreibt doch wieder ein Mann!“ In die gleiche Richtung geht, was Marie Hirsch von Marie von Ebner-Eschenbach erzählt. Sie habe unter männlichem Pseudonym zwei Rezensionen über sich selbst geschrieben, in denen sie alle die Argumente formulierte, die üblicherweise gegen die Kunst von Frauen vorgebracht werden: „Hat auch noch keine Frau in der Literatur etwas Hervorragendes geleistet, sie bildet jene Ausnahme, die zur Bestätigung der Regel durchaus notwendig erscheint. Ihr Buch (…) ist beinahe so gut, wie wenn ein Mann es geschrieben hätte. (…). Die Erfindungsgabe der Frauen ist bekanntlich keine Potenz, mit der man zu rechnen braucht, doch besitzen sie fast durchweg Talent zu minutiösem Fleisse, und hat sich dasselbe von alters her in der Ausfertigung von feinen Stickereien, Klöppeleien u.s..w. bekundet“ 1). Für die eigene Annahme eines männlichen Pseudonyms nennt sie allerdings einen anderen Grund: „Das Pseudonym hatte ich angenommen, um möglichst unentdeckt und ungestört arbeiten zu können, auch wusste durch die Jahre niemand außer den Allernächsten etwas von meinem Schreiben. Später, als es doch bekannt ward, hätte ich viel lieber meinen eigenen Namen auf dem Titel meiner Bücher gesetzt, doch musste ich mich dem Wunsche meiner Verleger fügen und den männlichen Schriftstellernamen beibehalten“ 4).
Adalbert Meinhardt veröffentlichte – zunächst meist in verschiedenen Zeitschriften, später in Buchform – Erzählungen, Novellen, Dramen, Märchen, in die oft ihre eigenen Reiseerlebnisse und –eindrücke einflossen. Der Band „Aus vieler Herren Länder“, der Reiseskizzen enthält, wurde erst nach Marie Hirschs Tod von der Schwester herausgegeben. Die Schilderungen der Ägyptenreise erscheinen nur noch in der Zeitschrift „Die Nation“. Die Märchen Marie Hirschs sind weniger phantasie- und geheimnisvoll erzählt als manche Reisenovelle. Dort, wo die Autorin nahe an der Realität schrieb, entwickelte sie die meiste Phantasie. Auch an dem Leben der Heiligen Catarina von Siena, über die sie eine fiktive Biographie „Catarina. Das Leben einer Färberstochter“ schrieb, interessiert sie ein realistisches Moment, wenn sie am Ende des Romans als Grund für die Beschäftigung mit dem Stoff angibt: „Sondern es dünkte uns, mehr als all das, was Frauen heute wünschen und zu erreichen träumen, hatte sie vor fünfhundert Jahren schon erreicht: das Wissen, den Einfluss auf die Geschicke ihres Landes, die Tatkraft, die weise Staatsklugheit und das Ansehen unter den Männern. Sie war Volksfreundin, Schriftstellerin, Rednerin und Gesandte“5).
Text: Brita Reimers
Zitate:
[1] Unveröffentlichter Nachlass. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Handschriftenabteilung.
[2] Adalbert Meinhardt: Das Leben ist golden. Drei Novellen. Berlin 1897.
[3] Adalbert Meinhardt (Marie Hirsch): In : Mitteilungen der Literaturhistorischen Gesellschaft. Heft 7. 2. Jg. 1907.
[4] Zitiert nach: Richard Dohse (Hrsg.): Meerumschlungen. Frankfurt a. M. 1907. Reprint 1985.
[5] Adalbert Meinhardt: Catarina. Das Leben einer Färberstochter. Berlin 1902.
Emma Israel
Malerin



26.10.1898
Hamburg
–
21.2.1994
Hamburg
Hamburg
–
21.2.1994
Hamburg
Mehr erfahren
Emma Israel entstammte einer wohlsituierten jüdisch-orthodoxen Kaufmannsfamilie, die in der Hochallee 104 lebte. Ihr Vater, Max Adolf Israel, verdiente sein Geld im Im- und Export mit Südamerika. Ihre Mutter, Louise, geb. Magnus, war Christin und Hausfrau und Mutter. Emma Israel wurde mit ihren beiden älteren Geschwistern im jüdisch-orthodoxem Glauben erzogen.
Schon als Kind begann Emma Israel zu zeichnen. Ihre ersten Werke sind Kinderzeichnungen aus einem Sinti-Lager in Altona. Doch ihr Wunsch, Malerin zu werden, stieß bei den Eltern auf Ablehnung. Dennoch absolvierte Emma Israel gegen den Willen ihrer Eltern eine künstlerische Ausbildung an der Malschule von Gerda Koppel, später bildete sie sich bei dem Maler und Grafiker Heinrich Stegemann weiter. In den 1920er Jahren schuf sie feine künstlerische Stickbilder. "Ihre frühen Gemälde zeigen Einflüsse der französischen Malerei, besonders Cézannes, aber auch der Hamburgischen Sezession. (…)
Vor 1936 ging Emma Israel ein Jahr lang mit einem Mann auf Vagabondage, was sie auf Veranlassung der Familie mit einem Jahr Landarbeit fern von Hamburg büßen musste."1)
Während der NS-Zeit konnte "die Familie bis 1938 in relativ ungestörten Verhältnissen leben. Max Israel gelang es, Anfang der 1940er Jahre zu erwirken, dass das Haus in der Hochallee zum ‚Judenhaus' erklärt wurde, so dass die Familie dort verbleiben konnte".1) Allerdings musste sie Platz machen für weitere 40-50 Menschen. "Die Firma Stapel & Israel wurde 1941 zwangsweise als ‚nicht-arisch' gelöscht."1) In dieser Zeit wurde Emma Israel zu Zwangsarbeit in der Munitionsherstellung herangezogen. "Durch eine mutige Intervention bei der Gestapo konnte sie ihre Familie vor nächtlichen Übergriffen und vor der Deportation retten, indem sie ihren ‚Mischlings'-Status nachwies. (…) Die künstlerische Arbeit musste die Malerin einstellen." 1)
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus verdiente sich Emma Israel ihren Lebensunterhalt mit dem Kolorieren und Fälschen alter Stiche und dem Verkauf von Carepaketen auf dem Schwarzmarkt "Als Malerin blieb sie unbekannt und hatte zu Lebzeiten keine Ausstellung. Zum Lebensunterhalt kolorierte sie sehr geschickt Landkarten und Hamburgensien für Antiquare, die sie nach alter Weise aus Buchausrissen von unkolorierten Stahlstichen herstellte und patinierte. Zu Lebzeiten verkaufte sie sämtliche eigenen Bilder. Wenige Arbeiten befinden sich in Privatbesitz in Hamburg"1)
1975, als 80-Jährige, fungierte sie als Komparsin in Eduard Fechners Film "Tadellöser & Wolf", der u. a. in ihrem Haus in der Hochallee 104, das sie von ihren Eltern geerbt hatte, gedreht wurde.
Im Alter verschenkte sie ihre Besitztümer. "Ihr kleines ererbtes Vermögen erschlich ein Heilpraktiker, bis sie verelendete und auf Sozialhilfe angewiesen war." 1)
Text zusammengestellt aus Texten von Dr. Maike Bruhns über Emma Israel
Quellen:
Maike Bruhns: Emma Israel, in: Der neue Rump. Lexikon der bildenden Künstler Hamburgs. Überarbeit. Neuaufl. d. Lexikons von Ernst Rump. Hrsg. von Familie Rump, ergänzt, überarbeitet u. auf d. heutigen Wissenstand gebracht von Maike Bruhns. Neumünster 2013, S. 214.
1) Maike Bruhns: Kunst in der Krise. Bd. 2: Künstlerlexikon Hamburg 1933-1945. Verfemt, verfolgt - verschollen, vergessen. Hamburg 2001, S. 216.
Franziska Jahns
Kindermädchen der Familie Warburg


8.7.1850
Hamburg
–
24.2.1907
Hamburg
Hamburg
–
24.2.1907
Hamburg
Mehr erfahren
Franziska Jahns, die in einem Waisenhaus aufgewachsen war, kam 1869 im Alter von 19 Jahren als Kindermädchen in das Haus des Ehepaares Moritz und Charlotte Warburg am Mittelweg 17. Damals waren bereits Aby (1866), Max (1867) und Paul (1868) Warburg geboren. Später folgten dann noch: Felix (1871), Olga (1873) und die Zwillinge Fritz und Louise (1879). Die rothaarige junge Frau schenkte den Warburgkindern ihre ganze
Zuneigung. Sie war der Gegenpol zu Charlotte Warburg, die ein strenges, aus Leistungsdruck bestehendes mütterliches Regiment führte. Franziska Jahns zeigte sich den Kindern gegenüber warmherzig und gefühlvoll, schenkte ihnen ihre volle Zuwendung - räumte sogar das von den Kindern liegen gelassene Spielzeug weg - und war die einzige in der Familie, die mit den Wutausbrüchen und Augenblickslaunen des jungen Aby Warburg fertig wurde.
Franziska Jahns, die nicht dem jüdischen Glauben angehörte, lernte sogar Hebräisch, um mit den Kindern die Gebete sprechen zu können.
Im Winter 1906/07 erkrankte Franziska Jahns an Influenza. Diese Krankheit schwächte sie so sehr, dass sie am 24. Februar 1907 an einem Schlaganfall verstarb.
38 Jahre war sie - wie es in der von dem Bankier Moritz Warburg aufgesetzten Anzeige zu Franziska Jahns Tod heißt: "die treue Freundin unseres Hauses, die wir schmerzlich vermissen werden". In seinen privaten Unterlagen ist nachzulesen, dass Franziska Jahns: "38 Jahre mit uns Freud und Leid geteilt hatte und durch ihr feines, taktvolles Wesen die Vertraute aller geworden war".
Das Grabmal schuf 1908 Richard Luksch, Bildhauer und Professor an der Kunstgewerbeschule in Hamburg. Zwei kniende Frauenskulpturen: die "Trauer" und die "Hoffnung" sitzen sich in etwa 1 ½ Meter Abstand gegenüber. Zwischen ihnen befindet sich ein in der Mitte geöffneter Steinrahmen. Franziska Jahns wurde damals zwischen den Figuren beigesetzt, so dass die nach unten blickende "Trauer" und die ihr Gesicht nach oben wendende "Hoffnung" an Franziska Jahns Kopfende saßen.
In dem Steinrahmen sind glasierte Keramik-Sterne eingelassen. Zwischen den mit den Handflächen auf dem Steinrahmen ruhenden Händen der "Trauernden" liegt ein einziger Stern. Zwischen den ebenfalls auf dem Steinrahmen liegenden Händen der "Hoffenden", deren Handflächen geöffnet sind, sind drei Sterne zu finden. Die "Trauernde" bewahrt den einen und einzigen Stern, während die "Hoffende" weitere Sterne zu erwarten scheint.
Annie Kalmar
(Anna Kaldwasser)
Schauspielerin am Deutschen Schauspielhaus von 1900 bis 1901



Annie Kalmar, Salondame, um 1900, Bild: via Wikimedia Commons, Rudolf Krziwanek / gemeinfrei

14.9.1877
Frankfurt am Main
–
2.5.1901
Hamburg
Frankfurt am Main
–
2.5.1901
Hamburg
Mehr erfahren
Annie Kalmar starb bereits im Alter von 23 Jahren. Die eigentliche Todesursache sieht der Wiener Schriftsteller und Herausgeber der „Fackel“, Karl Kraus, in der Indolenz von Publikum und Kritikern gegenüber der Begabung Annie Kalmars: „Drei Wochen später starb die junge Schauspielerin, an Nichtachtung des Talents, die sicherlich hier wie so oft die letzte Ursache allen physischen Ruins war“ 1).
Über Annie Kalmars Herkunft und Jugend ist nichts herauszufinden. Nach ersten Auftritten an kleinen Bühnen ging sie nach Wien und nahm Unterricht bei Rosa Keller-Frauentahl. 1895 erhielt sie ein Engagement im Deutschen Volkstheater. Doch weder Publikum noch Kritiker erkannten ihr Talent, sie sahen in ihr nur die schöne, anmutige Frau, an deren Anblick man sich delektierte. Empört prangerte Karl Kraus im April 1899 in der „Fackel“ diesen Sachverhalt an: „Von den Darstellern des ‘Schlafwagencontrolor’ ist außer Girardi nur das Fräulein Anni Kalmar zu erwähnen. Sie die Herrlichste von Allen, wird von Publicum und Kritik immerzu noch als die ‘Solodame’ pur sang, als Ausstattungsgegenstand des Theaters behandelt. Vermuthlich auch von der Direction, die nur allzu selten der feinen und graciösen Art der Dame größeren Spielraum gewährt. Ihre Schönheit steht ihr hinderlich im Wege. Wenn sie, wie im ‘Biberpelz’, ‘Le Amants’, ‘Unser Käthchen’ und jetzt wieder in der Bisson'schen Novität eine wirkliche und gemein natürliche Humorbegabung erweist, so scheinen dies die Leute, geblendet von ihrem Anblick, gar nicht zu merken. Die Direction sollte das Publikum endlich der schon pensionsfähigen Anmuth der Frau Odilon entwöhnen und einen Theil ihrer Agenden dem Fräulein Kalmar übertragen“ 1). In der nächsten Ausgabe der „Fackel“, Ende April 1899, nahm er das Thema noch einmal auf: „ Das Ensemble des ‘Deutschen Volkstheaters’ verwahrlost zusehends. Man denke sich Frau Odilon als Märchenkönigin. … Frl. Annie Kalmar erwies sich in der langen Erzählung des ersten Aktes als die beste, weil einzige Sprecherin dieses Theaters. Ich habe jüngst Fr. Kalmar als vornehmes, natürliches, besserer Beschäftigung würdiges Talent zu loben mich erkühnt. Dies verhalf mir zu dem Anblicke etlicher breit grinsender Gesichter, und gewisse Leute konnten es nicht fassen, dass eine Schauspielerin, deren von Gott und der Direction gegebenes Amt es wäre ‚bloß schön’ zu sein, am Ende auch Begabung zeigen könne. Herrn v. Bukovics mag es freilich unbequem sein, wenn er einer Dame, die er ausschließlich als Augenweide für ein Stammpublicum von Lebemännern engagiert hat, allmählich auch Rollen wird zutheilen müssen; ich aber pflege mir aus grinsenden Gesichtern nichts zu machen“ 1).
Annie Kalmar hatte Karl Kraus bereits für sein erstes Eintreten für sie gedankt. Am 22. April 1899 schrieb sie an ihn: “Sehr geehrter Herr; Mir wurde vor kurzem die ‘Fackel’ eingeschrieben übersendet und ich fand darin Ihren Artikel über mich. Ich muss Ihnen meinen aufrichtigen Dank aussprechen, dass Sie in Ihrem hochintelligenten Werken meiner gedachten. Sie sind der erste und einzige Journalist, der mich zu verstehen scheint. Seit Jahr und Tag ist mir meine Stellung, ein Schau- und Ausstellungsstück für minderwertige französischen Komödien zu sein, zuwider und oft versuchte ich, mich legal der lästigen Fessel, dem 5. jähr. Contracte, den ich als unerfahrenes 17 jähr. Mädchen unterschrieb, zu entledigen. Aber der Cartellverein, diese moderne Vehme, die für Ihre geistvolle Feder reif ist, legt mir eiserne Fußschellen an. Mir fehlt es nicht an ehrenvollen Anträgen für erste Stellungen an ersten Bühnen – ich musste refüsieren! Ab und zu versuchte ich mich in der Provinz in classischen Rollen, wie Goethe's Gretchen, mit großem Erfolg, um dann wieder hier künstlerische Frohndienste zu leisten, die mich unglücklich machen und meine besten Jahre unnütz vergeuden. Sofort verschaffte ich mir Ihr erstes Heft und war ergötzt über Ihre geistreiche Satire auf den Paradies-‘Dichter’, diesen Gelegenheits-Harlekin. Es ist jedes Wort wahr und ehrlich, bedeutend und geistreich, was ich da las, und werde ich in Zukunft eine eifrige Leserin Ihrer Schrift sein. Empfangen Sie meinen anerkennungsvollen Dank für Ihre Äußerung über mich, die ich um so höher schätze, als sie aus ganz reiner Quelle fließt, da ich nicht persönlich in irgendwelchen Beziehungen zu Ihnen stehe. Ihr kühnes und vornehmes Beginnen begleiten alle meine Glückwünsche, und füge ich diesen meinen hochachtungsvollen Gruß unbekannter Weise an!
Anni Kalmar“ 2).
Persönlich lernten Annie Kalmar und Karl Kraus sich erst nach Abschluss der Theatersaison im Jahre 1900 kennen, als Annie Kalmar das Volkstheater verlassen und einen Vertrag für das neu eröffnete Deutsche Schauspielhaus in Hamburg unter Alfred von Berger hatte. Er besuchte sie täglich im Sanatorium Pukersdorf bei Wien, wo sie den Sommer über ihre angegriffene Gesundheit zu kräftigen suchte, um sich auf das neue Engagement vorzubereiten. Doch schon ihre erste bedeutende Rolle am Schauspielhaus im November 1900, die Maria Stuart, musste sie kurz vor der Premiere aus gesundheitlichen Gründen absagen. Trotz sorgfältiger Pflege erholte sie sich nicht mehr. Sie starb am 2. Mai 1901. Die Todesnachricht erreichte Karl Kraus, der sie alle zehn Tage in Hamburg besuchte, auf dem Weg zu ihr in Berlin.
Für Karl Kraus war die Begegnung mit Annie Kalmar offenbar von lebenslanger Bedeutung. Über zwanzig Jahre nach ihrem Tod, im Jahre 1924, widmete er ihr sein „Traumtheater“, ein Spiel in einem Akt, in dem er den Dichter auf die Frage, wie lange er die Schauspielerin kenne, antworten lässt: „Seit jeher. Ich kannte eine, die mir für alle das Einssein des Weibes mit der Schauspielerin, die Übereinstimmung ihrer Verwandlungen, die Bühnenhaftigkeit einer Anmut, die zu jeder Laune ein Gesicht stellt, zum Bewusstsein gebracht hat. Sie ging den Schicksalsweg aller zeitwidrigen Urkraft“3).
Und anlässlich ihres 30. Todestages erschien in der „Fackel“ das folgende Gedicht und das hier abgebildete Photo von Annie Kalmar:
„Annie Kalmar
Gestorben in Hamburg am 2. Mai 1901“
(Aus „Worte in Versen“ IX)
Sie schwand dahin, dass man ihr Bild ersehne.
Mit ihrer süßen Stimme brach ein Stern,
unirdisch mild, und klang so hoch und fern.
In ihrem Aug war alle Erdenwonne.
Als ob es gestern war, dass eine Sonne
hinging in Nacht, noch gnadet sie dem Blick,
und einen Schimmer ließ sie ihm zurück,
die Abschied in die Dunkelheit genommen.
Wie war Natur an jenem Tag beklommen,
da sie den heißen Atem aus der Not
befreite und so still zu stehen gebot
dem Herzen, das sich an ihr selbst verbrannte.
Wie sich die Schöpfung in dem Bild erkannte,
so brannte sie danach, zurückzunehmen
das Wunderwerk aus einer Welt von Schemen,
um es erbarmungsvoller zu umarmen.
Denn Lust ist ohne Dank, und ohn Erbarmen
Vernichtet sie die Schönheit, ihr gespendet,
erstickt den Glanz, der Menschliches geblendet,
und kehrt befriedigt in die Niederungen.
Mir ist ein Lied von irgendwann verklungen,
ein Himmelskörper hat mit letzter Gnade
beschienen diese dunklen Erdenpfade,
und jenem Glück erweis ich Dank und Denken.
Und immer wieder will es hin mich lenken,
wo es gelandet, nah bei einem Hafen,
und herbstlich war’s, bald wird die Welt
entschlafen,
und krank erklang die Stimme der Sirene.
Und wie ich mich in ferne Tage wähne,
so ist’s, als ob’s Antonias Stimme sei,
sie schwand dahin mir bis zum Tag des Mai,
und alle Pracht versank für eine Träne 1).
Aber auch auf einen anderen Schriftsteller übte Annie Kalmar eine besondere Anziehungskraft aus, den Wiener Dichter Peter Altenberg, der das Wesen und die Begabung Annie Kalmars ebenfalls verstand und das ihr geschehene Unrecht anprangerte. Unter der Überschrift „Wie Genies sterben“ veröffentlichte Karl Kraus den folgenden Brief von ihm, der zugleich eine provokante These zur männlichen und weiblichen Genialität enthält, die hier aber nicht weiter erörtert werden kann:
„Lieber Karl Kraus!
Ich unterschätze manche der Uebel nicht, die Ihre Feder bekämpft. Doch sind sie alle greifbar, an den einzelnen Repräsentanten kenntlich, und der ahnungslose Wanderer zwischen socialen Klüften ist gewarnt.
Aber fassen wir einmal die Gesellschaft, der all Ihr Hassen gilt, dort an, wo sie ihre furchtbare Macht in täglichem Zerstörungswerk bethätigt, wo sie nicht materielle und geistiger Werte corrumpiert, sondern der Allgemeinheit das Beste, Tiefste und Nothwendigste, was diese hat, entzieht: den genialen, vollkommenen Menschen, diese Ausnahme aller Ausnahmen auf Erden, in die Welt gesetzt, um alle Anderen aus ihren Alltäglichkeiten zu reißen und ihnen einen unausgeführten Plan Gottes endlich in seiner letzten Vollendung zu zeigen!
Denken Sie sich, böse, egoistische Menschen hätten Beethoven in seinem dreiundzwanzigsten Jahre ermordet, körperlich und seelisch in Fetzen gerissen, zugrunde gerichtet … Er durfte aber leben, zum Wohle der Menschheit, weil er als Mann seine heilige Organisation vor Schaden bewahren konnte. Sie wissen, dass es meine vom ‘Normalmenschen’ als krankhafte Schrulle verspottete Lebensanschauung ist, der geistigen Genialität des Mannes die ästhetische Genialität der Frau vollkommen gleich zu stellen und ebenso die Wirkung dieser auf die Schar derjenigen, die in Unzulänglichkeiten dahinvegetieren verurtheilt sind. So wie sich die gesamte Menschheit gleichsam zu unerhörten Mütterlichkeiten, Zartheiten und Rücksichten organisiert dem geistigen Genie gegenüber, so hat sie dieselben zärtlichen und mütterlichen Betreuungspflichten gegen dieses gottähnliche Wesen ‚schöne und anmuthreiche Frau’!
Was ich hier schreibe, ist Grabschrift und Anklageschrift.
Die schönste, genialste, sanfteste, kindlichste Frau, die wie ein Gnadengeschenk des Schicksals in diese hintrauernde Welt der Unvollkommenheiten gesendet ward, hat sterben müssen. Das Licht von Anmuth und süßer Menschlichkeit, das von ihr ausging, wurde nicht – oder zu spät – von treuen, zärtlichen, brüderlichen, väterlichen Händen erhalten; die schändliche, feige Satanskralle infamer Lebenskünstler durfte die Lichtvolle in die dunklen Abgründe reißen. Im labilen Gleichgewichte einer künstlerischen Persönlichkeit, brauchte sie desto drängender an jedem Tage und zu jeder Stunde tausend und abertausend selbstlose Helfer und Betreuer! Statt ihrer findet eine solche Ahnungslose, Unbewusste, an Abgründen ewig Heitere – Meuchelmörder, von sich selbst und mit ihrem eigenen bösen Reichthum gedungen! Sie bleiben immer wach, wachend über ihr eigenes Wohl, ewig bewusst, bewusst ihrer schurkischen Lüste, während die Kindliche, unbewacht, unbewusst, zum Opfer wird. –
Ist denn nie in diesen grausamen Augenblicken ein väterliches Wort, eine freundschaftliche Gebärde da? Nirgends ein Weiser, der mahnend seine Stimme erhebt, nirgends ein Guter, der eine Betäubte auf starkem Ritterarm von hinnen trüge?
Alle Künstler, alle Adelmenschen sollten trauern ob solcher Mordthat.
Die Zerstörkräfte des geselligen Wien hatten ihre Wirkung gethan, und es konnte dem künstlerischen Edelmann in der Fremde nicht mehr glücken, eine Begabung zu jenen Höhen zu geleiten, auf welchen ihrer die Verkörperung einer Adelheid, Rahel und Katharina harrte.
Fern der Stadt, welche sie als Künstlerin nie erkannt, sondern zum schönen Schaustück für alle, so da unwürdig sind, zu schauen, erniedrigt hat, ist sie, dreiundzwanzig Jahre alt, gestorben. Und die Stadt, die sie nie verstand und nie erkannte, wusste ihr nichts anderes nachzurufen, ihr, der allen Künstlermenschen Theuersten, als eine schäbige Berechnung der angeblich von ihr ‘gesammelten’, also zusammengescharrten Juwelen. Nun, der Inhalt dieser Schmuck-Notizen war erfunden und einer Lebensführung angepasst, die die Ihre nicht war und nicht sein konnte und die dem gütigen Naturell fernlag, das nicht zum Sammeln, nur zum Verlieren geschaffen war!
Wie merkwürdig, oh verblendete irregeleitete Welt! Alles Edelrassige, Exceptionelle hütest du sonst mit tausend Vorsichten und Kräften, hegst zitternd Sorge um aussterbende Bisons im Lithauerwalde, um Pferd und Hund und ihre Rein-Erhaltung. Nur für dieses zarte gebrechliche Wesen ‘genial-schöne Frau’ hat die Erde keine Sorgfalt! Es vergehe, werde zerstört und sterbe hin!
Lieber Karl, ich habe diese Grab- und Anklageschrift Ihnen eingehändigt, weil Sie allein – es war in den ersten Heften der ‘Fackel’ – die Erkenntnis fanden, dass diese Edle, Helle, Kindliche mehr sei als ‘Augenweide für ein Stammpublicum von Lebemännern’. Sie starb in Schönheit – das heißt, unter der völligen Theilnahmslosigkeit der beteiligten Mörderkreise.
Annie Kalmar, ruhe in Frieden!
Peter Altenberg, Wien im Juni 1911 1).
Die Wiener Presse dagegen verfolgte Annie Kalmar bis über ihren Tod hinaus mit Verleumdungen, die sie aufgrund der Ehrenbeleidigungsklage, die Annie Kalmars Mutter zum Schutze des Andenkens ihrer Tochter beim Wiener Landgericht einbrachte, öffentlich widerrufen mussten. Karl Kraus griff auch diesen Vorgang in der „Fackel“ auf und verknüpfte die Darstellung des Falles mit der Forderung nach einer Reform des Pressewesens. Zu den Artikeln der „Wiener Caricaturen“ und des „Neuen Wiener Journals“ über Annie Kalmar schreibt er: „Die Betrachtungsweise der beiden Herren unterschied sich nur in einem Punkte. Das ‚Witzblatt’! Wartete den Tod des Fräuleins Kalmar ab, um, gestützt auf die in der ganzen Ehrenpresse damals verbreitete Lüge über den Schmuckreichthum, den die Künstlerin hinterlassen haben sollte, ein paar dreckige Bemerkungen anzubringen. Ein Hamburger Rechtsanwalt berichtigte eines von den vielen Blättern, die da geglaubt hatten, die Kunde von dem Juwelennachlaß einer Schauspielerin der Oeffentlichkeit nicht vorenthalten zu dürfen: in der ‚Arbeiter-Zeitung’ vom 18.Juni 1901 sah man den Millionenschmuck der Reporterphantasie zu einem Gesamtvermögen von 15.000 Mark zusammenschrumpfen. Die Glosse der ‚Wiener Caricaturen’ war nicht zu berichtigen; sie konnte nur mit der Hundepeitsche oder mit dem Strafparagraphen beantwortet werden. Der Chroniqueur des ‚Neuen Wiener Journal’ aber aspirierte schon vor dem Tode der Künstlerin auf eine der beiden Behandlungsarten. Er scheute sich nicht, am 13. April 1900 in die Reihe der schmackhaften Untertitel, die den Inhalt der samstäglichen Rubrik ‚Hinter den Coulissen’ verlockend machen, die Worte aufzunehmen: ‚Die Kalmar im Sterben’, und er erörterte unter dieser ‚pikanten’ Spitzmarke, wie, wo und warum sich dieses Sterben vollziehe. Die Gemeinheit des Inhaltes war hier vielleicht noch von der Niedrigkeit übertroffen, die den Zeitpunkt der Publication so passend gewählt hatte“ 1).
Sowenig wie Karl Kraus mit dem Platz einverstanden war, den man Annie Kalmar im Leben zugewiesen hatte, so wenig war er es offenbar mit dem auf dem Ohldorfer Friedhof. Über ihre Umbettung schreibt Alfred von Berger am 15. Dezember 1903:
„Hochverehrter Herr Kraus!
Soeben kehre ich von der Umlegung der irdischen Reste unserer armen Annie Kalmar zurück und berichte Ihnen darüber, die Finger noch steif von der ausgestandenen Kälte. Die tote Annie hat diesen Akt posthumer Treue still über sich ergehen lassen, wie sie in ihrem Leben zu ihrem Unglück fast alles mit sich geschehen ließ. Ich hatte gehofft, dass außer mir Fräulein Balling und Detlev von Liliencron der Ceremonie beiwohnen würden: Eine Hetäre, ein Dichter und ein Theaterdirektor. Wenn noch Sie dabeigewesen wären, der noch die Tote so liebt, wie der dritte Bursch in Uhlands Lied der Wirtin Töchterlein, so hätte die Szene selbst, auch ohne Worte und Reime, ein Gedicht gegeben, wie es kein Moderner besser machen könnte. Leider war ich allein dabei, aber der Theaterdirektor vereinigt ja in sich etwas von den drei Typen, die fehlten. Als ich morgens nach Ohlsdorf fuhr, bedeckte eine dünne Schneeschicht die Erde; sie löste sich aber bald in braunen Koth. Auf der Fahrt fiel mir weiter draußen in Barmbeck ein kleines Haus auf, über dessen Thüre zwei Inschriften in großen Lettern zu lesen waren. Sie lauteten: ‚Die Kunst schafft Seligkeiten’ und ‚Die Weisheit ist das Glück’.
Auf dem Friedhof erfuhr ich, dass der Sarg schon in’s Grab übertragen ist und um zehn Uhr versenkt werden soll. Ich fand das Grab nicht gleich, und ein Arbeiter, dem ich den Friedhofszettel vorwies, sagte mir: Dort hinter dem Rosengarten. Annie hat nun einen schönen Platz, von Fichten und Föhren umstanden. Der Aufseher sagte: er hat den ganzen Tag Sonne. Das heißt, er würde sie haben, wenn die Sonne schiene. Der Sarg schwebte auf Seilen und Brettern über der tiefen Grube. Den Metallgriffen und der schwarzen Holztruhe, die den Metallsarg umschließt, wars’s anzumerken, dass die Erde schon energisch begonnen hat, diesen zarten Bissen zu verdauen. Auf dem Metallschilde am Kopfende der Truhe las ich den Namen Annie’s. Wir warteten einige Minuten, dann wurde der Sarg herabgesenkt. Er stand ein klein wenig schief, worauf ihn der Aufseher zurechtrücken ließ. Ich warf drei Schaufeln Erde hinab, auch in Ihrem Namen, sie schlugen dumpf und hohl auf die bauchige Holztruhe auf. Der Aufseher meinte, die Verwesung sei noch nicht ganz vollendet, und wenn die Leiche nicht in einem Metallsarg steckte, würde Verwesungsgeruch zu verspüren sein. Ich erwartete, etwas wie die Kirchhofszene in ‚Hamlet’ werde zu folgen, aber der Aufseher brach, während drei Arbeiter das Grab zuschaufelten, mit einem ‚Guten Morgen, mein Herr’ rasch ab. Ich gab jedem der Arbeiter eine Mark und ging. Die tiefe Stille auf dem Friedhof that mir wohl, und ich wäre gerne länger geblieben, aber ich musste zur Probe. Das Monument wird heute Nachmittag aufgestellt. Seine Stücke lagen und lehnten neben dem Grab. Annie’s Marmoranlitz [Karl Kraus hatte durch den Wiener Bildhauer Richard Tautenhayn ein Grabmal aus Gravensreuther Syenit mit einem Flachrelief aus Laaser Marmor und einem Rosenornament aus gelbem Unterberger Marmor erstellen lassen mit der Aufschrift: ‚Annie Kalmar / 14. September 1877 / 2. Mai 1901 / Ihrem Andenken gewidmet von / Karl Kraus’] sah ihrer Umbestattung lieblich lächelnd zu. Mit diesem holden Bilde schließe ich diesen traurigen Bericht.
Mit herzlichen Grüßen Ihr Berger“ 2).
Der Dichter Detlev von Liliencron besuchte das Grab der Schauspielerin häufig. Am 30. Dezember 1903 berichtet er nach Wien:
„Lieber Karl Kraus,
heut Morgen war ich in Ohlsdorf. Es war ein fürchterlicher Hamburger Nebeltag. Der ‚gelbe’ Nebel. Auf dem Friedhof war kein Mensch. Kein Sarg wurde getragen. So dass es schien, als gäbe es keine Gestorbenen mehr. Und auch keine Lebenden mehr.
Ich weilte lange an dem lieben Grabe. Das Relief ist herrlich. Es lagen eine Menge Kränze davor. Und noch so frisch, als wenn sie erst einige Tage gelegen hätten. Ich senkte zwei frische Rosen darauf. Eine von Ihnen und eine von mir. Und sende Ihnen von Ihrer Rose einige Blätter in diesem Briefe. Rosenblätter der Liebe. Das Grab liegt still und an ernster Stelle. Hinter ihm ist ein großer Blumenplatz, den man erst durchschreiten muss.
Ihr alter Detlev Liliencron“ 2).
Text: Brita Reimers
Zitate:
[1] Karl Kraus (Hrsg): Die Fackel. Wien 1899-1936.
[2] Ernst Schönwiese (Hrsg.): Das Silberboot. Zeitschrift für Literatur. Heft 1. 5. Jg. 1951.
[3] Karl Kraus: Traumtheater. Wien, Leipzig 1924.
Irmgard Kanold
Bildhauerin



9. 2. 1915
Hamburg
–
25.4.1976
Hamburg
Hamburg
–
25.4.1976
Hamburg
Mehr erfahren
Die Tochter der Hamburger Kaufleute Max Kanold und Johanna Kanold, geb. Hartmann, wuchs im Eilbektal auf. Ihre erste zweijährige Ausbildung erhielt sie bei dem Hamburger Bildhauer und Keramiker Jürgen Heinrich Block. Mitte der 1930er Jahre studierte sie bei Edwin Scharff an der Akademie Düsseldorf und anschließend noch einmal eineinhalb Jahre an der Münchner Akademie der bildenden Künste bei dem Bildhauer Bernhard Bleeker. Dann ließ sie sich zeitlebens in ihrer Heimatstadt Hamburg nieder.
In Hamburg hatte sie ein Atelier in der Hamburger Straße 192, unter der U-Bahnbrücke Dehnheide, wo sie zeitweilig in Kriegs- bzw. Nachkriegszeiten auch wohnte, bis sie Ende der 1950er Jahre mit ihrer Mutter nach Hamburg Groß-Flottbek zog. Die dortige Wohnung in der Waitzstr. 59 blieb auch nach dem Tod der Mutter im Jahre 1966 Irmgard Kanolds Zuhause. Dort lebte sie bis zu ihrem Tod 1976. Auch ihr langjähriger Lebensgefährte, der Astrologe Eggers, wohnte dort.
Nach dem Tod des Vaters übernahmen Mutter - als Geschäftsführerin/Inhaberin - und Tochter - als Prokuristin - die im Handelsregister eingetragene Firma Max Kanold - Chemische Fabrik, die beim Tod der Mutter 1966 auf ihre Tochter als Firmeninhaberin überging. Welche Aktivitäten damals noch in der Firma entfaltet wurden, ist wie so vieles im Lebenslauf von Irmgard Kanold leider nicht bekannt.
Die zeitlebens unverheiratet gebliebene Bildhauerin war Vegetarierin und folgte ihrem Lebensgefährten als Anhängerin der von diesem vertretenen Hohlraumtheorie.
Der Verbleib ihrer Werke ist weitgehend unbekannt. Irmgard Kanold nahm zwischen 1938 und 1941 an mehreren Gemeinschaftsausstellungen Hamburger Künstlerinnen und Künstler im Kunstverein Hamburg mit Plastiken (Portraits) in Bronze, Kunststein, Holz und Gips teil. Sie unterrichtete Privatschüler und gestaltete Altar- und Krippenfiguren sowie Grabsteine; so auch ihren im Garten der Frauen aufgestellten Grabstein, einen trauernden Schwan.
Erni Kaufmann
(geb. Handke)
Musikerin in Damenorchestern



3.6.1906
Witten a. d. Ruhr
–
11.10.1957
Hamburg
Witten a. d. Ruhr
–
11.10.1957
Hamburg
Mehr erfahren
Die musikalische Begabung der Geschwister Erni und Adolf Handke (31.12.1908-11.3.1975) zeigte sich schon früh. Ernis Bruder Adolf war von 1938 bis 1952 Erster Waldhornist im Berliner Philharmonischen Orchester, Ernis musikalische berufliche Laufbahn begann und endete in Hamburg in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Erni Handke spielte professionell Geige, Saxophon und Akkordeon. Sie trat u. a. mit dem Deutschen Damenorchester der Lissi vom Uhlenborn und mit dem Meistergeiger Ernesto Arcari aus Neapel im "Damen Attraktions-Orchester" auf. Sie gastierte mit den Damenorchestern u. a. im Haus Vaterland in Hamburg, einem "Konzertkaffee" mit Varieté und einem Tanzraum, in dem internationale Tanzkapellen auftraten. Das Repertoire der Damenorchester reichte von der U- bis zur E-Musik. Neben ihren künstlerischen Fertigkeiten hatten die Musikerinnen jung, schlank, elegant und äußerst attraktiv zu sein, um den Geschmack des zahlungskräftigen männlichen Publikums zu befriedigen. Gleichzeitig mussten die Musikerinnen, um in diesem Unterhaltungsgenre bestehen zu können, gefestigte Persönlichkeiten sein, die über selbstbewusste künstlerische Souveränität gepaart mit einem dezenten bescheidenen weiblichen Auftreten verfügten. Letzteres war von besonderer Überlebensnotwendigkeit, um sich gegen die immer wieder aufkommenden Verdächtigungen der Prostitution zu erwehren. Ihre sittsame, unschuldige
und elegante-dezente Erscheinung wurde auch durch ihre Kleidung unterstrichen. Oft traten die Musikerinnen in Trachten oder in langen weißen ohne raffinierten Schnitt geschneiderten Kleidern auf.
Männliche Musiker sahen in den Damenorchestern oft eine Konkurrenz, die sie mit unlauteren Mitteln bekämpften. So unterstellten sie den Damen sittenloses und unmoralisches Verhalten, diskriminierten ihre Tätigkeiten als minderwertige künstlerische Arbeit und traten für ein Verbot von Damenkapellen ein. Doch solche Verbote konnten nicht durchgesetzt werden, denn die Damen galten als eigenes Unterhaltungsgenre mit einer besonderen Anziehungskraft, die männliche Musiker nicht aufweisen konnten. Allerdings schlug sich dies weder in der Höhe der Gagen noch in der gesellschaftlichen Anerkennung der Musikerinnen nieder. So schrieb Erni Kaufmann am 12. März 1927 aus Köln an ihre Familie: "Wir ziehen weit umher in der Welt, spielen und singen für weniges Geld. Menschen sieht in uns keiner. Zigeuner."
Die Engagements lagen zwischen einigen Wochen und mehreren Monaten. In jeder neuen Stadt, in der die Musikerinnen auftraten, mussten sie bei der Meldebehörde vorstellig werden und ihr Führungszeugnis vorweisen. Auch kam es vor, dass sie ihren sittlich-moralischen Lebenswandel zu erklären hatten.
Im April 1942 heiratete Erni Handke Schorsch Kaufmann. Er wurde 1945 als Soldat im Zweiten Weltkrieg getötet.
und elegante-dezente Erscheinung wurde auch durch ihre Kleidung unterstrichen. Oft traten die Musikerinnen in Trachten oder in langen weißen ohne raffinierten Schnitt geschneiderten Kleidern auf.
Männliche Musiker sahen in den Damenorchestern oft eine Konkurrenz, die sie mit unlauteren Mitteln bekämpften. So unterstellten sie den Damen sittenloses und unmoralisches Verhalten, diskriminierten ihre Tätigkeiten als minderwertige künstlerische Arbeit und traten für ein Verbot von Damenkapellen ein. Doch solche Verbote konnten nicht durchgesetzt werden, denn die Damen galten als eigenes Unterhaltungsgenre mit einer besonderen Anziehungskraft, die männliche Musiker nicht aufweisen konnten. Allerdings schlug sich dies weder in der Höhe der Gagen noch in der gesellschaftlichen Anerkennung der Musikerinnen nieder. So schrieb Erni Kaufmann am 12. März 1927 aus Köln an ihre Familie: "Wir ziehen weit umher in der Welt, spielen und singen für weniges Geld. Menschen sieht in uns keiner. Zigeuner."
Die Engagements lagen zwischen einigen Wochen und mehreren Monaten. In jeder neuen Stadt, in der die Musikerinnen auftraten, mussten sie bei der Meldebehörde vorstellig werden und ihr Führungszeugnis vorweisen. Auch kam es vor, dass sie ihren sittlich-moralischen Lebenswandel zu erklären hatten.
Im April 1942 heiratete Erni Handke Schorsch Kaufmann. Er wurde 1945 als Soldat im Zweiten Weltkrieg getötet.
Bertha Keyser
Schwester der Straßenmission



24.6.1868
Maroldsweisach
–
21.12.1964
Hamburg
Maroldsweisach
–
21.12.1964
Hamburg
Mehr erfahren
Als Kind einfacher gläubiger Eltern wurde Bertha Keyser am 24. Juli 1868 in Maroldsweisach in Bayern geboren. Sie verstand sich als eine Person, die die Menschen auf Jesus Christus hinweisen wollte.
Bertha Keyser hatte vier Geschwister. Ihr Vater, ein Schmiedemeister, starb, als sie noch sehr jung war. Da er Geld aufgenommen hatte, um sich Maschinen zu kaufen, kam die Familie nach seinem Tod in finanzielle Nöte. Haus und Werkstatt mussten verkauft werden, Bertha und ihre Schwester wurden zu Verwandten nach Nürnberg geschickt, wo Bertha in der Bäckerei des Onkels mit anpacken musste.
Als 1885 ihre Mutter mit den anderen Kindern nach Nürnberg nachzog, fing Bertha an, in einer Spielzeugfabrik zu arbeiten, um etwas zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Einige Zeit später ging sie nach Wien und im Alter von 34 Jahren (1902) nach England, wo sie als Hausangestellte tätig war. Dort lernte sie die Arbeit der Heilsarmee kennen und wusste von nun an, wozu sie berufen war. Entsprechend interpretiert sie in ihren Lebenserinnerungen auch einen verpassten Rendezvoustermin: Gerade im Begriff, sich zu ihrem Rendezvous aufzumachen, verspürte sie beim Treppenhinabsteigen heftige Schmerzen im Knie. Sie war nicht mehr in der Lage weiterzugehen und konnte somit auch nicht am Treffpunkt erscheinen. Dies deutete sie als Fingerzeig Gottes. Denn um für "den Heiland zu sein - musste ich frei sein von menschlichen Liebesbanden" (Bertha Keyser: Mutter der Heimatlosen. Nach der Lebensbeschreibung von Schwester Bertha Keyser, bearb. von Barbara Lüders. Hamburg o.J.) schreibt sie in ihren Lebenserinnerungen. Wegen des Beinleidens wurde ihr die Stelle im Haushalt gekündigt - und nun wieder ein Fingerzeig: Wie durch ein Wunder wurde nicht nur das Knie geheilt, in einer Zeitungsannonce las sie: Reisebegleiterin nach Berlin gesucht. Sie nahm die Stelle an. Durch diese Tätigkeit sah sie viel von der Welt, so war sie z.B. in Amerika, in der Schweiz und in Frankreich.
Als die Mutter starb, gab Bertha diese Tätigkeit auf, denn nun brauchte sie nicht mehr für ihre Mutter zu sorgen, war, wie sie schreibt, "frei, ohne Rücksicht auf Geld meine ganze Kraft in den Dienst des Herrn zu stellen" (ebenda.). Sie arbeitete in verschiedenen Einrichtungen wie z.B. in einem Diakonissenhaus, später auch als Aufseherin in einem Frauengefängnis. In dem Diakonissenkrankenhaus blieb sie ein Jahr, "trat aber doch wieder aus, weil ich hier nicht fand, wonach sich mein Herz sehnte. Ich hatte mich ohne Entgelt zur Verfügung gestellt, und es war mir nicht schwer gefallen, in dieser Zeit den Kranken mit Rat und Tat zu helfen. Aber dass ich die kleinen materiellen Wünsche meiner Patienten nicht erfüllen konnte und durfte, bedrückte mich sehr. Es war mir einfach ein Bedürfnis, meine Kranken gelegentlich durch Früchte oder kleine Erfrischungen zu erfreuen", schrieb sie in ihren Lebenserinnerungen (ebenda.). So nahm Bertha Keyser wieder eine bezahlte Stelle an, diesmal als Kammerzofe bei einer französischen Gräfin. Aber bald zog es sie wieder zu einer sozialen Tätigkeit, und so kündigte sie und ging in die Wohnviertel den Armen von Paris. Dort lebte sie in einer Kürschnerwerkstatt, half beim Fellespannen und Pelznähen, malte Bilder und verkaufte sie für fünf Francs das Stück. Als das Angebot kam, als Aufseherin in einem Frauengefängnis zu arbeiten, griff sie zu. Sie führte einige Neuerungen ein, sang mit den Mädchen, betete und hielt mit ihnen Andacht. Als einige Mädchen sich nicht den Hausgesetzen entsprechend verhielten, hatte die Gefängnisleitung eine Handhabe, Bertha Keysers Neuerungen zu verbieten. "Alle Freiheiten, die man ihnen gewährt hatte, wurden wieder abgeschafft. Mir wurde untersagt, die Gefangenen in mein Zimmer zu lassen oder mit ihnen Andacht zu halten. Das schien mir ebenso schlimm, wie lebendig begraben zu sein." (ebenda.) Bertha Keyser kündigte und wurde nun Erzieherin in einem Mädchenheim im Elsass. Sie hatte eine ähnliche Arbeit zu verrichten wie im Frauengefängnis, denn in diesem Heim lebten die "tief Gefallenen". Aber auch hier blieb sie nicht lange: "Wir hatten eines Tages eine Unmenge Wäsche, die die Mädchen kaum bewältigen konnten. Ich sah die Erschöpfung der Mädchen und ließ deshalb die Wäsche einmal weniger spülen als sonst. Sie war trotzdem weiß und schön geworden. Ein Mädchen hatte es jedoch der Leiterin hinterbracht. Es kam zu einer scharfen Auseinandersetzung und ich verließ das Heim." (ebenda.)
Bertha Keyser ging zur Heilsarmee zurück. Als sie jedoch zur Kadettenschule nach Berlin geschickt werden sollte und all die Verordnungen las, die sie von nun an einzuhalten hatte, distanzierte sie sich von der Heilsarmee.
Sie zog nach Nürnberg und baute dort im Armenviertel eine eigene Missionsarbeit auf. Als Motor für diese aufopfernde Tätigkeit nannte sie ihren starken Glauben an Gott.
Nach 3 1/2Jahren übergab sie ihre Arbeit der Landeskirche und ging 1913, im Alter von 45 Jahren, nach Hamburg. Der damalige Leiter der Strandmission hatte sie mehrmals darum gebeten. "Spät nachts kam ich im September 1913 nach Hamburg und in dem Missionsheim Richardstraße an. Nach kurzer Rast ging ich schon morgens um 5 Uhr mit in die üblen Kneipen und Keller der Niedernstraße, wo sich die Elendesten und Verkommensten einfanden. Welche Schreckensszenen erlebte ich in dieser gefährlichsten Gegend von Hamburg. Doppelposten von Schutzleuten waren im Abruzzenviertel, wie man diese Gegend nannte, aufgestellt. Ein einzelner Beamter hätte sich der Übergriffe des lichtscheuen Gesindels nicht erwehren können. Ich ließ mich aber nicht abschrecken und ging ganz allein durch die Straßen. Über den Arm hatte ich mir ein paar Würste gehängt und nahm einige Brote mit. So bewaffnet ging ich in die Spelunken und Kellerwirtschaften. Nach meinem Gefühl muss der Hungrige zuerst gesättigt werden, ehe man ihm das Wort Gottes bringen kann. Ich setzte mich daher auf irgendeine Kiste und verteilte meine Gaben. Die Hungrigen hockten sich um mich herum, und während sie aßen, erzählte ich ihnen von meiner Heimat und von meiner Mutter. So schloss ich ihre Herzen auf. Sie fingen nun an zu klagen, dass sie nur zerrissene Schuhe und Lumpen hätten und nicht wüssten, wie sie aus diesem Jammer herauskommen sollten, denn in diesem Zustand könnten sie sich wirklich nicht auf die Straße wagen. So blieben sie in den Kellern hocken und waren dem Laster und der Verzweiflung preisgegeben. Nachdem diese Armen Vertrauen zu mir gefasst hatten, konnte ich sie darauf hinweisen, dass die Sünde der Menschen Verderben ist, und Jesus Christus auch ihr Heiland sein will. Manchem dieser Verlorenen habe ich das Rettungsseil zuwerfen dürfen und sie mit Gottes Hilfe aus leiblichem und seelischem Elend herausgeführt." (ebenda.)
Bertha Keyser arbeitete ehrenamtlich im Missionshaus in der Richardstraße. Ihre Arbeit wurde jedoch neidisch und missgünstig beäugt. Sie schreibt dazu: "Leider hat meine Anteilnahme für die Insassen bei einigen christlichen Geschwistern Anstoß erregt. Aber ich konnte nicht anders. Daher fasste ich den Entschluss, ein eigenes Missionswerk zu beginnen." (ebenda) Bertha Keyser lag es sehr am Herzen, ihre Schützlinge alle gleich zu behandeln, was in den Missionshäusern, in denen sie gearbeitet hatte, nicht die übliche Praxis gewesen war.
Die ersten Räume für ihre Mission fand sie am Alten Steinweg 25. Hier gründete sie die Mission unter der Straßenjugend: "Zuerst wusch ich den Kindern Gesicht und Hände, denn niemand kümmerte sich um sie."(ebenda) Außerdem betreute sie Obdachlose. Im Laufe der Jahre kamen Armenspeisungen, Straßengottesdienste, Gefängnis- und Krankenbesuche sowie die Betreuung von Prostituierten hinzu.
Finanziert wurde ihre Arbeit ausschließlich durch Spenden reicher Kaufleute, Firmen oder Privatpersonen, die sie persönlich aufsuchte.
Im letzten Kriegsjahr zog sie mit ihrer Mission in ein größeres Haus an den Neuen Steinweg. Hier gab es einen großen Saal für Versammlungen, und es konnten ca. 60 Menschen über Nacht untergebracht werden. Aber obwohl Bertha Keyser ihre Obdachlosen angewiesen hatte, beim Verlassen des Hauses barfuß die Treppe hinunterzugehen, beschwerten sich nach einiger Zeit die Hausbewohner über den starken Betrieb. Bertha Keyser wurde daraufhin verboten, Obdachlosen Übernachtungsmöglichkeiten zu bieten. Sie musste ausziehen und fand in der Jugendherberge in der Böhmkenstraße ein neues Zuhause mit 80 Betten.
In den Jahren der Wirtschaftskrise bekamen Bertha Keysers Feldküchenspeisungen großen Zulauf. 1924 schaffte sie deshalb drei Feldküchen an. Damit fuhren sie und ihre Mitarbeiter täglich zum Großneumarkt, zur Reeperbahn und zum Rathausmarkt. 600 Portionen warmer Mittagskost wurden zeitweilig täglich verteilt. 1925 musste Bertha Keyser auf Drängen des Hauswirtes auch die Räume in der Böhmkenstraße verlassen. Sie fand eine neue Bleibe in der Winkelstraße, nahe der Musikhalle, wo die Mission nun ein ganzes Haus für sich besaß.
Wer bei ihr wohnte, musste arbeiten, Sachspenden abholen oder Gelegenheitsarbeiten auf dem von der Mission gepachteten Holzhof ausführen.
1927 konnte Bertha Keyser endlich auch ein Frauenobdachlosenheim einrichten und zwar in der Winkelstraße 7, in einem Haus neben dem Missionsheim. Das Heim erhielt den Namen "Fels des Heils". Für die obdachlosen Männer fand Bertha Keyser in der Stiftstraße, in der Nähe des Hauptbahnhofes, ein neues Domizil.
Bei vielen Anwohnern und Behörden stieß Bertha Keysers Tätigkeit auf keine freundliche Zustimmung. Aber sie ließ sich nicht beirren. Sie verstand sich als Mutter der Heimatlosen. 1929 gründete sie im Alter von 61 Jahren einen "Evangelisch-Sozialen Hilfsverein e. V.". Die Beiträge der Mitglieder dienten zur Unterstützung der Mission.
Über Bertha Keysers politische Einstellung während der Zeit des Nationalsozialismus und ihre Arbeit in dieser Zeit schreibt Claudia Tietz in ihrem Aufsatz über Bertha Keyser: "Bertha Keyser, die von sich sagte, sich nie um Politik gekümmert zu haben, galt dem Hamburger Bischof Franz Tügel (1888-1946), einem profilierten Deutschen Christen, als politisch zuverlässig und der gleichgeschalteten Landeskirche treu ergeben. Auskunft über ihre politische Einstellung geben auch die erhaltenen Exemplare der 'Posaune des St. Michael'. Während die Beiträge des nationalsozialistisch geschulten Parteimitglieds Adolph Bohlen von Propaganda geprägt sind, äußert sich Bertha Keyser weit zurückhaltender: Blind für die deutsche Kriegspolitik, die Verfolgung von ethnischen Gruppen und den Rassenwahn befürwortet sie die von den Nationalsozialisten angeblich betriebene Stärkung der Familie, der öffentlichen Moral und des Christentums. Dabei könnte Bertha Keysers Zurückhaltung sowohl politisch durch ihre öffentlich bekannte, langjährige Sympathie für die evangelikalen Bewegungen am Rand beziehungsweise außerhalb der Landeskirche begründet gewesen sein, welche im 'Dritten Reich' zum Teil verboten waren, als auch theologisch durch ihr Verständnis Jesu Christi. Der Glaube an ihn als den alleinigen Schöpfer, Herrscher und Erlöser schloss für sie andere totalitäre Herrschaftsansprüche aus: Während der nationalsozialistischen Diktatur konnte Bertha Keyser ihre Missionsarbeit nur unter Schwierigkeiten fortsetzen: 1933 musste das Männerheim in der Stiftstraße aus ungenannten Gründen geräumt werden. Als die Winckelstraße im gleichen Jahr in eine geschlossene Bordellstraße umgewandelt wurde, musste auch das Mädchenheim 'Fels des Heils' ausziehen. Eine neue Unterkunft fand die 'Volks- und Straßenmission' im ehemaligen Quartier des zerschlagenen kommunistischen 'Internationalen Seemannsklubs' in der Rothesoodstraße 8. Das Haus wurde am Reformationstag 1934 mit einer Festansprache von Pfarrer Albrecht Jobst (1902-1945) von St. Michaelis über die sieben Bitten des Vaterunsers eingeweiht. Wie in den bisherigen Heimen, befanden sich auch in der Rothesoodstraße die Schlafsäle der Obdachlosen, die Versammlungs- und Arbeitsräume, die Kantine, das Büro und Bertha Keysers Privatwohnung unter einem Dach. Um Arbeitsplätze für die Heimbewohner zu schaffen, wurde in der Nicolaistraße 4 ein Holzhof für 20 Beschäftigte eingerichtet. Wegen Problemen mit dem Heimleiter bestand das neue Missionshaus nur kurze Zeit. Bertha Keyser zog in eine gegenüberliegende Ladenwohnung und führte während des Krieges mit einem kleinen Mitarbeiterkreis in Kellern und Bunkern Armenspeisungen durch." (Claudia Tietz: Die Straßenmissionarin Bertha Keyser (1868-1964), in: Das 19. Jahrhundert. Hamburgische Kirchengeschichte in Aufsätzen, Teil 4. Herausgegeben von Inge Mager. Hamburg: Hamburg University Press, 2013, S. 434f. (Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs, Band 27).
Als 1943 ihr dreistöckiges Heim "Fels des Heils" den Bomben zum Opfer fiel, suchte sie, nun bereits 75 Jahre alt, sofort wieder nach einem geeigneten Haus. 1945 konnte sie schließlich ein kleines Zimmer in der Langen Reihe Nr. 93 mieten. Dort wohnte sie mit Schwester Anna Bandow, die Bertha Keyser unterstützte und die zahlreichen "Essensgäste" beköstigte. Außerdem erklärten sich mehrere Großküchen bereit, für Bertha Keysers Missionswerk mitzukochen. In verschiedenen Schulen konnte die Mission Feierstunden mit anschließender Speisung abhalten. Bei Hamburger Firmen und Kaufleuten erwarb sich Bertha Keyser viele Freunde, Gönner und Spender, die sie regelmäßig mit Sach und Geldspenden unterstützten. Eine große Hamburger Kaffeefirma zahlte die Miete ihrer kleinen Ladenwohnung im Bäckerbreitergang Nr. 7, die sie bewohnte, seit sich die Nachbarschaft aus der Langen Reihe über sie beschwert hatte.
Aber sie wurde vom manchem auch argwöhnisch beäugt. Pastor Lüders schrieb in einem Nachwort zu Bertha Keysers Lebenserinnerungen: "Mag sein, dass die Sozialbehörde, das Arbeitsamt oder auch die Kriminalpolizei zürnend auf dies Sammelbecken Obdachloser sehen. Asoziale Elemente würden durch ihre Speisungen nach Hamburg gezogen oder in Hamburg gehalten, Arbeitsscheue in ihrer Faulheit bestärkt, weil sie bei ihr unentgeltliche Hilfe und Beköstigung finden. Gewiss, sie will das Gute, aber ihre Gutmütigkeit wirkt sich zuweilen als Schade aus. So wird von manchen geurteilt." (ebenda.) Aber: "Schwester Bertha ist für viele Heruntergekommene die letzte Chance zu einem neuen Lebensanfang.(...) Diese für manche letzte Auffangstation hat aber doch Ungezählten im Laufe der Jahre einen neuen und guten Lebensanfang gegeben. Dass die Arbeit eben nicht nur Menschlichkeit zum Motiv hat, sondern die Liebe Christi, die Menschen mit Christus verbinden und dadurch retten möchte, gibt ihr den besonderen Charakter. Welche Behörde kann sich so seelsorgerlich um die Bedürftigen kümmern?" (ebenda.)
Zu ihrer Beerdigung am 29. Dezember 1964 fanden sich über 500 Trauergäste aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten ein. Mit Hilfe der Hamburger Verkehrsbetriebe, die kostenlose Busse vom Bäckerbreitergang zum Friedhof Ohlsdorf einsetzten, war es auch vielen ihrer "Sperlinge Gottes" möglich, am langen Trauerzug teilzunehmen. Bertha Keyser blieb vielen Hamburgerinnen und Hamburgern in Erinnerung. 1983, 18 Jahre nach ihrem Tod, wurde nach ihr der "Bertha-Keyser-Weg" im Hamburger Stadtteil St. Pauli benannt. Ein Jahr später initiierte die Patriotische Gesellschaft die Enthüllung einer Gedenktafel im Bäckerbreitergang. Anlässlich ihres 25. Todestages wurde ein von Hans Petersen geschaffenes Gemälde von ihr in die Krypta des Michels gehängt. Dort verblieb es lange Zeit.
Text: Dr. Rita Bake
Annie Kienast
Betriebsrätin, Mitbegründerin der DAG, Mitglied (SPD) der Hamburgischen Bürgerschaft



15.9.1897
in Hamburg
–
3.9.1984
in Hamburg
in Hamburg
–
3.9.1984
in Hamburg
Mehr erfahren
Annie Kienast wuchs mit fünf Geschwistern im Arbeitermilieu auf - der Vater war Kesselschmied, die Mutter ein ehemaliges Dienstmädchen, beide SPD-Mitglieder. Annie Kienasts Bildungslaufbahn entsprach dem eines Mädchen aus der Arbeiterschicht: Volksschule, danach Lehre als Textil-Verkäuferin.
Geprägt durch ihre Eltern wurde auch Annie Kienast Mitglied der SPD und der Gewerkschaft. Da war sie 21 Jahre alt. Ihr Hauptinteresse galt der Gewerkschaftsarbeit. Ihr widmete sie ihre ganze Aufmerksamkeit und Kraft - und blieb unverheiratet. Aktiv war sie im Zentralverband der Handlungsgehilfen (ZdH) bzw. dessen Nachfolgeorganisation, dem Zentralverband der Angestellten (ZdA). 1918 war Annie Kienast eine der Organisatorinnen des ersten Streiks der Hamburger Warenhausangestellten. Darüber erzählte sie: "Es war einige Tage nach dem 9. November 1918. In Schlagzeilen zeigte das Flugblatt eine öffentliche Versammlung für die Waren- und Kaufhausangestellten an:
Wir fordern bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen!
Wir fordern gleiche Bezahlung für Frauen und Männer!
Wir fordern 7-Uhr Ladenschluß am Sonnabend!
Referent: Kollege John Ehrenteit
Die Versammlung fand im großen Saal des Gewerkschaftshauses in Hamburg statt.
Tausende von Einzelhandelsangestellten sind damals diesem Ruf gefolgt. Natürlich, ich war auch dabei (...) Eine Tarifkommission wurde gewählt. Die Versammlung zog sich bis nach Mitternacht hin, vor Begeisterung hatte ich es nicht gemerkt (...).
Es ging ans Werk. Der Tarifvertragsentwurf wurde ausgearbeitet und beraten. Wir zogen in die Verhandlung mit den Arbeitgebern; aber kein Baum fällt auf den ersten Hieb. Darum wurde verhandelt, vertagt und berichtet. Kurzfristig wurde die Kollegenschaft abermals zur Versammlung eingeladen; einmütig wie in der ersten stand sie zur Sache! Die Arbeitgeber erklärten, wenn unsere Forderungen Wirklichkeit würden, müßten sie ihre Geschäfte schließen. Im Februar 1919 wurden die Verhandlungen abgebrochen. Als letztes gewerkschaftliches Kampfmittel wurde der Streik beschlossen und angewandt, er dauerte sechs Tage.
Die Einmütigkeit und Entschlossenheit führten zum Erfolg: bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen, gleiche Bezahlung für Frauen und Männer, 7-Uhr-Ladenschluß am Sonnabend. Das war mein erstes gewerkschaftliches Erlebnis (...)." (Anni Kienast: Wie ich Gewerkschafterin wurde. In: Frauenstimme der DAG, Nr. 9, September 1955.)
Die Quittung für ihr Engagement war: Annie Kienast wurde entlassen, konnte aber gleich darauf bei der ZdA-Hamburg anfangen zu arbeiten, wo sie von 1919 bis 1921 tätig war. Zwischen 1921 und 1933 arbeitete sie dann als Warenhausverkäuferin im Konsum-, Bau- und Sparverein "Produktion" und war gleichzeitig Mitglied des Gesamtbetriebsrates der "Produktion" und damit eine der wenigen Frauen, die in einem Hamburger Betriebsrat saßen. Als Gewerkschafterin kümmerte sie sich sehr um die Probleme der erwerbstätigen Frauen.
Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen: "verlor [ich] 1933 meine Stellung und war dann bis 1935 arbeitslos. Dann bekam ich eine Anstellung bei der Defaka. 1943 mußte ich zum Chef kommen. Der Chef hat gesagt: 'Frau Kienast, zum zweiten Mal wird mir mitgeteilt, sie halten in der Kantine kommunistische Reden!' Ich sag: 'Nein' und daß das eine Verleumdung ist. Aber das war außerordentlich gefährlich! Ein Jahr später mußte ich wieder zum Chef. Da war die Vertreterin von der NS-Frauenschaft gestorben, und da sagt der Chef zu mir: 'Wir möchten gerne, daß Sie die Stellung von Valeska übernehmen'. Das müßt Ihr Euch mal vorstellen, wie schwer das ist, sich da rauszuwinden! Da hab ich gesagt: 'Das tut mir furchtbar leid, das kann ich nicht. Ich muß meine armen, alten Eltern betreuen. Ich muß abends immer sofort nach Hause.' 'Nein, das brauchen sie nicht, wir stellen ihnen 'ne Frau, die immer bei ihren Eltern ist'. Und da sage ich: 'Nein, das tut mir furchtbar leid, aber das würden meine Eltern nicht durchhalten.' Und da bin ich so davon gekommen." (Frauen im Faschismus. Frauen im Widerstand, Hamburger Sozialdemokratinnen berichten. Hrsg. von der AsF Hamburg o.J.
Vgl.: Anni Kienast: Die Frau und die Gewerkschaft. In: Gewerkschaftliche Frauenzeitung vom 19.7.1921.)
Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Annie Kienast im Oktober 1946 in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt, der sie bis Oktober 1949 angehörte. In der Nachkriegszeit war sie Mitbegründerin der DAG und gehörte bis 1957 dem Hauptvorstand an.
Geprägt durch ihre Eltern wurde auch Annie Kienast Mitglied der SPD und der Gewerkschaft. Da war sie 21 Jahre alt. Ihr Hauptinteresse galt der Gewerkschaftsarbeit. Ihr widmete sie ihre ganze Aufmerksamkeit und Kraft - und blieb unverheiratet. Aktiv war sie im Zentralverband der Handlungsgehilfen (ZdH) bzw. dessen Nachfolgeorganisation, dem Zentralverband der Angestellten (ZdA). 1918 war Annie Kienast eine der Organisatorinnen des ersten Streiks der Hamburger Warenhausangestellten. Darüber erzählte sie: "Es war einige Tage nach dem 9. November 1918. In Schlagzeilen zeigte das Flugblatt eine öffentliche Versammlung für die Waren- und Kaufhausangestellten an:
Wir fordern bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen!
Wir fordern gleiche Bezahlung für Frauen und Männer!
Wir fordern 7-Uhr Ladenschluß am Sonnabend!
Referent: Kollege John Ehrenteit
Die Versammlung fand im großen Saal des Gewerkschaftshauses in Hamburg statt.
Tausende von Einzelhandelsangestellten sind damals diesem Ruf gefolgt. Natürlich, ich war auch dabei (...) Eine Tarifkommission wurde gewählt. Die Versammlung zog sich bis nach Mitternacht hin, vor Begeisterung hatte ich es nicht gemerkt (...).
Es ging ans Werk. Der Tarifvertragsentwurf wurde ausgearbeitet und beraten. Wir zogen in die Verhandlung mit den Arbeitgebern; aber kein Baum fällt auf den ersten Hieb. Darum wurde verhandelt, vertagt und berichtet. Kurzfristig wurde die Kollegenschaft abermals zur Versammlung eingeladen; einmütig wie in der ersten stand sie zur Sache! Die Arbeitgeber erklärten, wenn unsere Forderungen Wirklichkeit würden, müßten sie ihre Geschäfte schließen. Im Februar 1919 wurden die Verhandlungen abgebrochen. Als letztes gewerkschaftliches Kampfmittel wurde der Streik beschlossen und angewandt, er dauerte sechs Tage.
Die Einmütigkeit und Entschlossenheit führten zum Erfolg: bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen, gleiche Bezahlung für Frauen und Männer, 7-Uhr-Ladenschluß am Sonnabend. Das war mein erstes gewerkschaftliches Erlebnis (...)." (Anni Kienast: Wie ich Gewerkschafterin wurde. In: Frauenstimme der DAG, Nr. 9, September 1955.)
Die Quittung für ihr Engagement war: Annie Kienast wurde entlassen, konnte aber gleich darauf bei der ZdA-Hamburg anfangen zu arbeiten, wo sie von 1919 bis 1921 tätig war. Zwischen 1921 und 1933 arbeitete sie dann als Warenhausverkäuferin im Konsum-, Bau- und Sparverein "Produktion" und war gleichzeitig Mitglied des Gesamtbetriebsrates der "Produktion" und damit eine der wenigen Frauen, die in einem Hamburger Betriebsrat saßen. Als Gewerkschafterin kümmerte sie sich sehr um die Probleme der erwerbstätigen Frauen.
Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen: "verlor [ich] 1933 meine Stellung und war dann bis 1935 arbeitslos. Dann bekam ich eine Anstellung bei der Defaka. 1943 mußte ich zum Chef kommen. Der Chef hat gesagt: 'Frau Kienast, zum zweiten Mal wird mir mitgeteilt, sie halten in der Kantine kommunistische Reden!' Ich sag: 'Nein' und daß das eine Verleumdung ist. Aber das war außerordentlich gefährlich! Ein Jahr später mußte ich wieder zum Chef. Da war die Vertreterin von der NS-Frauenschaft gestorben, und da sagt der Chef zu mir: 'Wir möchten gerne, daß Sie die Stellung von Valeska übernehmen'. Das müßt Ihr Euch mal vorstellen, wie schwer das ist, sich da rauszuwinden! Da hab ich gesagt: 'Das tut mir furchtbar leid, das kann ich nicht. Ich muß meine armen, alten Eltern betreuen. Ich muß abends immer sofort nach Hause.' 'Nein, das brauchen sie nicht, wir stellen ihnen 'ne Frau, die immer bei ihren Eltern ist'. Und da sage ich: 'Nein, das tut mir furchtbar leid, aber das würden meine Eltern nicht durchhalten.' Und da bin ich so davon gekommen." (Frauen im Faschismus. Frauen im Widerstand, Hamburger Sozialdemokratinnen berichten. Hrsg. von der AsF Hamburg o.J.
Vgl.: Anni Kienast: Die Frau und die Gewerkschaft. In: Gewerkschaftliche Frauenzeitung vom 19.7.1921.)
Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Annie Kienast im Oktober 1946 in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt, der sie bis Oktober 1949 angehörte. In der Nachkriegszeit war sie Mitbegründerin der DAG und gehörte bis 1957 dem Hauptvorstand an.
Clara Klabunde
geb. Genter
Erste Gerichtspräsidentin der Bundesrepublik Deutschland



30.12.1906
Hamburg
–
7.7.1994
Hamburg
Hamburg
–
7.7.1994
Hamburg
Mehr erfahren
Geboren, als Tochter von Bertha Genter, Lehrerin in Hamburger Strafanstalten und des Kaufmanns Hermann Genter gehörte Clara Klabunde zu den wenigen Frauen, die in einem seit Jahrhunderten den Männern vorbehaltenen Beruf tätig wurden: der Juristerei. In diesem Metier brachte sie es zur ersten Gerichtspräsidenten der Bundesrepublik Deutschland.
Im Alter von 20 Jahren schrieb sich Clara Klabunde an der juristischen Fakultät der Universität Hamburg ein, studierte bis 1929 Jura und wurde dann Referendarin in der Hamburger Justizverwaltung. Im März 1933 bestand sie die juristische Staatsprüfung und beantragte die Zulassung als Anwältin. Seitdem arbeitete sie 19 Jahre als Rechtsanwältin in Hamburg. Durch die Reichsrechtsanwaltsordnung von 1935 wurde
Clara Klabunde als Frau, die als Anwältin arbeitete, beruflich eingeschränkt. Sie ging eine gemeinsame Sozietät mit dem Rechtsanwalt Wilhelm Drexelius ein und vertrat in der NS-Zeit politisch Verfolgte des NS-Regimes.
1934 heiratete sie den Journalisten Erich Klabunde, den sie während des Studiums an der Universität im Sozialistischen Studentenbund kennengelernt hatte. Erich Klabunde musste nach 1933 seine Arbeit aus politischen Gründen aufgeben. Nach dem Ende des Nationalsozialismus wurde er Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion und später Bundestagsabgeordneter.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Clara Klabunde ehrenamtliches Mitglied einer Reihe von Gremien. Im Rahmen der Entnazifizierungsverfahren war sie als Spruchkammervorsitzende, außerdem im beratenden Ausschuss für das Pressewesen, im Vorstand des Hamburgischen Anwaltsvereins und der Vereinigung weiblicher Juristen und Volkswirte tätig.
1950 starb Erich Klabunde. Clara Klabunde ging in den Staatsdienst und wurde Richterin. Neben dieser Tätigkeit fungierte sie 25 Jahre als Verfassungsrichterin am Hamburgischen Verfassungsgericht und gehörte außerdem lange dem Vorstand des Hamburgischen Richtervereins an.
1952 wurde Clara Klabunde zur Vorsitzenden am Landesarbeitsgericht Hamburg und zur Landesarbeitsgerichtsdirektorin berufen und war entscheidend bei der Entwicklung des damals nur teilweise kodifizierten Arbeitsrechts beteiligt, welches den sozialen Gegebenheiten der Nachkriegszeit angepasst werden musste.
Am 1. September 1966 wurde Clara Klabunde als erste Frau in der Bundesrepublik Deutschland zur Präsidentin des Landesarbeitsgerichtes ernannt - unter der Dienststellenbezeichnung "Der Präsident". Mit dieser Ernennung würdigte der Senat ihre Kenntnisse auf dem Gebiet des Arbeitsrechts. Fünf Jahre wirkte sie als Gerichtspräsidentin und trat 1971 in den Ruhestand.
Für ihre Verdienste um das Rechtswesen erhielt Clara Klabunde die Medaille für Treue Arbeit im Dienste des Volkes in Silber.
Katharina Klafsky
gesch. Liebermann, verw. Greve, verh. Lohse
Opernsängerin

Katharina Klafsky als Brünnhilde in Wagners "Ring der Nibelungen", Hamburger Stadttheater um 1890


19.9.1855
St. Johann/Ungarn
–
22.9.1896
Hamburg
St. Johann/Ungarn
–
22.9.1896
Hamburg
Mehr erfahren
Geboren als Tochter eines Flickschusters, fiel sie schon als Kind durch ihre besondere stimmliche Begabung auf und sang ab dem achten Lebensjahr im Kirchenchor. Eine Gesangsausbildung konnten ihre Eltern nicht bezahlen. Nach dem Tod ihrer Mutter 1870 zog Katharina Klafsky nach Wien. Ihr Wunsch war es zu singen. Da sie weder Geld hatte noch einflussreiche Menschen kannte, arbeitete sie zunächst als Kindermädchen. Ihr Dienstherr, dem ihre Begabung aufgefallen war, schickte sie 1873 zu einem Organisten, der sie nach kurzer Ausbildung an den Direktor der "Komischen Oper" in Wien empfahl, wo sie eine Anstellung als Choristin bekam. Später erfuhr sie eine Gesangsausbildung bei Mathilde Marchesi, der später bedeutendsten Gesangspädagogin des 19. Jhds.
Die Ausbildungskosten wurden durch Spenden "hoher Persönlichkeiten" getragen. Zwei Jahre später brach Katharina Klafsky die Ausbildung ab. Freunde hatten ihr eingeredet, sie habe einen solchen "Schulzwang" nicht nötig. Doch schnell bereute sie diesen Schritt, denn sie fand kein Engagement als Solistin und musste weiterhin als Choristin arbeiten. Am Salzburger Stadttheater hatte sie erste kleine Erfolge. Doch wieder brach sie ab. Sie heiratete den Kaufmann Liebermann, zog mit ihm nach Leipzig, wo sie zwei Söhne gebar. Nach einiger Zeit trennte sich das Ehepaar, Katharina Klafsky nahm ein Engagement am Leipziger Stadttheater an. Dort sang sie im Chor und übernahm kleinere Rollen. Wieder stellten sich kleine Erfolge ein, so dass sie schließlich größere Aufgaben bekam. Im Oktober 1879 sang sie ihre erste große Wagner-Partie, die Venus in "Tannhäuser". Als ihr Chef, Operndirektor Angelo Neumann, im Sommer 1882 ein Tournee-Ensemble gründete, um Wagners "Ring der Nibelungen" in ganz Europa aufzuführen, nahm er auch Katharina Klafsky mit. Sie sang vornehmlich kleinere Rollen. Während einer Tournee durch Italien im Mai 1883 erkrankte sie an einer schweren Venenentzündung und an Malaria. Nach viermonatigem Krankenhausaufenthalt begann sie, obwohl noch schonungsbedürftig, aus finanziellen Gründen wieder zu arbeiten. Für die Spielzeit 1883/84 nahm sie ein Engagement bei Angelo Neumann an, der inzwischen Direktor am Bremer Stadttheater geworden war. Vorher war sie nach Leipzig gereist, um ihre Kinder abzuholen, die dort in Pflege waren. Auch in Bremen war sie nur für mittlere Rollen vorgesehen. Doch durch den Tod der Primadonna Hedwig Reicher-Kindermann und durch Misserfolge anderer Kolleginnen erhielt sie die Chance, große Partien zu singen. Ihre Leonore in Beethovens "Fidelio" wurde ein Riesenerfolg - der Durchbruch war geschafft. 1886 nahm Katharina Klafsky ein festes Engagement am Hamburger Stadttheater an und blieb hier mit Unterbrechungen bis zu ihrem Tod. 1887 heiratete sie ihren Kollegen, den Bariton Franz Greve, und bekam eine Tochter. Katharina Klafsky hatte nun große nationale und internationale Erfolge. Nach dem Tod ihres Mannes 1892, heiratete sie drei Jahre später den Kapellmeister am Hamburger Stadttheater, Otto Lohse. Im selben Jahr brach sie ihren Vertrag mit dem Stadttheater und verließ Hamburg für eine ausgedehnte Tournee durch die USA, wo sie in über 20 Städten erfolgreich auftrat. Nach ihrer Rückkehr vereinbarte sie mit dem Stadttheater, einen Teil der Saison in Hamburg, den anderen in den USA zu verbringen. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Am Abend des 11. Septembers 1896, als sie die Leonore im "Fidelio" gesungen hatte, bekam sie heftige Beschwerden: eine Gehirngeschwulst. Sie starb an den Folgen der Operation.
Hilde Knoth
Schauspielerin



25.11.1888
Posen
–
23.12.1933
Hamburg
Posen
–
23.12.1933
Hamburg
Mehr erfahren
"Keine wahre Liebe zur Kunst ohne heiße Liebe zur Menschlichkeit". Diesen Sinnspruch schrieb Hilde Knoth ihren zahlreichen Verehrern ins Stammbuch. Es war das Motto, unter das sie ihr Leben gestellt hatte.
Als Hilde Knoth noch ein Kind war, starb ihr Vater, der sich gewünscht hatte, dass seine Tochter den Beruf der Lehrerin ergreifen würde. Hilde wollte aber lieber Schauspielerin werden. Und da ihre Mutter dem zustimmte, absolvierte Hilde in Berlin eine Ausbildung im dramatischen Fach. Finanzielle Unterstützung erhielt sie durch die "kaiserliche Schatulle". Hildes Laufbahn begann in Coburg-Gotha am dortigen Hoftheater. Es folgte Hannover (Hoftheater) und dann Hamburg, wo sie 1915 als Mitglied des Hannoverschen Hoftheaters ein Gastspielengagement annahm. Mit der Luise in "Kabale und Liebe" sollte sie ihre Eignung für das Schauspielhaus beweisen und
hatte Erfolg. Sie erhielt einen mehrjährigen Vertrag. Hilde Knoth blieb bis 1929 am Schauspielhaus. Sie spielte in den Anfangsjahren die sentimentale und tragische Liebhaberin, so das Gretchen in "Faust" und das Käthchen von Heilbronn. Mit den Jahren wurde Hilde Knoth eine, wie es in der "Volksbühne" von 1954 stand, "erschütternde Hebbelsche Klara, eine klassisch-edle Iphigenie, eine schalkhaft-lustige Porzia, eine ergreifende Maria Stuart, eine menschlich-warme Minna von Barnhelm." Im modernen Spielplan zeigte sie sich als elegante Salon- und Konversationsschauspielerin. Zu ihren Lieblingsrollen gehörten neben der Königin Anna in Scibes "Ein Glas Wasser" Ibsens "Nora" und die Solveig in "Peer Gynt". In Hamburg wurde Hilde Knoth der umjubelte Schwarm des Publikums.
Seit 1929 war Hilde Knoth mit dem Hamburger Arzt Walter Kliewe verheiratet und wurde Mutter eines Kindes. Bedingt durch ein Brustleiden konnte Hilde Knoth nur noch selten als Schauspielerin auftreten. So begann sie, für den Hörfunk zu arbeiten. Sie sprach z. B. in dem Hörspiel "Struensee-Prozeß" die Karoline Mathilde und die Gemahlin Gustav Adolfs in "Der Tag von Lützen".
Hilde Knoth erhielt für ihre schauspielerischen Leistungen viele Auszeichnungen und Ehrungen, zuletzt den " Marie Seebach-Ring", den 1866 Königin Emma der Niederlanden der Schauspielerin Marie Seebach geschenkt hatte. Der Ring bestand aus zwei rechteckigen Smaragden und vielen Brillanten.
Hilde Knoth starb im Alter von 45 Jahren an ihrem Brustleiden.
Marie Kortmann
Lehrerin, Leiterin des Vereins zur Förderung von Frauenbildung und Frauenstudium



20.5.1851
–
16.10.1937
Hamburg
16.10.1937
Hamburg
Mehr erfahren
Eine verwandtschaftliche Nachfahrin der Frauen der 48er Revolution ist Marie Kortmann, die Tochter Pauline Kortmanns, der Schwester Emilie Wüstenfelds. (Siehe zu Emilie Wüstenfeld in der Rubrik: Erinnerungsskulptur)
Marie Kortmanns starke Prägung durch Mutter und Tante wird an ihrem beruflichen und frauenpolitischen Werdegang deutlich. Dennoch hatte sie auch etwas „Eigenes“ - sie war nicht nur die „Nichte von....“
Kaum 17jährig, unterrichtete sie bereits an der 1867 gegründeten gewerbeschule für Mädchen (siehe dazu historischer Grabstein von Marie Glinzer im Garten der Frauen). Dort wirkte sie ganz in der Tradition ihrer Tante - brachte aber auch ihre persönliche Komponente ein. So nutzte sie ihr Zeichentalent und ihre musikalische Begabung, um an der Gewerbeschule und später auch an privaten Mädchenschulen Kunstunterricht zu geben, und ging mit ihren Schülerinnen zu den von Alfred Lichtwark und Anna Wohlwill (historischer grabstein im Garten der Frauen) angeregten Führungen in die Kunsthalle. Sie war aber nicht nur als Lehrende tätig, sondern beteiligte sich mit Zeichnungen an den „Jahrbüchern der Gesellschaft Hamburgischer Kunstfreunde“.
Ganz im Sinne ihrer Mutter, die lange Zeit für den Frauen-verein zur Unterstützung der Armenpflege gearbeitet hatte, widmete sich auch Marie Kortmann diesem Verein und wurde 1914 dessen Vorsitzende.
Der Tradition ihrer Tante verpflichtet waren folgende Aktivitäten Marie Kortmanns: Im Herbst 1895 hatte die Ortsgruppe Hamburg des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins eine Abteilung für Frauenbildung geschaffen, deren Leiterin Marie Kortmann von 1898 bis zu ihrer Ablösung im Jahre 1907 war. Ziel dieser Abteilung war es, das Mädchenbildungswesen zu erweitern. So gelang ihr an hamburgischen Privatschulen die Einführung des Unterrichts in Hygiene, Pädagogik und in Grundzügen der Volkswirtschaftslehre. Keinen Erfolg bei der Schulbehörde hatte die Abteilung für Frauenbildung mit ihrer Forderung nach Einrichtung von Latein- und Mathematikkursen zur ersten Vorbereitung auf die Oberlehrerinnenprüfung. Deshalb richtete die Abteilung für Frauenbildung selbst solche Kurse ein. Besonders engagierte sich die „Abteilung“ für die Einführung der staatlichen Mädchenfortbildungsschule. Auch versuchte sie, den Staat dazu zu bewegen, Haushaltsschulen mit Tages- und Abendkursen für Volksschulmädchen einzurichten. Da dieser Plan aussichtslos erschien, eröffnete 1898 die Abteilung für Frauenbildung selbst die erste Haushaltungsschule in der Sachsenstraße, der bald darauf eine weitere in Eimsbüttel folgte.
Von der Abteilung für Frauenbildung wurde auch die Gründung von Gymnasialklassen für Mädchen angeregt. Da die „Abteilung“ jedoch nicht selbst solche Klassen einrichten konnte, rief die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins einen Zweigverein - den Hamburgischen Verein zur Förderung von Frauenbildung und Frauenstudium - ins Leben, der sich ganz diesem Anliegen widmete. Er wurde im Dezember 1900 unter dem Vorsitz von Marie Kortmann mit 50 Mitgliedern gegründet.
Marie Kortmann als Vorsitzende dieses Vereins wirkte ganz entscheidend bei der Gründung eines Realgymnasiums für Mädchen mit. Ostern 1901 wurde die erste Obertertia mit 22 Schülerinnen eröffnet und im folgenden Jahr die Weiterführung der Klassen nach dem Lehrplan des Realgymnasiums beschlossen. Die ehrenamtliche Leitung übernahm Professor Dr. Gustav Wendt. Unter seiner Leitung wuchs die Schule zu einer zunächst fünf-, später sechsstufigen Schule an. 1917 wurde sie in ein humanistisches Gymnasium umgewandelt. Marie Kortmann war maßgeblich bei der Beschaffung der Gelder für dieses Unternehmen beteiligt. 1904 bewilligten der Senat und die Bürgerschaft für drei Jahre 5.000 Mark. Da das Geld aber nicht ausreichte, „steckte“ um Ostern 1906 der damals amtierende Schulrat Schober den wenigen nicht in die Ferien verreisten Vorstandsdamen des Vereins, dass nun die Zeit günstig sei, weiteren Staatszuschuss zu beantragen. Die Kassenführerin des Vereins entschloss sich, auf eigene Verantwortung 15.000 Mark zu fordern. Als der Vorstand davon erfuhr, erschrak er zutiefst. Aber die Mutige hatte Glück - die Behörde stimmte dem Anliegen zu.
Als Marie Kortmann ihren siebzigsten Geburtstag feierte, schrieb eine Hamburger Zeitung über die Jubilarin: „Sie wirkte an der Gründung des Hamburger Mädchen-Gymnasiums mit und wurde die treu sorgende Hausmutter desselben. All den verschiedenen Jahrgängen Hamburger Studentinnen, die in dem trefflichen Lehrinstitut zum Abitur geführt wurden, wird die Liebe und Hingebung von Marie Kortmann unvergesslich bleiben, mit der es ihr gelungen war, die Anstalt unter anfangs recht schwierigen Verhältnissen mit den notwendigen Lehrmitteln auszurüsten und ihr stets ein angenehmes, heimisches Gepräge zu verleihen.“
Marie Kortmann blieb unverheiratet und lebte mit Dora und Hanna Glinzer (siehe: historischer Grabstein von Hanna Glinzer im Garten der Frauen), die ebenfalls unverheiratet blieben, zusammen im Juratenweg 4. Dora Glinzer führte für ihre Schwester Hanna und für Marie Kortmann den gemeinsamen Haushalt.
Noch im Alter von 76 Jahren schrieb Marie Kortmann eine umfassende Biographie über ihre Tante Emilie Wüstenfeld: „Emilie Wüstenfeld. Eine Hamburger Bürgerin.“
Text: Dr. Rita Bake
Literatur:
Zeitungsberichte von Mai 1992, Zeitungsausschnittsammlung Staatsarchiv Hamburg
Helene Bonfort: Marie Kortmann am 20. Mai achzigjährig, in: Wir Hausfrauen von Hamburg, Nr. 11, 5.6.1931.
Charlotte Kramm
(geb. Goldschmidt, verh. Maertens)
Schauspielerin am Thalia-Theater



15.3.1900
Berlin
–
21.11.1971
Hamburg
Berlin
–
21.11.1971
Hamburg
Mehr erfahren
Schon während ihrer Pensionatsjahre in Dresden nahm Charlotte Kramm, die Tochter eines Berliner Arztes, Schauspielunterricht und gelangte über die Bühnen in Kattowitz, Stralsund und Erfurt nach Braunschweig. Dort lernte sie ihren Kollegen Willy Maertens kennen, den sie einige Jahre später in Hamburg heiratete. Willy Maertens hatte seit 1927 ein Engagement am Thalia-Theater, und auch Charlotte Kramm gelang der Sprung in die Hamburger Theaterlandschaft. Nach einem erfolgreichen Gastspiel als Maria Stuart wurde sie 1928 ans {{nolink: Altonaer Stadttheater} engagiert und blieb dort bis 1931. Sie ging dann zu Erich Ziegel an die Kammerspiele im Lustspielhaus und folgte ihm, als er 1932 die Leitung des Thalia-Theaters übernahm. 1935 war für Charlotte Kramm alles zu Ende. Während ihr Mann weiterspielen durfte, erhielt sie aufgrund ihrer jüdischen Abstammung ein Auftrittsverbot, das einem Hausverbot gleichkam. Nicht einmal an Premieren, bei denen ihr Mann mitwirkte, durfte sie teilnehmen. So blieben ihr nur die Generalproben, bei denen sie ungesehen durch die Hintertür in den dunklen Zuschauerraum schlüpfte. Den so genannten Ariernachweis nicht erbringen zu können und damit weit schlimmeren Gefahren ausgesetzt zu sein, ersparte ihr die alte Bekanntschaft ihres Mannes mit dem Präsidenten der Reichstheaterkammer, Ludwig Körner. Er versah die schriftliche Aufforderung zum Beleg ihr arischen Abstammung mit dem Vermerk: „Bereits erledigt. Körner“ 2). Die Ungewissheit, ob diese Akte jemals wieder geöffnet würde, hing dennoch wie ein Damoklesschwert über dem Paar. Über den allgemeinen Geist, der damals am Thalia-Theater herrschte, urteilt Willy Maertens: „Es waren einige Leute im Betrieb, die nicht sehr erfreulich waren. Aber an sich war es – ich möchte sagen – eine Oase. Gewiss, wir hatten auch einige wilde Nazis. Doch die kamen nicht so zur Geltung“ 1). Wie Willy Maertens empfanden viele das Theater als eine Art Freiraum. Die Zwiespältigkeit dieser Haltung zeigt Klaus Mann in seinem Roman „Mephisto“ an Gustaf Gründgens.
Die zehnjährige Zwangspause war für Charlotte Kramm nicht nur menschlich, sondern auch künstlerisch ein tiefer Einschnitt. Als sie 1945, mit 45 Jahren, auf die Bühne des Thalia-Theaters zurückkehrte, musste sie den Sprung in ganz neue, ihrem Alter gemäße Rollen tun. Sie spielte jetzt Frauen- und Muttergestalten, oft an der Seite ihres Mannes, der 1945 die Leitung des Thalia-Theaters übernommen hatte. Als unvergessen werden immer wieder ihre Leistungen im „Tod des Handlungsreisenden“, der „Erbin“, dem „Fall Winslow“, „Familienparlament“, „Ich, erste Person Einzahl“ und in verschiedenen Ibsen-Inszenierungen genannt. Zu ihrem 60. Geburtstag spielte sie die Mutter in Nikolaj Ostrovskijs „Tollem Geld“, eine Rolle, die, wie ihr Mann Willy Maertens meinte, alle die liebenswerten Bühnenfiguren in sich schloss, denen Charlotte Kramm auf dem Theater zum Leben verholfen hatte. Bis zu ihrem Lebensende stand Charlotte Kramm auf der Bühne. Noch einen Tag vor ihrem Tod spielte sie die Modistin in Nikolai Erdmanns Komödie „Der Selbstmörder“. Charlotte Kramm starb am 21. November 1971, vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes, durch plötzliches Herzversagen. Der gemeinsame Sohn trat in die Fußstapfen der Eltern.
Text: Rita Bake
Zitate:
[1] Erich Lüth: Hamburger Theater 1933 bis 1945. Ein theatergeschichtlicher Versuch. Hrsg. Von der Theatersammlung der Hamburgischen Universität 1962.
[2] zur Person Ludwig Körner und seine Stellung in der NS-Zeit sowie seine antisemitische Einstellung siehe in dem Buch von Nicolas Finke und Reinhard Marheinecke: Karl May auf der Bühne. Bd.1. Frühe Inszenierungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie Freilichtbühnenerfolge von Rathen über Ratingen bis Bad Segeberg. Bamberg, 2021, S. 19-24.
Philine Leudesdorff-Tormin
Schauspielerin



1.12.1892
Düsseldorf
–
19.4.1924
Hamburg
Düsseldorf
–
19.4.1924
Hamburg
Mehr erfahren
Wenn man sich über Philine Leudesdorff-Tormin informiert, stößt man auf ein Phänomen. Verwandte, Freunde, Kollegen und Theaterkritiker sprechen übereinstimmend über sie, als habe es sich bei ihr nicht um ein reales, sondern um ein Geschöpf aus dem Reich der Poesie gehandelt. Die Romantiker phantasierten solche Wesen eines frühen kind- und naturhaften harmonischen Zustandes der Menschheit und stellten sie dem grauen Alltagsmenschen gegenüber. „Im Tiefsten ein Kind“, schrieb Erich Kühn im „Hamburgischen Correspondenten“ am 19.4.1925 in einer Hommage anlässlich es ersten Todestages von Philine Leudesdorff-Tormin. Ihre mädchenhafte Erscheinung, der zierliche Körper, die dunklen Locken und die lebendigen braunen Augen unterstützen diesen Eindruck noch. Auch muss ihre dunkle melodische Stimme einen eigentümlichen Reiz gehabt haben.
Geboren in Düsseldorf, aufgewachsen in Dresden mit vier Geschwistern, verließ das junge Mädchen ein halbes Jahr vor dem Abschluss die Schule und nutzte die eingesparte Zeit, um das Theaterinstitut Senff Georgi in Dresden zu besuchen. Das halbe Jahr genügte, und eine rasante Karriere begann.
Nach einem Engagement am Sommertheater in Merseburg ging Philine Leudesdorff-Tormin im Winter nach Liegnitz, wo sie Carl Clewing vom Königlichen Schauspielhaus in Berlin entdeckte und von ihr so hingerissen war, dass er sie allen namhaften Agenten empfahl. Sie erhielt daraufhin 1912 einen Dreijahresvertrag an der Neuen Wiener Bühne, den sie vorzeitig aufkündigte, um 1914 nach Prag an das Deutsche Landestheater zu gehen. Auch Prag verließ sie vor der Zeit und kam 1915 ans Thalia-Theater in Hamburg.
Überall ließ man sie nur mit Bedauern ziehen, die junge Naive, die hinter ihrem Lachen und der Ausgelassenheit stets einen Hauch von Ernst spüren ließ, der ihrer Darstellung Wahrhaftigkeit verlieh und sie nie ins Sentimentale des „süßen Mädels“ abgleiten ließ: „Ihr Spiel war harmonische Wechselwirkung von Instinkt und Geschmackskontrolle. Sie hatte die kecke Sicherheit des Wurfes, aber hinter jeder Äußerung stand ein feiner Takt, ein angeborener künstlerischer Anstand als Grenzweiser. …. Selbst, die übermütigsten Kapriolen der Künstlerin, die possenhaften Eulenspiegeleien hatten irgendwie geistigen Hintergrund“, 1) schrieb der Freund Otto Reiner. Neben den vielen heiteren spielte sie hin und wieder auch ernste Rollen wie die Hedwig in Ibsens „Wildente“ oder die Eleonore in Strindbergs „Ostern“, über die das „Prager Tageblatt“ urteilte: „Ganz vortrefflich war Fräulein Tormin als Eleonore; wie sie mit weit geöffneten Augen ins Zimmer trat, wie sie, mit ins Innerste bohrenden Tönen, das Gespräch mit Benjamin führte, wie sie naiv und überintellektuell zugleich war, das war eine Leistung, die man der Darstellerin nicht vergessen wird, und die hoffen lässt, dass man in ihr eine Schauspielerin von geistigem Rang gefunden hat“ 1).
In einer Art Selbstvergewisserung schrieb Philine Leudesdorff-Tormin 1914 über ihren Beruf: „O, es ist schön, sich hinein zu leben in große Aufgaben; Freuden auszudrücken, großes Leiden mitzuerleben. Man wird im Innern reich und erfüllt von Schönheit. Man lernt nachdenken über Welt und Menschen und lernt viel Menschliches verstehen, worüber die Leute vielleicht nur verständnislos die Köpfe schütteln. Und wann man sich im Leben mit den Menschen, ihrem Wesen, ihren verschiedenen Charakteren beschäftigt, so strebt man auch vor allem danach, alles menschlich auf der Bühne darzustellen. Dies ist, finde ich, das größte Gesetz in der Schauspielkunst. Natur! natürlich sein! (…) Wenn man alles gibt, was man in sich fühlt, all das seiner Rolle opfert – es ist ein Opfer und man soll es als solches auffassen, es freudig und begeistert hingeben – wie viel gewinnt man nicht für sich! Man vermenschlicht die Dichtung und was gibt sie einem dafür zurück!! Man tobt sich aus auf der Bühne, man liebt, wie die Alltagsmenschen es nicht wissen, man hasst, man lacht, man jubelt und weint, wie sie es nicht kennen. Und von dem allen sollte nichts in der eignen Seele wieder klingen und bleiben? Ein großes Erkennen kehrt ein in unser Inneres. Wie wir den Menschen Verständnis und Erkennen geben, wie viel mehr geben wir uns selbst. Der Schönheitssinn prägt sich aus und bildet sich. – Oft quält man sich mit einer Rolle, sie will sich unserem Empfinden nicht anpassen. Und dann – wenn wir’s erfassen, wenn wir’s aus unserem Innern herausgeholt haben – welche Freude! Der Kampf ist schön. Und wir entdecken Empfindungen in uns, von welchen wir früher nichts wussten. Wir formen unsere Rolle nach unserer Individualität. Das Nachmachen ist keine Kunst. Wie Du sie fühlst, empfängst und denkst – so stell’ die Rolle dar. Nur dann ist’s Natur. –½“ 1).
So wie sie sich mit ganzer Kraft und manchmal darüber hinaus in ihrem Beruf einsetzte, so handelte sie auch im Privatleben, als sie am 1. Mai 1918 den Kollegen am Thalia-Theater, Ernst Leudesdorff, heiratete und ihre Kinder Hans und Ingeborg auf die Welt kamen. Sie muss ihnen eine hinreißende Mutter gewesen sein: „Wohl war sie nicht die Mutter mit dem strengen Blick, sie war ein Kamerad ihren Kindern, doch mit der Autorität der ältesten Schwester. ‘Vor der Mutter dürfen Kinder nie Angst haben, aber Vertrauen und Liebe’, sagte sie immer. Oft überraschte ich sie mit ihren Kindern auf der Erde liegend und spielend, selbst ein Kind. Wie wusste sie mit ihnen zu lachen und zu jubeln“ 1), erinnerte sich der Kollege Ernst Hallenstein. Dass ihre Existenz, die nach außen so spielerisch wirkte, zum Teil mühsam abgerungen war, zeigt neben ihren Worten über die Schauspielkunst ein Brief der 19jährigen an die Mutter, in dem es heißt: „Alles von der heiteren Seite auffassen, es ist ja manchmal schwer, aber man kann sich dazu zwingen, wenigstens es zu versuchen“ (Wien, 25.8.1912)1).
Philine Leudesdorff-Tormin starb im Alter von nur 31 Jahren an den Folgen einer Mandeloperation. Zwei einigermaßen wahllos herausgegriffene Nachrufe eines Kollegen und eines Kritikers, die für viele andere Zeugnisse stehen, geben Einblick in das Wesen dieser seltenen Frau und Schauspielerin. Zunächst ihr Kollege Hermann Gotthardt:
„Das diesjährige Osterfest wird den Mitgliedern des Thalia-Theaters durch den jähen Tod von Philine Leudesdorff-Tormin in recht trauriger Erinnerung bleiben. Unser Publikum aber hat unserer kleinen ‚Mine’ eine derartig verehrende Liebe und Treue bei der erhebenden Trauerfeier bewiesen, dass uns in unserer ‚Mine’ mehr entrissen ist, als die große Künstlerin. Uns ist ein liebes Menschenkind genommen, wie kein Theater der Welt es sein nennen durfte. Als sie vor neun Jahren aus Prag zu uns kam, ein blutjunges Mädelchen, als sie zur ersten Probe kam und ins Konversationszimmer trat mit dem von ihren Bubenhaaren umrahmten süßen Gesichtchen und sich mit ihrem melodischen Organ vorstellte: ‚Tormin’, dabei jeden mit diesen Märchenaugen so treu, als ob sie um Gastfreundschaft bitten wollte, ansehend, da schauten die alten Kämpen des Thalia -Theaters auf. Man freute sich des Engagements eines solchen frischen Geschöpfes, und bald hatte Philine Leudesdorff-Tormin bei den Kollegen gewonnenes Spiel. Sie blieb immer der gleiche, liebe Mensch – auch dann noch, als sie mit der Zeit durch den Glanz ihrer herangereiften Künstlerschaft das ganze Ensemble umgoldete. Sie war unsere liebe ‚Mine’ geworden und ist es geblieben als Braut, als Frau, als Mutter. Albert Bozenhard (der Grabstein der Bopzenhards steht im Garten der Frauen) stand Pate bei ihrem Erstgeborenen – gewissermaßen als Vertreter des ganzen Personals. – Als dann noch ein Mädelchen geboren wurde, war das Glück vollständig. Dieses Glück ist nun grausam zerstört. Aber die Erinnerung an unsere süße Mine wird weiter in uns leben“1).
Und im „Hamburger Fremdenblatt“ schrieb Philipp Berges:
„Die gesamte deutsche Schauspielkunst, insbesondere das Hamburger Kunstleben, hat einen schweren unersetzlichen Verlust erlitten. Philine Leudesdorff-Tormin ist nicht mehr. Aus der Blüte ihres jungen Lebens, aus einer sich von Jahr zu Jahr an Ausdruck steigernden Kunstbetätigung, von der Seite zweier kleiner Kinder und eines Gatten, der sie und ihre Kunst hochhielt, hat der unerbittliche Tod sie jäh abberufen. Mit ihren trauert erschüttert die ganze Hamburger Kunstgemeinde, die sich so häufig an dem wechselvollen, immer auf der Höhe stehenden Spiel der vielseitigen Künstlerin erfreut hat. Philine Leudesdorff-Tormin, so jung sie war, zählte schon zu den Großen in der Schauspielkunst; man kann sie ohne weiteres den bedeutendsten deutschen Schauspielerinnen der Gegenwart zurechnen. Sie war längst nicht mehr die muntere Naive allein, als die man sie in Hamburg zuerst kennen lernte, sie hatte sich zu einer Charakterspielerin ausgewachsen, der keine Rolle fremd war. Geborene Künstlerin, erfasste sie die Wesenheit jedes Charakters intuitiv, beinahe naiv das Richtige treffend, und spielte ihn ohne Künstelei zielsicher und menschlich wahr. Die Natürlichkeit und Ungezwungenheit, mit der sie sich in ernste wie heitere, dem Leben abgelauschte und exzentrische Rollen ohne Tastversuche fand, waren häufig verblüffend. Nie merkte man die Arbeit, die hinter ihren Leistungen stand, so selbstverständlich und leicht stellte sie ihre Figuren auf die Bühne. Zu Hilfe kamen ihr das gewinnende Äußere, das herrliche, sprechende Auge, das für das ganze Gesicht charakteristisch war, ein ganz vorzügliches Sprechtalent und ein sprühendes Temperament. Das ist nun alles dahin. Philine Leudesdorff-Tormin lebt nur noch in dankbarer Erinnerung weiter und wird unvergessen bleiben bei allen, die ihre Kunst auf sich wirken ließen oder zu ihrer liebenswürdigen, bescheidenen Persönlichkeit in nähere Beziehungen treten durften. Im Jahre 1915 trat die Künstlerin in den Verband des Hamburger Thalia-Theaters über und spielte sich so rasch, wie wohl selten eine junge Künstlerin, überdies in schwerer, der Kunst abgewandter Zeit, in die Herzen des Publikums ein. Kaum ist es nötig, den Lesern vor Augen zu führen, was die Künstlerin während der Dauer ihres etwa neunjährigen Wirkens in Hamburg geleistet hat. Sie war, man kann diesen starken Ausdruck wohl gebrauchen, fast ununterbrochen auf den Brettern, und so manches Stück verdankt ihrer Hingabe und ihrer Kunst fast allein seinen Erfolg und sein längeres Verbleiben auf dem Spielplan. Zu ihren Glanzrollen in der letzten Zeit gehörten die Titelrollen in Fuldas ‚Verlorene Tochter’, mehrere glänzende Figuren in dem Einakterzyklus ‚Seitensprünge’, die Hauptfiguren im ‚Schildpattkamm’, in ‚Will und Wiebke’ von Zobeltitz, in ‚Scampolo’, ‚Die innere Stimme’ und ‚Der Kreis’ von Maughan. Die Rolle einer alten Dame, die sie hier unter bewundernswürdiger Selbstentäußerung und mit bezaubernder Grazie spielte, ließ einen Blick frei, auf die großen darstellerischen Möglichkeiten, die noch vor der Künstlerin lagen. Zuletzt, nach einer Krankheit von mehreren Wochen, trat sie in dem englischen oder amerikanischen Stück ‚Das schwache Geschlecht’ auf, das sie geradezu mit einem sprühenden Humor erfüllte.
Die Hand des Todes ist jäh und ganz unerwartet über sie gekommen. Eine Mandelentzündung, die eine Operation im Lohmühlenkrankenhaus nötig machte, artete in Blutvergiftung aus und führte rasch zum Ende. Nur fünf Tage ist die Künstlerin krank gewesen. Ob sie viel gelitten Hat? Man darf hoffen, dass dies nicht der Fall gewesen, da das Abwärtsgleiten ins Dunkel von einer Trübung des Bewusstseins begleitet war.
Mit den Hinterbliebenen trauert die gesamte Hamburger Kunstgemeinde um die so früh dahingegangene, liebenswürdige, geniale Künstlerin; trauert die Künstlerschar des Thalia-Theaters, denn wie sie der Liebling des Publikums war, war sie es auch den Kollegen und Kolleginnen, sie besaß keinen Feind, ihre hohen menschlichen Qualitäten hatten sich alle Herzen erobert. Der Bühne selbst wird durch das Scheiden Philine Leudesdorff-Tormins eine schwere Wunde geschlagen. Sie gehörte zu den besten Jungen Kräften, die das Thalia-Theater je besessen hat. Ihr Andenken wird nicht erlöschen“ 1).
Text: Brita Reimers
Zitat:
[1] Julie Tormin und Emily Albert: Philine Tormin. Ein Gedenkbuch. Hamburg 1924.
Nur ein halbes Jahr Schauspielunterricht genügte und für Philine Tormin begann eine rasante Karriere. Über Theaterstationen in Berlin, Wien und Prag kam sie 1915 ans Thalia-Theater nach Hamburg. Schon bald gehörte sie zu den Großen in der Schauspielkunst. Sie war nicht nur die muntere Naive, sie entwickelte sich auch zu einer Charakterspielerin. Zugute kamen ihr das gewinnende Äußere, ihre braunen sprechenden Augen, die für den Gesichtsausdruck charakteristisch waren, ihr Sprechtalent und ein sprühendes Temperament. Viele, die sie kannten sprachen über sie, als habe es sich bei ihr nicht um ein reales, sondern um ein Geschöpf aus dem Reich der Poesie gehandelt. Ihre mädchenhafte Erscheinung, der zierliche Körper, die dunklen Locken unterstützten noch
diesen Eindruck. Auch muss ihre dunkle melodische Stimme einen eigenen Reiz gehabt haben.
Verheiratet mit ihrem Kollegen Ernst Leudesdorff bekam sie zwei Kinder. Dass ihre Existenz, die nach außen so spielerisch wirkte, zum Teil mühsam errungen war, zeigt ein Brief der 19-jährigen: "Alles von der heiteren Seite auffassen, es ist ja manchmal schwer, aber man kann sich dazu zwingen, wenigstens versuchen." Philine Leudesdorff-Tormin starb im Alter von 31 Jahren an den Folgen einer Mandeloperation.
Elena Luksch-Makowsky
(geb. Makowsky)
Russische Malerin und Bildhauerin

Die Malerin und Bildhauerin Elena Luksch Makowsky vor ihrem Gemälde "Adolescentia"

(Mädchen-) Brunnen von Elena Luksch Makowsky in der Stadtteilschule Winterhude (frühere Volksschule Wiesendamm)



14.11.1878
St. Petersburg
–
15.8.1967
Hamburg
St. Petersburg
–
15.8.1967
Hamburg
Mehr erfahren
Elena wuchs zusammen mit ihren beiden Brüdern in glanzvollen aristokratischen Verhältnissen auf. Ihr Vater, Konstantin Makowsky war ein angesehener Maler, der darauf bestand, dass seine Kinder eine malerische Ausbildung bekamen. Im Herbst 1896 wurde Elena in der Kaiserlichen Akademie der Künste, St. Petersburg, dort in der Meisterklasse des kritischen Realisten Ilja Repin aufgenommen. Ihr zweiter Lehrer war der Bildhauer Wladimir Beklemischow. Zuerst arbeitete sie mit Ilja Konjenkow an einem großen Relief, das die Schrecken des Krieges darstellt, eine Auftragsarbeit von Johann v. Bloch. Als er ihr ein Stipendium anbot, griff sie zu und ging 1898 nach München, erhielt u. a. Malunterricht im Atelier von Anton Azbè.
In selben Jahr lernte sie den Wiener Bildhauer Richard Luksch (er schuf das im Garten der Frauen stehende Grabmal für Franziska Jahns. Luksch ist auf dem Ohlsdorfer Friedhof bei seiner zweiten Frau Ursula Falke bestattet) kennen. 1900 heiratete das Paar und ging nach Wien. Dort arbeitete Elena Luksch Makowsky ab 1901 als erste Frau mit Künstlern der Wiener Secession zusammen. Seit der Gründung der Wiener Werkstätten intensivierten beide ihre kunstgewerbliche Tätigkeit. Als Richard Luksch 1906 den Auftrag, Reliefs für die Fassade des Wiener Bürger-Theaters zu machen, aus Zeitgründen nicht ausführen konnte, gab er ihn an seine Frau weiter: In nur drei Monaten schuf sie eines ihrer Hauptwerke: drei große Melpomene-Reliefs, die sich heute im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe befinden.
1907 zog das Ehepaar mit seinen damals zwei Söhnen nach Hamburg, weil Richard Luksch eine Professur an der Hamburger Kunstgewerbeschule bekommen hatte.
Elena Luksch Makowsky beschäftigte sich weiter mit dem volkstümlichen Leben ihrer Heimat. Es entstanden mehrere Reihen Volks-Bilderbogen. Als sie 1910 von Fritz Schumacher den Auftrag erhielt, ein Werk für den Hamburger Stadtpark zu gestalten, arbeitete sie eine Fayenceplastik, die sie "Ein Frauenschicksal" nannte: eine sitzende Frau, die den Kopf der künstlerischen Inspiration in Gestalt eines Kuckucks zuwendet, der auf ihrer Schulter sitzt, während drei Kinder - 1911 war Elenas dritter Sohn geboren - vorsichtig aus dem Schutz der herabfließenden Gewänder der Mutter herausblicken. Die Arm- und Handbewegungen der Frau gehen vom Kuckuck aus und zu ihm zurück und trennen schroff die beiden Welten voneinander. Fritz Schumacher beschrieb sehr einfühlsam: "Durch diese Kinder ist die Frau fest am Boden gebunden, sie kann nicht schreiten, wohin sie will, sie kann sich nicht bewegen, wie sie mag, (…). Ihr Haupt aber kann sich frei bewegen. Oben im Geistigen ahnen wir noch eine zweite Welt. Sie lauscht dem Vogel mit einer Gebärde voll entsagungsvoller Sehnsucht."
Mit der Plastik "Frauenschicksal", das 1926 im Stadtpark aufgestellt wurde, endete 1912 ihre künstlerisch produktivste Zeit. "War es das Frauenschicksal, war es die fehlende Inspiration durch den Wiener Künstlerkreis, war es die zunehmende Entfernung von der russischen Heimat, die dazu führten, dass die künstlerische Spannkraft nachließ?" fragte Helmut Leppien in einem von ihm verfassten Beitrag über die Künstlerin. Es scheinen alle von Leppin genannten Motive Bestandteile dessen zu sein, was Elena Luksch Majowski "Frauenschicksal" nannte, und was sich auch heute noch oftmals als Frauenschicksal entpuppt. Noch immer ist es zumeist die Frau, die ihren Ort verlässt, sich den beruflichen Gegebenheiten des Mannes anpasst und für die Familie verantwortlich ist. Schon den Umzug nach Wien schloss Elena in ihr "Schicksal" ein. In Hamburg verschärften sich die Bedingungen nur noch. Die Familie war größer geworden - und erforderte mehr Zeit und Kraft. Die Kaufmannsstadt Hamburg und der Kreis um Richard und Ida Dehmel, dem das Paar angehörte, konnten ihr weder die Heimat und ihre Menschen noch die künstlerischen Anregungen ersetzen. Zudem wandte sich Richard Luksch einer anderen Frau zu. 1921 trennte sich das Ehepaar. Und auch die wirtschaftliche Lage während, zwischen und nach den beiden Weltkriegen war für Kunstschaffende sehr schwer. Weitere Werke von Elena Luksch Makowsky waren z. B. 1926 der Entwurf für die Senatsplakette "Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes" und die Gestaltung zweier Brunnen für die Meerweinschule (1930). Die Künstlerin gab privaten Kunstunterricht, übernahm private Portraitaufträge, fertigte Portraitbüsten, und beteiligte sich bis 1965 an verschiedenen Ausstellungen.
Das Motiv auf ihrem Grabstein ist Elena Luksch Makowskys dreiteiliger Lithographie-Serie zum Thema: "Der Krieg" entnommen.
Marga Maasberg
Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin

Marga Maasberg mit Albert Schweitzer in dessen Spital in Lamborene, wo sie ein Jahr aktiv mitarbeitete


21.5.1903
Hamburg
–
12.11.1981
Hamburg
Hamburg
–
12.11.1981
Hamburg
Mehr erfahren
Als am 25. Dezember 1952 das Fernsehen zum ersten Mal in die deutschen Stuben sendete, war Marga Maasberg im vom NWDR um 20.10 Uhr ausgestrahlten Stück "Stille Nacht, heilige Nacht" in der Rolle der Kreszenz zu sehen. Zuvor war Marga Maasberg, nachdem sie drei Jahre privaten Schauspielunterricht bei Prof. Carl Wagner in Hamburg absolviert hatte, viele Jahre an verschiedenen Theatern und auch in Kabarettprogrammen aufgetreten. Für ihre schauspielerischen Leistungen wurde sie zum Ehrenmitglied des Hamburger Schauspielhauses ernannt.
1948 hatte sie ihr Kinofilmdebüt in dem Drama "Arche Nora". Im selben Jahr trat sie mit Erik Ode im Spielfilm "Stadtmeier und Landmeier" auf, spielte danach zum Beispiel 1952 mit Inge Meysel, Willy Maertens und Carl Voscherau in dem Film "Unter tausend Laternen" und trat ein Jahr später neben Maria Schell in dem Spielfilm "Der träumende Mund" auf. In den weiteren Jahren wirkte Marga Maasberg in vielen Fernsehproduktionen mit, so z. B. in den Kultserien "Gestatten mein Name ist Cox" und "Tatort". Auch in Eberhard Fechners Dokumentarspiel "Vier Stunden vor Elbe I" und in der Familienserie "Ida Rogalski" (mit Inge Meysel in der Titelrolle) trat sie auf.
Marga Maasberg wirkte in zahlreichen Hörspielen mit. Besonders bekannt und unvergessen wurde ihre Darstellung der Hexe Schrumpeldei, die sie mit knorriger Stimme in der gleichnamigen Kinderhörspielreihe, die zwischen 1973 und 1979 in elf Folgen produziert wurde, spielte. Hierbei geht es um eine kauzige, aber liebenswürdige Hexe und ihre ungeschickte Tochter.
Marga Maasberg wirkte in noch weiteren Märchenhörspielen mit, so in Hörspielaufnahmen der Märchen "Hänsel und Gretel", "Der Wolf und die sieben Geisslein" und "Die kleine Seejungfrau". Marga Maasberg arbeitete auch als Synchronsprecherin und lieh ihre Stimme u. a. Cathleen Nesbitt ("Paris um Mitternacht").
Wilhelmine Marstrand
(Antonia Josefina)
Pianistin und Pädagogin


7.8.1843
Donaueschingen
–
16.8.1903
Spiez am Thuner See
Donaueschingen
–
16.8.1903
Spiez am Thuner See
Mehr erfahren
Auf einer Stele aus schwarzem Granit, an deren oberem Teil ein Bronzerelief mit musizierenden Engeln befestigt ist, befindet sich im unteren Teil die Widmung:
Der begeisterten Künstlerin,
Der treuen Collegin,
Der unvergesslichen Lehrerin,
Der geliebten Freundin,
zu ehrendem Gedächtnis
Was schon die Inschrift auf dem Grabstein vermuten lässt: Wilhelmine Marstrand war eine außerordentlich beliebte und geschätzte Frau. Zur Einweihung des von den Freunden gestifteten Monuments hatten sich trotz schlechten Wetters etwa 200 Personen auf dem Ohlsdorfer Friedhof eingefunden, um die Pianistin und Lehrerin zu ehren.
Wilhelmine Marstrand, Tochter des fürstlichen Hofgärtners Peter Marstrand und seiner Frau Antonie Theresia Bernardina geb. Pech erhielt schon sehr früh ausgezeichneten Musikunterricht, so durch den fürstlich-fürstenbergischen Kammermusiker Nepomuk Wagner und ihren Taufpaten, den Violoncellisten Leopold Böhm.
Nachdem die Familie 1855 nach Konstanz gezogen war, erhielt Wilhelmine von dem Musikdirektor und Organisten Carl Ferdinand Schmalholz Unterricht. Im Alter von 16 Jahren, 1859, trat sie in das neu gegründete Stuttgarter Konservatorium ein. Sie gab erfolgreich Konzerte in Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Dresden und im Leipziger Gewandhaus. 1867 verlobte sie sich in München mit dem Historienmaler Horace Jantzen. Zu einer Heirat kam es nicht. Ein Jahr später zog sie nach Hamburg, wo sie zusammen mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Maria, die ebenfalls Pianistin war, am Mittelweg 45 wohnte. In Hamburg führte sie sich unter großem Beifall von Publikum und Presse mit Johann Nepomuk Hummels a-moll-Konzert in der Philharmonie ein. Im Laufe der Zeit verlegte sie den Schwerpunkt ihrer Arbeit jedoch immer mehr aufs Unterrichten.
Zwischen 1877 und 1895 „war Wilhelmine Marstrand alleinige Veranstalterin von Kammermusiksoireen, zu denen sie die Mitwirkenden engagierte. Anfänglich handelte es sich dabei um Friedrich Margwege (Violoncello) und Carl Louis Bargheer (Violine), später kamen Henry Schradieck, Ottokar Kopecky (Violine), Magnus Klietz und Albert Gowa (Violoncello) hinzu. Damit prägte sie das Hamburger Musikleben als eigenständige Künstlerin, die stolz auf ihre Unabhängigkeit war: ‚Ich bitte recht sehr nicht unerwähnt zu lassen, daß ich viele Jahre selbständige Concerte gab; denn es ist für den ausübenden Künstler ein großer Unterschied ob man nur i. anderen Concerten mitwirkt oder ob man regelmäßig gut abonnierte eigene Concerte gibt, die Jahre lang einen sogenannten ‚eisernen Bestandteil‘ des hamburger Concert-Repertoires bildeten‘ (Marstrand, Aufzählung der ‚zur Aufführung gebrachten Kammermusikwerke in Hamburg‘).“ 1)
1883 wurde sie Mitglied des Lehrkörpers des Konservatoriums und arbeitete dort trotz eines schweren Leidens bis zu ihrem Tode.
Die aus dem Gedächtnis zitierten Worte des Direktors des Philharmonischen Orchesters, Max Fiedler, anlässlich der Aufstellung des Grabsteins geben einen Eindruck von der Persönlichkeit und dem Wirken der Künstlerin, auch wenn sie eines gewissen Pathos nicht entbehren: „Wärmste Liebe, treueste Freundschaft, Verehrung und Dankbarkeit haben diese Gedächtnisfeier für unsere verehrte Freundin Wilhelmine Marstrand veranlasst, - solch tiefe Liebe, solch echte Freundschaft, wie sie gewiss nur selten zu finden sind. Fernstehenden müsste dies ein Beweis sein, dass die Verewigte ein ganz seltener Mensch war, dem es gegeben war, sich tief in die Herzen seiner Freunde einzuprägen. Die Näherstehenden, die Freunde und Verwandten wissen das und betrauern in der Dahingeschiedenen eine hervorragende Persönlichkeit und ausgezeichnete Künstlerin, eine Freundin, echt wie Gold, eine Schwester, wie sie idealer nicht gedacht werden kann, eine Künstlerin, die, ganz erfüllt von den Idealen ihrer Kunst, unablässig und mit nie erlahmendem Enthusiasmus daran arbeitete, ihre hohen Ziele zu erreichen.
Wilhelmine Marstrand war eine vornehme Natur, ein echter Charakter von merkwürdiger Festigkeit. Ein Hin- und Herschwanken in Urteil und Meinung war ihr fremd; sie hielt treu und offen alles das hoch, was sie einmal für gut, schön und richtig erkannt hatte. Dadurch erhielt man von ihr einen wohltuenden Eindruck absoluter Zuverlässigkeit und Wahrheit. Und welche Selbständigkeit, welche Energie konnte sie entfalten, wenn es sich darum handelte, anderen eine Freude zu machen! Keine Mühe wurde gescheut, selbst noch zu einer Zeit, als sie durch körperliche Schmerzen schwer zu leiden hatte. Manches wäre nicht zustande gekommen, wenn sie sich nicht energisch und selbstlos dafür gemüht hätte. Wie sie anderen zu erfreuen, anderen zu helfen strebte, das haben nicht am wenigsten ihre Schüler erfahren. Mit nie ermüdender Fürsorge und mit heiligem Eifer arbeitete sie daran, die Fähigkeiten zu entwickeln und sie immer mehr einzuführen in die Herrlichkeit der von ihr über alles geliebten Kunst. Wie viele danken ihr und lieben sie dafür! An Pflichttreue, Gewissenhaftigkeit und segensreichem Interesse für jeden ihrer Schüler war sie ihren Kollegen ein wahres Vorbild. Was speziell das Konservatorium ihr zu danken hat, an dem sie eine lange Reihe von Jahren wirkte, lässt sich nicht mit wenigen Worten erschöpfen. Es war eine Freude mit ihr zu arbeiten; nie hat der leiseste Misston die Harmonie gestört. Neid kannte sie nicht. Sie schenkte das wärmste Interesse allen, die etwas leisteten, und mit glühendem Anteil verfolgte sie die Entwicklung junger hoffnungsvoller Talente und half ihnen, wo sie konnte. Musik war ihr Leben, hielt sie froh und verjüngte sie. Wilhelmine Marstrand war eine echte Musiker-Natur, durchdrungen von heiligem Ernst und künstlerischer Strenge gegen sich selbst. Wenn sie am Klavier saß, schienen alle körperlichen Schmerzen von ihr genommen.
Was sie erdulden musste in ihrer schweren Krankheit, das weiß am besten ihre vereinsamte Schwester, deren Trauer unsagbar ist. In unserem Gedächtnis lebt sie als ein ganzer, prachtvoller Charakter. Liebende Freundschaft drängte es, ihrem Andenken auch ein äußeres Zeichen zu errichten in Gestalt dieses schönen Gedenksteines. Als Abschiedsgruß aber rufen wir der Verewigten nach: ‚Schlafe und ruhe in holden Träumen’, Träumen von den Gebilden der Kunst, angefüllt mit Klängen und Harmonien, die dich hier in Wonne versetzten, Träumen treuester Freundschaft, tiefster Dankbarkeit, Verehrung und wärmster Liebe“ 2).
Wilhelmine Marstrand starb während eines Erholungsaufenthaltes in Spiez am Thuner See.
Text: Brita Reimers
Zitat:
[1] Sophie-Drinker-Institut, virtuelles Lexikon der Musikerinnenudn Musiker. www.sophie-drinker-institut.de
[2] Tages-Neuigkeiten. Zeitungsauschnittsammlung. Staatsarchiv Hamburg..
Lotte Mende
(Johanna Dorothea Louise Müller)
Schauspielerin am Carl-Schultze-Theater von 1864 bis 1874


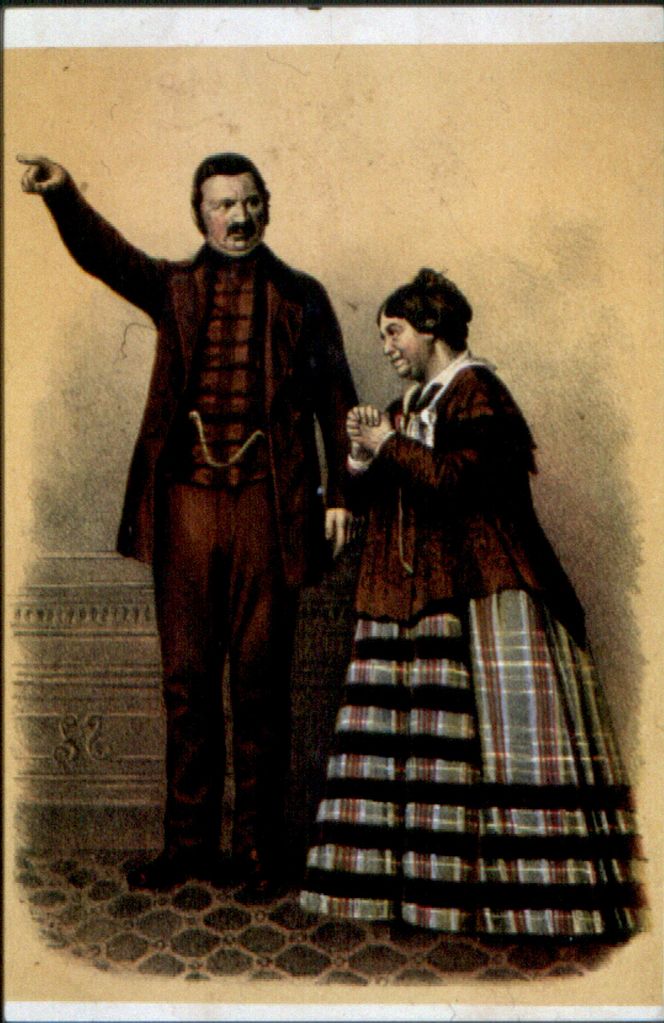
Lotte Mende als Tante Therese und Heinrich Kinder als Polizist Gaedchens in Stindes Hamburger Leiden (Chromolithographie), Bild: via Wikimedia Commons, unbekannt / gemeinfrei

12.10.1834
Hamburg
–
5.12.1891
Hamburg
Hamburg
–
5.12.1891
Hamburg
Mehr erfahren
Am 1.3.1934 schrieb das Hamburger Fremdenblatt unter dem Titel: „Die `unvergessliche` Künstlerin: Auf dem Ohlsdorfer Friedhof, zwischen den Kapellen 6 und 7, liegt das Einzelgrab AD 25 Nr. 46. Der Stein trägt die kaum noch leserliche Inschrift: `Hier ruht die unvergessliche Künstlerin Lotte Mende, geb. Müller, gest. Dezember 1891.` Vor längeren Jahren ist einmal dem Journalisten- und Schriftstellerverein für Hamburg Altona und Umgebung ein kleines Legat zugeflossen, damit die Grabstelle regelmäßig unterhalten werden könne. Der Verein hat das Grab, das bereits verwahrlost war, mit Efeu bepflanzen lassen und bezahlt regelmäßig die Gebühr für die Unterhaltung an die Friedhofs-Verwaltung. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, obwohl das Kapital des Legats durch die Inflation verschwunden ist. Der Verein ist aber nicht in der Lage, die Kosten für eine Erneuerung der Inschrift des einfachen Grabsteins zu übernehmen."
Aber auch die Gebühr für die Nutzungsdauer der Grabstätte wurde nicht mehr bezahlt, so dass Lotte Mendes Grabstätte nicht mehr verlängert wurde. Deshalb steht heute ihr Grabstein im Garten der Frauen.
Schon Lotte Mendes Begräbnis macht deutlich, wie schnell doch die Menschen vergessen, obwohl Lotte Mende zu Lebzeiten sehr populär gewesen war: „kein Choral, keine Musik, kein Wort des Nachrufs verabschiedeten sie. Nur fünf Personen, die ihrer Künstlerlaufbahn nahegestanden, und etwa ein halbes Dutzend Freunde und Verwandte bildeten das Gefolge von der Kapelle bis zum Grabe", schrieb das Hamburger Fremdenblatt am 11.10.1934.
Über ihre Kindheit und den Weg zur Bühne schrieb Lotte Mende in einem Brief an den Verfasser des Buches „Die größten und berühmtesten deutschen Soubretten", Adolph Kohut: „1834 den 12. October wurde ich in Hamburg von armen, bürgerlichen Eltern geboren; die Idee, dem Theater anzugehören, wurde mir gewissermaßen in meinen Kinderjahren von Bekannten und Nachbarn, denen ich correct und richtig vorsang, was ich in meiner Familie, die durchweg musikalisch war, aufgeschnappt hatte, beigebracht. Meine Stimme, und die Art und Weise, wie ich vortrug, veranlasste die Leute gewöhnlich zu der Redensart `die muss mal zum Theater`. Ungefähr 15 1/2 Jahre alt, fasste ich den Entschluss, der damals in Hamburg sehr gefeierten Soubrette Lina Höfer am Thalia-Theater einen Besuch zu machen, welcher zum Zweck hatte, ihr etwas vorzusingen und um ihr Urtheil zu bitten, ob ich für die Bühne fähig sei. Das geschah hinter dem Rücken meiner Eltern, und da ich selbst nicht über ein Kleid verfügen konnte, welches ich zu einer solchen Visite würdig hielt, borgte ich mir ein solches von einem 15jährigen sehr schlanken Mädchen, und ich war sehr klein und dick - ich zwängte mich aber mit aller Gewalt hinein, nahm den Rock, der zu lang, ganz kokett ein wenig in die Höhe, fand mich selbstverständlich sehr reizend, und nun hin zu Lina Höfer. Sie war liebenswürdig und nahm mich an, ich trug ihr mein Anliegen vor, sie unterdrückte ein Lächeln und sagte zu einem Herrn, welcher grade zum Besuch bei ihr war, `bitte, wollen Sie das junge Mädchen zu irgend einer Piece begleiten?` Und ich sang - gewiss zum großen Jubel dieser beiden Personen: `In der Heimat ist`s so schön ec.`. Als ich zu Ende gesungen, lachten mich beide ganz ungeniert aus, ich wurde entlassen mit der Bemerkung, dass ich erst etwas älter und größer werden müsse, und dann würde es sich mit dem Theater schon von selbst machen. Angeknüpft war also mit dem Theater, und der Gedanke blieb. Ein halbes Jahr später lasen meine Eltern nachstehende Annonce in den `Hamburger Nachrichten`: Es werden junge Damen gesucht, welche sich dem Theater widmen wollen. Meine Eltern, aufgeklärter, wie so viele andere Bürgersleute, waren mit meinem Wunsch, mich der Bühne zu widmen, einverstanden, wohl auch mit aus dem Grunde, weil gerade damals die größte Armuth bei uns herrschte, und es für meine Eltern erwünscht war, für mich einen Erwerbszweig zu finden; also, richtig genommen, ist die Noth, Veranlassung geworden, dass ich Schauspielerin wurde. Jener Herr, welcher obige Annonce hatte ergehen lassen, hieß Hertzinger, in der Theaterwelt wohl bekannt. So klein und unausgebildet ich im Ganzen auch noch war, trotz meiner 16 Jahre wurde ich doch von ihm engagirt, und am 28. October im Jahre 1850 reiste ich in Begleitung meines Stiefvaters, des genannten Hertzinger, nach dem hannöverschen Städtchen Verden ab, woselbst ein gewisser Heinrich Warneke, Director einer reisenden Gesellschaft, seinen Zauber übte; er war es, der mich durch genannten H. mit einer monatlichen Gage von 8 Thalern engagirte" 1).
In dem Rollenfach der munteren Liebhaberin spielte Lotte Mende in Elberfeld, Bonn, Aachen, Köln, Düsseldorf und Altona. 1864 wurde sie, die damals noch ihren Mädchenamen Louise Müller trug, am Carl- Schultze- Theater auf Hamburg St. Pauli engagiert, wo Hamburger Volksstücke und Lokalpossen meist in plattdeutscher Sprache aufgeführt wurden. Das 1300 Personen Platz gebende Theater befand sich im Hofe des Grundstückes Reeperbahn 140-142, im Garten des Lokals „Joachimsthal". 1860 hatte der 29jährige Schauspieler Carl Schultze sein Theater mit einer Parodie auf die am Hamburger Stadttheater gespielte Oper „Dinoah" eröffnet. Das Stück wurde monatelang vor ausverkauftem Haus gespielt und das Carl- Schultze- Theater erwarb sich den Ruf, ein Theater für „Humor liebende" Hanseaten zu sein. Im Laufe der Zeit avancierte das Theater zum künstlerisch bedeutendsten Komödienhaus an der Reeperbahn. Durch Gastspielreisen wurde das Theater, welches bis 1931 existierte und an dem Lotte Mende, mit kurzen Unterbrechungen, wo sie z.B. am Berliner Residenztheater spielte, 10 Jahre lang ein festes Engagement gehabt hatte, über die Grenzen Hamburgs bekannt.
Lotte Mendes Lieblingsrollenfach war das der jugendlichen Liebhaberin. Als ihr eines Tages Carl Schultze die Rolle der komischen Alten anbot, lehnte sie empört ab. Carl Schultze schrieb darüber 1890 an Adolph Kohut: „Louise Müller war bei mir - sagen wir, da es sich um eine Dame handelt - vor einigen Jahren als jugendliche Liebhaberin engagiert, und spielte mit besonderer Vorliebe naive Rollen, für welche sie sich besonders geeignet und berufen fühlte. Ich will keine Kritik über ihre derzeitigen Leistungen fällen und bemerke nur, dass sich schon damals die Neigung bei ihr fühlbar machte, die Rollen nach ihrer Individualität - zurecht zu legen. Eines Tages wollte ich das Stück vom alten Dr. Bärman, Stadtminschen un Buurenlüüd, geben, dazu fehlte mir eine komische Alte. Nach meiner Gewohnheit, eher meine Schauspieler heranzuziehen, als ausgewählte Engagements für bestimmte Fächer zu treffen, glaubte ich nicht fehlzugehen, wenn ich Louise Müller, in der ich eine Anlage zur komischen Alten zu spüren glaubte, in ein anderes Fahrwasser zu lenken versuchte. Ich schickte ihr die plattdeutsche komische Alte in dem oben erwähnten Stück. - Die Antwort war kurz und bündig, nein, und Louise wollte durchbrennen. - Ich redete ihr zu, den Versuch zu machen, und beruhigte sie, als ihre Thränen nicht versiegen wollten, mit dem - wenn ich es so nenen darf - Citat aus irgend einem plattdeutschen Stück: Lotte, stell`di man nich so an. Empört, dass ich sie Lotte nannte, strömten ihre Thränen noch reichlicher, schließlich siegte ich, Louise studirte ihre Rolle, und führte sie unter kolossalem Beifall durch. - Von da an blieb ihr der Name `Lotte` und das Fach der komischen Alten. Nach ihrer Heirath mit dem Schauspieler Louis Mende führte sie noch den Namen Lotte weiter, unter welchem sie berühmt wurde" 1).
Carl Schultze und Lotte Mende traten oft zusammen auf und galten bald als das ideale Paar des Volkstheaters. „Sie rührte zu Tränen, sie riss hin zu stürmischer Heiterkeit, beides ohne Mätzchen und Übertreibung; ihre Größe lag in ihrer Schlichtheit. Und ihr Künstlertum in dem unendlichen Fleiß, mit dem sie nichts der Improvisation überließ, sondern ihre Rollen durcharbeitete, sowie in der genialen Findigkeit, durch die ihre Wirkungen daraus aufblitzten," so das Hamburger Fremdenblatt vom 11.10.1934. Und der Theaterkenner und Volksstückeschreiber Paul Möhring schrieb in seinem Buch „Im Hamburger Rampenlicht" über sie: „Unter Verzicht auf jeden Klamauk und aller possenhaften Übertreibungen gab sie ihren Figuren Lebensechtheit, Fülle und Humor und dokumentierte sich so als große Menschengestalterin" 2). Lotte Mende hatte ein großes Repertoire, spielte Rollen von der jugendlichen Liebhaberin bis zur komischen Alten und war eine Virtuosin in holsteinischem, mecklenburgischen und hamburgischen Platt.
Mit dem Dichter und ehemaligen Chemiker Julius Strinde erlebte Lotte Mende in den 70er Jahren eine Blütezeit des Hamburger Volksstückes. Julius Strinde schrieb diverse Stücke, in denen Lotte Mende brillierte. Ihren größten Erfolg feierte sie als redselige Tante Therese Grünstein in „Hamburger Leiden", das 1873 zuerst aufgeführt und über hundert Mal wiederholt wurde. Der von ihr immer wieder vorgetragene Satz: „Was is mich das mit dich, mein Kind" wurde zum geflügelten Wort. Dieses Stück lockte nicht nur das kleinbürgerliche Publikum ins plattdeutsche Komödienhaus nach St. Pauli, sondern es standen abends auch Equipagen des Hamburger und Altonaer Großbürgertums vor dem Theatereingang.
Lotte Mende, die 1872 ihren Schauspielkollegen, den Heldenspieler Louis Mende geheiratet hatte, verließ 1874 das Carl Schultze Theater, nachdem dort immer weniger Lokalpossen gespielt wurden. Sie ging von 1874 bis 1875 ans Berliner Residenztheater, fand hier aber nicht den richtigen Wirkungskreis. So zog sie von einem Gastspiel zum anderen, so nach Dresden, München, Berlin, Wien und Prag. Und auch in Hamburg gab sie Gastrollen im Wilhelm-Theater, Variete-Theater und National-Theater. Der Dichter und Kritiker Fritz Mauthner schrieb über diese Jahre: „Der eigentliche Zauber ihres Plattdeutsch fesselte allmählich auch den hochdeutschen Bildungsphilister (...). Und dies außerordentliche, überall auch anerkannte Talent sehen wir in einem unsteten Leben von Stadt zu Stadt, von Gunst und Ungunst der Witterung und der Jahreszeiten abhängen, sehen wir angewiesen auf ein Publikum, das bei jedem neuen Gastspiel immer wieder aufs neue erobert sein will! Ich möchte wissen, ob eine solche Künstlerin heimatlos sein würde, wenn sie als Französin auf die Welt gekommen wäre. Unsere Nachbarn besitzen in ihrem Paris einen Mittelpunkt für alle Bestrebungen der Nation, eine französische Lotte Mende wäre bald die weltberühmte Zierde der Pariser Theater geworden."
Im Hamburger Varietéheater (später Ernst Drucker Theater) gab Lotte Mende ca. 500 Gastspiele. Dennoch vereinsamte sie in ihrem Privatleben. Im Frühsommer 1881 starb ihr Mann an Krebs. Lotte Mende überwand nie ganz den Tod ihres Mannes. Und Freunde wollen eine gewisse Bitterkeit bei ihr wahrgenommen haben. Auch Lotte Mende bekam Krebs und starb daran im Allgemeinen Krankenhaus Eppendorf.
Text: Rita Bake
Zitate:
[1] Kohut, Adolph: Die größten und berühmtesten deutschen Soubretten. Düsseldorf o.J.
[2] Möhring, Paul: Im Hamburger Rampenlicht. Hamburg 1972.
Yvonne Mewes
Lehrerin, leistete Widerstand gegen das NS-Regime


22.12.1900
–
6.1.1945
6.1.1945
Mehr erfahren
Yvonne Mewes stammte aus einer bürgerlichen gebildeten Familie. Sie war die erste von vier Töchtern des Ehepaares Dr. Wilhelm Mewes und Hermine Mewes. Wilhelm Mewes war Zahnarzt, er hatte in Hamburg in der Gelehrtenschule Johanneum das Abitur abgelegt, sein Enkel Harry berichtet, dass er viel las, u. a. Werke in lateinischer Sprache.1)
Yvonne Mewes wurde in Karlsruhe geboren. Bis 1919 lebte die Familie in Straßburg im Elsass. Im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Versailler Vertrags verließen sie, wie Harry Mewes schrieb, „als patriotische Deutsche“ das Elsass und zogen nach Hamburg. Hier bewohnten sie eine Villa am Grindelberg 42. Wilhelm Mewes praktizierte in der ersten Etage und hatte ein kleines Labor. Seine Ehefrau oder seine Töchter gingen ihm zur Hand.
Yvonne Mewes studierte von 1920 bis 1925 Philologie in Hamburg und München. Sie legte 1925 das Staatsexamen ab und 1927 die Lehramtsprüfung.
Ihre jüngere Schwester Gertrude, geboren 1904, ging in die Lehre bei einer Hutmacherin. Sie verliebte sich in Imre Szanto, einen jungen Ungarn jüdischer Herkunft, Geschäftsmann und Sohn eines Rechtsanwalts. Als Gertrude Mewes schwanger wurde, erlaubten seine Eltern nicht, dass er sie heiratete. Als Gründe gaben sie seine Jugend an und dass die Verbindung „außerhalb seiner Religion“ sei. 1923 wurde Harry als uneheliches Kind geboren. Er wuchs auf im Haus seiner Großeltern und Tanten. Eine enge Beziehung hatte er zu seiner Tante Yvonne.
1928 erhielt Yvonne Mewes eine Stelle als Lehrerin in der Heilwig-Schule, die damals noch privat und evangelisch-lutherisch war. Sie unterrichtete die Fächer Englisch und Französisch.
Bei ihr traf sich regelmäßig das „Italienische Kränzchen“. Es war aus den Italienisch-Vorlesungen des Dr. Meriggi hervorgegangen, der als „antifaschistisch“ galt. Im Laufe der Zeit wurden die Gespräche politisch, die Teilnehmer lasen Hitlers „Mein Kampf“. Eine Teilnehmerin wollte eine Frau jüdischer Herkunft ausschließen, Yvonne Mewes setzte sich dafür ein, dass diese in der Gruppe bleiben konnte, die andere verließ das Kränzchen.
Ab 1933 geriet Yvonne Mewes in der Schule unter Druck. Es wurde von ihr erwartet, dass sie der NSDAP beitrat. Sie weigerte sich und verschleierte keineswegs ihre Abneigung gegenüber dem NS-Regime und seiner Ideologie. Diese Haltung hatte zur Folge, dass sie nicht zur Studienrätin ernannt wurde, sondern Studienassessorin blieb. Ihre ehemalige Schülerin Ursula Randt (siehe zu ihr in der Rubrik: Frauen auf anderen Hamburger Friedhöfen, hier: Altona, friedhof Groß-Flottbek) schreibt, dass sie „eine hervorragende Französisch-Lehrerin“ gewesen sei. Um dem wachsenden Druck etwas entgegenzusetzen, machte Yvonne Mewes Ausflüge und weite Fahrradtouren und bot damit auch ihrem Neffen Erholung von der ihn belastenden Situation als „Mischling 1. Grades“ in der Schule Johanneum. Sie nahm auch Anteil an dem Schicksal der anderen jüdischen und „halbjüdischen“ Kinder in der Schule ihres Neffen, und sie war empört über die Bücherverbrennung 1933 und die „Reichskristallnacht“ 1938.
1938 wurde Yvonne Mewes auf eigenen Wunsch in den Staatsdienst übernommen. Sie unterrichtete an der Schule Curschmannstraße. Sie weigerte sich aber, in den Kriegsjahren an der Kinderlandverschickung teilzunehmen, weil sie dann ihren Unterricht nicht mehr in ihrem Sinne gestalten könne, sondern unter dem Einfluss der Hitler-Jugend stehe. Als Folge dieser Weigerung wurde sie an die Caspar-Voght-Schule versetzt und 1942 wieder zurück an die Heilwig-Schule, die inzwischen staatlich geworden war.
Der Schulleiter der Heilwig-Schule, Dr. Hans Lüthje, schrieb am 4. Juni 1943 in einem Bericht an die Schulbehörde über Yvonne Mewes: „Ein bis zum Fanatismus wahrheitsliebender Mensch, der keine Bindung anerkennt und anerkennen will, sich rücksichtslos gegen alles stemmt, was nach Zwang aussieht, sich mit allen Kräften gegen die notwendigen Anforderungen der Gemeinschaft sträubt. Sie ist alles in allem der Prototyp eines Individualisten, in ihre Ideen verrannt, schwer, wenn überhaupt, belehrbar und anderen Gedanken kaum zugänglich ... Mewes ist in ihrer Sucht, jeglicher Bindung auszuweichen, auch nicht der NSDAP beigetreten.“
Ende Juli 1943 wurde ihre Wohnung in der Meerweinstraße durch Bombenangriffe zerstört, ihre Bibliothek und ihre literarischen Texte, Grundlagen ihrer beruflichen Tätigkeit, verbrannten. Sie verließ Hamburg und fand gemeinsam mit ihren Eltern Aufnahme bei ihrer jüngsten Schwester in Passau. Dort begann Yvonne Mewes wieder zu unterrichten und hoffte, von der Hamburger Schulbehörde die Erlaubnis zu bekommen, in Passau bleiben zu dürfen. Ihr Gesuch sandte sie unter Einhaltung des Dienstweges an den Schulleiter Hans Lüthje, der es mit einem Begleitschreiben vom 4. September 1943 an die Schulbehörde weiterleitete. In diesem Schreiben zitierte er seinen vorangegangenen Brief an Yvonne Mewes: Er habe darauf hingewiesen, dass es Lehrern verboten sei, sich selbst eine Stelle zu suchen, und habe ihr verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen: Sie könne ausscheiden aus dem Schuldienst, zurückkehren nach Hamburg „und zwar sofort“, bleiben in Passau und an der Jungenschule unterrichten oder in Passau Hamburger Schulkinder unterrichten.
Yvonne Mewes hatte in Passau nach dem Verlust ihrer Wohnung wieder eine Wohnmöglichkeit, eine Stelle an einer Jungenschule, und sie lebte in der Nähe ihrer Schwester und deren Familie, sie hoffte, in dieser neuen Existenz bleiben zu können, aber die Schulbehörde lehnte ihr Gesuch ab. Sie erhielt den Befehl, bis zum 20. Januar 1944 wieder nach Hamburg zurückzukehren und zu unterrichten. Sie hatte dort keine Wohnung mehr. Die schriftliche Zusage, dass sie zunächst im Nachtwachenzimmer der Heilwig-Schule unterkommen könne, wurde nicht eingehalten. Harry Mewes Santo: „Die Walddörfer Schule für Mädchen, wo sie sich melden soll, hat keine Verwendung für sie. Verärgert umsonst entwurzelt zu sein, um bei einer Schule, die sie nicht braucht, anzutreten, folgt sie dennoch dem Befehl des Schulamts, beim Kinderlandverschickungsheim der Heilwig-Schule in Wittstock an der Dosse zum Dienst anzutreten.“
Ihre ehemalige Kollegin Anni Kuchel erinnerte sich im Jahr 1985, dass Schulleiter Lüthje bemüht gewesen sei, Yvonne Mewes zu „helfen“, sie werde „von NS unbehelligt bleiben“, wenn sie in Wittstock unterrichte. Er habe ihr eine Wohnmöglichkeit verschafft, wo sie allein leben konnte, und sich eingesetzt, „um die Behörde zu beruhigen“. Yvonne Mewes litt unter den Bedingungen und begab sich in Behandlung bei einem Nervenarzt. Sie ließ sich jedoch kein Attest geben, das ihr Dienstunfähigkeit bescheinigt hätte.
Ursula Randt erinnerte sich, dass ihre Lehrerin den Aufenthalt in Wittstock nur „mit großem Widerstreben“ ertrug. Sie schilderte eine Situation im Frühsommer 1944. Es war in der Französischstunde im HJ-Heim. Die Fenster standen offen, und die Wittstocker HJ war draußen zum Dienst angetreten, laute Kommandos waren zu hören. „Plötzlich wandte sich Yvonne Mewes brüsk um, schlug die Fenster heftig zu und sagte dann zornig, zu uns gewandt: Das ist ja nicht zu ertragen! Bei dem Gebrüll dieser sogenannten Führer kann man unmöglich unterrichten!“
Aus den Quellen ist nicht genau zu erkennen, ob Yvonne Mewes plötzlich abreiste, wie eine ehemalige Schülerin meinte beobachtet zu haben, oder ob sie von einem Aufenthalt in Hamburg nicht wieder nach Wittstock zurückkehrte.
Am 15. Juli 1944 schrieb sie ihre Kündigung aus dem Schuldienst. Ihrer Familie teilte sie mit, dass sie nervlich überfordert sei. Ihr Brief endet mit den Worten, die ihr Neffe Harry Mewes Santo in seiner Autobiographie zitiert: „Ich habe alle Anstrengungen gemacht auf rechtliche Weise aus meinem bisherigen Dienstverhältnis freizukommen. Es ist mir nicht geglückt, und ich habe den Eindruck, dass man von Seiten der Behörde darauf wartet, dass ich mich ins Unrecht setze. Wenn ich dies mit dieser Kündigung tue, so ist es meinerseits ein Schritt der Verzweiflung, denn ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, da versagen zu müssen, wo ich früher etwas leisten konnte.“ Sie wurde mehrfach in der Schulbehörde verhört. Die Kündigung war keine strafbare Handlung. Da die Schulbehörde ein Exempel statuieren wollte, wurde der Reichsstatthalter Karl Kaufmann eingeschaltet. Erst die Verweigerung eines Arbeitseinsatzes hätte gerichtlich verfolgt werden können. In diese Falle ging Yvonne Mewes nicht, sie kam dem Befehl zum Einsatz in der Flickstube der NS-Frauenschaft nach. Daraufhin übergab die Schulbehörde den „Fall Mewes“ der Gestapo. Wesentliches Gewicht hatte bei diesem Vorgehen der Bericht des Schulleiters vom 4. Juni 1943.
Als Yvonne Mewes am 7. September 1944 von der Behörde nicht zurückkam, erfuhr ihr Neffe Harry auf telefonische Nachfrage, dass seine Tante von der Gestapo „in Schutzhaft“ genommen sei und sich im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel befinde. Er brachte jeden zweiten Sonnabend ein Paket für sie zum Gefängnis und gab es dort ab, sehen durfte er sie nicht, und auf seine Fragen erhielt er keine Antwort.
„Drei Monate sind schon seit Yvonnes Verhaftung verstrichen, und wir sehen keinerlei Vorwärtskommen. Ich habe mich mit allen an ihrer Schule, der Behörde und dem Gericht, die irgendeinen Einfluss auf den Fall haben könnten, in Verbindung gesetzt und sie gebeten, sich für sie einzusetzen. Zu meinem Erstaunen teilt Herr Heinz, der Anklagevertreter, mir mit, dass das Gericht schon vor einiger Zeit die Klage gegen Yvonne wegen ungenügendem Grund zur Verurteilung eingestellt hat. Das klingt zwar ermutigend, hat aber bisher noch nicht zu ihrer Entlassung geführt. Im Gegenteil habe ich gehört, dass gewisse Leute am Schulamt empfohlen haben, sie für einen weiteren Monat in ein Erziehungslager zu schicken um ihr Gehorsam beizubringen.“
Bei einem Gespräch in der Schulbehörde eine Woche vor Weihnachten 1944 gab sein Gesprächspartner zu, dass er auch die lange Haftzeit besorgniserregend fände. Von Seiten der Behörde sei vor zwei Monaten beantragt, sie in ein „Erziehungslager des Arbeitsamtes“ zu überführen. Er werde dem Reichsstatthalter nahe legen, sich persönlich der Angelegenheit anzunehmen.
Die Hoffnung auf baldige Entlassung wurde bitter enttäuscht. Am 25. Dezember 1944 erfuhr Harry Mewes Santo, dass Yvonne Mewes nicht mehr in Fuhlsbüttel sei. Auf seine Frage erhielt er nur die Anweisung, sich an die Gestapo zu wenden. Das erschien ihm jedoch zu riskant in seiner Situation als „Mischling 1. Grades“.
Die Ungewissheit hatte ein Ende, als im Januar der Briefträger bei ihren Halbschwestern in Altona die Urne mit der Asche von Yvonne Mewes zustellte. In der beigefügten Todesurkunde des Standesamtes von Ravensbrück wurde als Todesursache „Herzschwäche“ angegeben.
Im Jahr 1950 fand ein Schwurgerichtsprozess gegen Dr. Hasso von Wedel und Prof. Dr. Ernst Schrewe, die früheren Leiter der Schulbehörde Hamburg, statt. Es wurde 11 Tage lang verhandelt, der Schulleiter Lüthje wurde als Zeuge geladen. Das Verfahren endete mit Freispruch. Ernst Schrewe wurde freigesprochen, da gegen ihn kein Tatverdacht gefunden wurde. Hasso von Wedel wurde freigesprochen, da er nach Erkenntnis des Gerichts im „übergesetzlichen Notstand“ gehandelt habe. Er habe gewollt, dass Yvonne Mewes in ein Arbeitserziehungslager gebracht werde, habe jedoch „Konzentrationslager“ geschrieben.
Im Jahr 1953 folgte der Revision des Staatsanwaltes der zweite Prozess gegen Hasso von Wedel. Eine Zeugin, die mit Yvonne Mewes im Gestapogefängnis Fuhlsbüttel war, sagte aus, dass sie „nicht unaufrichtig“ sein konnte. Von Wedel führte an, er fühlte sich durch den „Starrsinn gezwungen, ein Exempel zu statuieren“. Das Urteil lautete 8 Monate Haft für von Wedel.
Text: Stolperstein-Initiative Hamburg-Winterhude
Quellen:
[1] Für den gesamten Beitrag Mewes: Harry Mewes-Santo: Vom Dritten Reich zur Neuen Welt. Autobiographie (unveröffentlicht, liegt als CD vor); Harry Mewes-Santo: Bericht aus New York (wahrscheinlich geschrieben 1945/46); Exponate in der Ausstellung „Die Heilwigschule im ‚Dritten Reich‘ und ihr Neuaufbau nach 1945“ vom 21.1.2007 bis 14.2.2007; Aufzeichnungen von Frau Hagedorn, Aufzeichnung von Dr. Ursula Randt; Bericht des Schulleiters Dr. Hans Lüthje vom 4.6.1943; Begleitschreiben des Schulleiters Dr. Hans Lüthje vom 4.9.1943; Ursel Hochmuth, Hans-Peter de Lorent: Schule unterm Hakenkreuz. Hamburg 1985; Reiner Lehberger: Kinderlandverschickung: „Fürsorgliche Aktion“ oder „Formationserziehung“, in: R. Lehberger, H. P. de Lorent (Hrsg.): „Die Fahne hoch“, Schulpolitik und Schulalltag in Hamburg unterm Hakenkreuz. Hamburg 1986, S. 370-381; Rita Bake, Brita Reimers: Stadt der toten Frauen. Hamburg 1997, S. 307f.; Brief von Anni Kuchel vom 4.6.1985; Edith Oppens: „Sich selber treu“, in: „Die Welt“, 29.8.1950; „Hamburger Abendblatt“, Nr. 165, S. 3 vom 18./19. Juli 1998.
Yvonne Mewes, Lehrerin an der Hamburger Schule Curschmannstraße, weigerte sich 1942, in der Kinderlandverschickung als Lehrerin zu arbeiten, weil sie befürchtete, dort nationalsozialistische Propaganda in ihren Unterricht einbringen zu müssen. Es folgten mehrere Versetzungen. Ihre Kündigung wurde nicht angenommen. An ihr sollte ein Exempel statuiert werden. Der Fall ging an die Gestapo, die sie in die Haftanstalt Fuhlsbüttel brachte. Dort kam sie für längere Zeit in Dunkelhaft und erhielt keine Nahrung. Einen Tag vor Weihnachten 1944 wurde sie ins KZ-Ravensbrück gebracht. Wenige Wochen später starb sie an Hungertyphus. Die Beamten der Hamburger Schulbehörde Hasso von Wedel und Ernst Schrewe, die Yvonne Mewes denunziert hatten, wurde nach der Befreiung vom Nationalsozialismus der Prozess gemacht. Hasso von Wedel wurde 1953 in 2. Instanz zu 8 Monaten Gefängnis wegen Freiheitsberaubung im Amte mit Todesfolge verurteilt. Nach dem Straffreiheitsgesetz war ihm die Strafe allerdings erlassen worden. Ernst Schrewe erhielt in einem Disziplinarverfahren wegen "Dienstvergehens" einen Gehaltsabzug.
Antonie (Toni) Milberg
Gründerin und Leiterin einer höheren Mädchenschule, der Milberg Kursusschule



13.11.1854
Hamburg
–
1.9.1908
Wildungen
Hamburg
–
1.9.1908
Wildungen
Mehr erfahren
1888 kaufte Toni Milberg in der Esplanade 3 ein Schulhaus, in das sie mit ihrer Toni Milberg Kursusschule einzog. Heute stehen hier Kontorhäuser.
Toni Milberg, aus einer Kaufmannsfamilie stammend, verlor schon im Kindesalter ihren Vater. Die Halbwaise erhielt einen Schulunterricht, den sie als so anregend empfand, dass sie schon als Kind den Wunsch hegte, Lehrerin zu werden. Doch ihre Mutter war dagegen. Erst auf ihrem Sterbebett stimmte die Mutter dem Herzenswunsch ihrer Tochter zu.
Toni Milberg besuchte das Königliche Lehrerinnen-Seminar in Callenberg und machte dort 1876 ihr Lehrerinnenexamen. Dann wurde sie Lehrerin im Hause des Hamburger Hauptpastors an St. Jakobi, Pastor Calinich und leitete den damals für höhere Töchter - oder wie man auch sagte: für Töchter gebildeter Familien – üblichen Privatunterricht im kleinen Kreis. Diese Unterrichtsstunden wurden auch Kurse genannt und waren von Pastor Calinich für seine Töchter erarbeitet und eingerichtet worden.
In der Zeit dieser Tätigkeit machte Toni Milberg ihr Vorsteherinnen-Examen und erhielt nach dem Tod Calinichs von der Oberschulbehörde am 19.2.1883 die Erlaubnis, die Kurse zu übernehmen und fortzuführen. Toni Milberg entwickelte weitere Kurse und eröffnete am 13.3.1883 eine eigene Schule – die Milbergsche Kursusschule. Sie befand sich am Raboisen 53. Fünf Jahre später kaufte Toni Milberg ein eigenes Schulhaus an derEsplanade Nr. 3. Als die Räume auch dort nicht mehr ausreichten, erwarb sie ein Grundstück in der Klopstockstraße 17 (heute: Warburgstraße).
Über 25 Jahre bis zu ihrem Tod leitete Toni Milberg die Schule zusammen mit ihrer Freundin Martha Krecke, der sie sie vermachte. Als Toni Milberg starb, hieß es in einem Nachruf: „Für sie waren nicht der Lehrstoff und die Schulregeln das Wesentliche, sie soll im besten Sinne Erzieherin gewesen sein, legte besonderen Wert auf die Bildung von Charakter und Gemüt und genoss das Vertrauen und die Verehrung vieler Familien.“
Am 25. April 1912 erhielt die von Martha Krecke weitergeführte zehnklassige höhere Mädchenschule, die bis 1926 unter dem Namen „Milberg Lyzeum“ bekannt war, die Anerkennung als höhere Lehranstalt. 1926 wurde die Schule in „Milberg-Realschule“ und ab 1937 in „Milberg-Schule, Oberschule für Mädchen“ umbenannt.
Seit 1926 berechtigten die Zeugnisse der 10. Klasse zum Besuch der Obersekunda einer Mädchen-Oberrealschule. Ab 1931 schließlich durfte die Schule den Schülerinnen des realgymnasialen Zuges das Reifezeugnis zum Eintritt in ein Realgymnasium erteilen. Zwei Jahre später wurden der Schule bis 1935 zwei Waldorf-Klassen der „Freien Schule Altona“ angegliedert. Doch am 14.12.1937 kam das „Aus“ für die Schule. „Unter der Einwirkung der Schulreform, des Abbaus der Unterklassen und des Erlasses an die Beamten“, so die damalige Leiterin der Milberg-Schule, Bertha Schmalfeldt an die Schulbehörde, müsse ihre Schule zum Ende des Schuljahres schließen“.
Text: Rita Bake
Quellen:
Renate Hauschild-Thiessen: Tony Milberg (1854-1908) und ihre Schule, in: Hamburgische Geschichts- und Heimatblätter, Bd. 13, Heft 11, April 1997.
Die Trauerfeier für Antonie Milberg, in: Hamb. Correspondent vom 5.9.1908.
Trauerrede für Antonie Milberg, gehalten von Herrn Senior D. Behrmann im Schulhause, Klopstockstraße 17.
Mathilde Möller
Urheberin der Bewegungsspiele für Mädchen



20.1.1867
Altona
–
9.2.1925
Hamburg
Altona
–
9.2.1925
Hamburg
Mehr erfahren
Mathilde Möller arbeitete in Hamburg als Lehrerin. In ihrer Zeit als Lehrkraft an der Mädchenvolksschule Lutterothstraße im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel hatte sie eine bahnbrechende Idee. Sie initiierte als erste Lehrkraft die Bewegungsspiele für Mädchen. So zog sie Anfang der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts mit ihren Schülerinnen in den Sternschanzenpark, um sie im Schlag- und Wurfball zu unterrichten. Das war damals ein sehr gewagtes Unterfangen. Mathilde Möller hatte schwere Kämpfe gegen die Gleichgültigkeit der Eltern wie der Kollegen und Kolleginnen aus der Lehrerschaft zu bestehen. Man hielt diese Sportübung zwar für Jungen, aber nicht für Mädchen geeignet. Doch Mathilde Möller ließ sich nicht beirren und vertrat öffentlich die Meinung, dass Mädchen diese Übungen zu ihrer Ertüchtigung viel nötiger hätten als Jungen. Der Protest gegen diese angeblich unweiblichen Sportübungen ging sogar so weit, dass Schuljungen diese Sportstunden störten, weshalb sie längere Zeit unter polizeilichem Schutz durchgeführt werden mussten. Doch im Laufe der Jahre gelang es dem von Mathilde Möller gegründeten "Verein für Jugendspiele für Mädchen" dem neuen Gedanken Verbreitung zu verschaffen. Heute sind solche sportlichen Spiele eine Selbstverständlichkeit für Mädchen und Frauen.
Dr. h.c. Erna Mohr
Zoologin von internationalem Rang


Der Verein Garten der Frauen gesellte dem Grabstein von Erna Mohr die Skulptur einer Baumratte hinzu. Erna Mohr beobachtete und untersuchte das Verhalten von Baumratten.

11.7.1894
Hamburg
–
10.9.1968
Hamburg
Hamburg
–
10.9.1968
Hamburg
Mehr erfahren
Da Erna Mohr das Verhalten der Baumratten erforschte, ließ der Verein Garten der Frauen eine aus Sandstein geschaffene Baumratte neben ihren Grabstein setzen.
Als Tochter eines Lehrers schlug Erna Mohr ebenfalls die Lehrerinnenlaufbahn ein, obwohl ihre Liebe der Natur und den Tieren galt. Ihre Schulferien verbrachte sie auf dem Lande in Wischreihe bei Siethwende (Kreis Steinburg) und half dort in Hof und Stall. Im Alter von 18 Jahren nahm sie am 1843 gegründeten, weltberühmten Zoologischen Museum am Steintorplatz eine Tätigkeit als Spinnenzeichnerin an. Auch während ihrer Ausbildung und später dann als Lehrerin – von 1914 bis 1919 war sie an der Volksschule für Mädchen am Rhiemsweg, von 1919 bis 1930 in den gemischten Klassen der Hilfsschule Bramfelder Straße und von 1930 bis 1934 in der Volksschule am Alten Teichweg tätig – arbeitete sie weiterhin am Zoologischen Museum. So wurde sie 1913 Mitarbeiterin in der Fischereibiologischen Abteilung bei Professor Ehrenbaum. Hier gelang es ihr, Altersbestimmungen bei Fischen anhand von Ctenoidschuppen durchzuführen – eine wissenschaftliche Pionierleistung. Nach einiger Zeit wechselte Erna Mohr in die Abteilung für niedere Wirbeltiere, wo sie sich in die Systematik der Fische einarbeitete und auf diesem Gebiet viele wertvolle Arbeiten veröffentlichte, die ihr internationale Anerkennung einbrachten.
In der Museumsabteilung für niedere Wirbeltiere wurde Erna Mohr vertraut mit der Anlage von Sammlungen und deren Ordnung. Sie erkannte die Wichtigkeit dieser Arbeiten für die Wissenschaft und setzte sich das Ziel, möglichst viele Bestände dem Museum zuzuführen. Dabei halfen ihr ihre plattdeutschen Sprachkenntnisse, denn dadurch kam sie schnell mit den Menschen auf dem Lande in Kontakt, von denen sie so manches Stück für ihre Sammlung erhielt.
Als 1934 ihr Chef, Professor Duncker, in Pension ging, wurde Erna Mohr aus dem Schuldienst beurlaubt, um die Abteilung für niedere Wirbeltiere zu übernehmen. Dort bewies sie enormes didaktisches Talent, als sie die öffentliche Schausammlung neu gestaltete. Überhaupt war es Erna Mohr ein großes Anliegen, ihr Fachwissen so verständlich wie möglich zu vermitteln, um auch einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu ihren Forschungen zu verschaffen.
1936 folgte ein neuer Schritt: Erna Mohr erhielt auch die Abteilung für höhere Wirbeltiere und damit die Verantwortung für entscheidende Teile der Schausammlung des alten Zoologischen Museums.
Erna Mohr war so fasziniert von ihrer Arbeit, dass sie selbst während des Zweiten Weltkrieges ihre als Soldaten eingezogenen Kollegen bat, im Feld Mäuse zu sammeln und sie ihr zwecks Bestimmung der verschiedenen Arten zu schicken.
Erna Mohr trat während der NS-Zeit in keine NS-Organisation ein. (Staatsarchiv Hamburg, 221-11 Ed 16074)
1943 zerstörten Bomben Erna Mohrs Werk. Sie ließ sich jedoch nicht entmutigen und machte sich sofort nach dem Krieg an den Wiederaufbau der Sammlungen. Als Anerkennung für ihren Einsatz wurde sie an 1.Januar 1946 von der Hochschulverwaltung als Kustos der Wirbeltierabteilung des Zoologischen Museums übernommen. Prof. Wolf Herre schrieb in einem Nachruf auf Erna Mohr: „Sie hat eine schwere Aufgabe gemeistert, weil sich damals in der Zeit der Raumnot in der Öffentlichkeit aber auch in der Wissenschaft eine Strömung breit zu machen versuchte, welche in der Hortung von Beständen für spätere Arbeiten keine Aufgabe oder gar Verpflichtung sah. Erna Mohr war in ihrem Idealismus von der Notwendigkeit des Sammelns von Material für spätere Arbeiten anderer Forscher durchdrungen. Sie empfand, dass Zeugnisse tierischer Mannigfaltigkeit in wissenschaftlichen Sammlungen eine der entscheidenden Grundlagen für die Zoologie als einer sicher fundierten Wissenschaft sind. (…) Erna Mohr hat ihre Überzeugung nicht nur in Hamburg durchzusetzen gewusst. Sie arbeitete in Museen vieler Städte und wies auch dort auf die Notwendigkeit des Sammlungsausbaus hin. Erna Mohr suchte auch kleine alte Museen auf, welche dem Untergang geweiht schienen. Dort hob sie die Schätze und verstand die Verantwortlichen mit schlichten, eindringlichen Worten über die Bedeutung dieser Bestände für die Geschichte der Wissenschaft und für zukünftige Forschungen zu überzeugen“[1].
Noch heute besteht der von ihr zusammengetragene Grundstock der wissenschaftlichen Sammlung. Und auch darin lebt sie weiter: in den Etiketten an den Sammlungsstücken. Die ließ sie nicht schreiben, das machte sie lieber selbst. Aber sie lebt auch weiter in ihren ca. 400 Veröffentlichungen. Gekleidet in einen Lodenmantel, mit Wanderschuhen an den Füßen und einer Einkaufstasche aus Plastik am Arm, in der ihre Manuskripte lagen, begab sie sich zu ihren Verlegern. Zuhause in ihrer Wohnung am Kraemerstieg warteten ihre Dackel und eine große Menagerie aus Porzellantieren auf sie.
Erna Mohr erhielt hohe Auszeichnungen und Ehrungen: 1944 wurde sie zum Mitglied der Kaiserlichen-Leopoldinisch-Karolinischen Akademie der Naturforscher in Halle berufen. 1950 erhielt sie von der Universität München die Ehrendoktorwürde, und 1954 wurde sie Ehrenmitglied des „Verbandes deutscher Zoodirektoren“. Letztere Ehrung begründete sich auf dem engen Kontakt, den Erna Mohr zu den Zoodirektoren Deutschlands hielt.
Bereits als 20-Jährige hatte sie die Zoologischen Gärten bereist und sie photographiert. Daraus entstand eine umfangreiche Dokumentensammlung über die Entwicklung der Zoologischen Gärten Deutschlands. Diese Zoobesuche waren für Erna Mohrs Forschungen sehr wichtig: „Bedeutsam waren die Anregungen, welche sie durch die Besuche erhielt: die Säugetiere und ihre Biologie rückten immer stärker in der wissenschaftlichen Tätigkeit von Erna Mohr nach vorn. Sie nahm sich mancher Merkmale an, welche andere Forscher vernachlässigten, weil sie spürte, dass sich Großes auch im Kleinen verbergen kann. Kennzeichnend dafür ist schon ihre erste Arbeit über Säugetiere, die im Biologischen Zentralblatt 1917 erschien und sich mit dem `Knacken´ der Rentiere beim Laufen befasste“,1) berichtete Professor Wolf Herre. Und um noch ein weiteres „kleines“ Thema zu nennen: Erna Mohr schrieb auch über „Ohrtaschen“ und andere taschenähnliche Bildungen am Säugetierohr (1952).
Erna Mohr leistete viel für den Naturschutz, aber nicht auf einer sentimentalen Ebene, wie Prof. Schliemann vom Zoologischen Institut, der Erna Mohr noch persönlich kannte, betont. Sie kämpfte für einen wissenschaftlich begründeten Naturschutz. So setzte sie sich für das vom Aussterben bedrohte europäische Wisent ein und arbeitete im Vorstand der „internationalen Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents“. Einer ihrer Spitznamen war „Wisent-Mama“. Sie wurde die erste Zuchtbuchführerin aller in den Zoos lebenden Wisente und erreichte dadurch, dass die europäischen Wisente nicht mit ihren nordamerikanischen „Verwandten“ gekreuzt wurden.
Auch den Fledermäusen widmete sie sich. Sie war der erste Mensch, dem es gelang, verwaiste Fledermausbabys mit einem Puppenschnuller großzuziehen. Daneben waren auch Ratten, Birkenmäuse, Kängurus, Schlitzrüssler, Leoparden und Robben ihre Schützlinge.
Erna Mohr befasste sich auch intensiv mit der Tierwelt Schleswig-Holsteins. Im Rahmen dieser Studien begann Erna Mohr Tiere zu halten. Professor Wolf Herre schrieb dazu: „Ich erinnere mich noch immer, wie Erna Mohr mit ihren dicken, großen Baumratten auf der Galerie des alten Zoologischen Museums umherwandelte, diese seltsamen Tiere belauschte und in ihren Eigenarten kennenlernte. (…) Erna Mohr hat als einer der Pioniere auf dem Gebiet der Verhaltensforschung der Säugetiere zu gelten. Erna Mohr hat stets auf Experimente verzichtet und Einsichten vom unbeeinflussten Tier erstrebt. Daß dies eine Verfahren von außerordentlichem Wert ist, wird heute immer klarer anerkannt“1).
Als Erna Mohr 1968, im Alter von 74 Jahren, starb, trafen aus ganz Europa Kranzspenden und Kondolenzschreiben ein. Vertreter zoologischer Gesellschaften und von Tiergärten der Bundesrepublik nahmen am feierlichen Abschied teil. 1984 wurde im Stadtteil Bergedorf eine Straße (Sackgasse!) nach ihr benannt:Erna-MOhr-Kehre.
Im selben Jahr wurde aus dem Zoologischen Staatsinstitut und dem Zoologischen Museum das Zoologische Institut und Zoologische Museum der Universität Hamburg. Ihren Sitz haben das Institut und das Museum heute am Matin-Luther-King-Platz in Hamburg.
Text: Rita Bake
Zitat:
[1] Zeitschrift für Säugetiere. Bd. 33.1968.
Im Alter von 18 Jahren nahm die Lehrerstocher am Zoologischen Museum am Steintorplatz in Hamburg eine Tätigkeit als Spinnenzeichnerin an. Auch während ihrer späteren Arbeit als Lehrerin war Erna Mohr am Zoologischen Museum tätig. 1934 wurde Erna Mohr aus dem Schuldienst beurlaubt und übernahm die Museumsabteilung für niedere Wirbeltiere. Sie bewies enormes didaktisches Talent bei der Neugestaltung der öffentlichen Schausammlung. 1936 übernahm Erna Mohr auch die Leitung der Abteilung für höhere Wirbeltiere. Noch heute besteht der von ihr zusammengetragene Grundstock der wissenschaftlichen Sammlung. Über 400 Veröffentlichungen gibt es von ihr. Ihre Manuskripte trug sie, gekleidet in einem Lodenmantel und Wanderschuhen, in einer Plastik-Einkaufstasche zu ihren Verlegern. Erna Mohr erhielt hohe Auszeichnungen. Sie befasste sich mit dem "Knacken" der Rentiere beim Laufen, schrieb über Ohrtaschen am Säugetierohr, setzte sich für das vom Aussterben bedrohte europäische Wisent ein , wurde "Wisent-Mama" genannt und war die erste Zuchtbuchführerin aller in Zoos lebenden Wisente. Sie war der erste Mensch, der Fledermausbabys mit einer Puppennuckelflasche großzog, hielt im Zoologischen Museum Baumratten und erforschte deren Verhalten. Erna Mohr war eine der PionierInnen auf dem Gebiet der Verhaltensforschung von Säugetieren.
Domenica Anita Niehoff
Kämpferin für die Rechte der Huren, Streetworkerin, St.Paulis großes Herz



3.08.1945
Köln
–
12.02. 2009
Hamburg-Altona
Köln
–
12.02. 2009
Hamburg-Altona
Mehr erfahren
Domenica Niehoff ist im Garten der Frauen bestattet worden. Ihr Grabstein wurde vom Verein Garten der Frauen konzipiert und von der Steinmetzfirma Carl Schütt & Sohn gespendet.
Domenica Niehoff, Tochter einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters, wuchs bis zu ihrem 14. Lebensjahr zusammen mit ihrem Bruder in einem katholischen Waisenhaus auf. Nach einer Ausbildung als Buchhalterin heiratete sie 1962 einen Bordellbesitzer. 1972 begann sie, in der Herbertstraße auf St. Pauli als Prostituierte zu arbeiten. Sie war Inspiration und Muse für viele Künstler.
Anfang der 80er Jahre erlangte Domenica bundesweit Berühmtheit, weil sie sich öffentlich als Hure bekannte und sich als eine der Ersten für die Legalisierung der Prostitution engagierte. Ihre Berühmtheit nutzten viele so genannte Prominente zur eigenen Selbstdarstellung. 1990 stieg sie endgültig aus der Prostitution aus. Obwohl sie sich für die Akzeptanz der Huren stark machte, sah sie klarsichtig die menschenverachtenden Arbeitsbedingungen und Ausbeutungsverhältnisse in der Prostitution. "Sie war wütend auf diejenigen, die die Prostitution glorifizierten", so der Photograph Günter Zint, mit dem Domenica eng befreundet war.
1991 begann Domenica, als Streetworkerin in Hamburg-St.Georg zu arbeiten. Sie war Mitinitiatorin des Hilfsprojektes "Ragazza e.V." und betreute bis 1997 drogenabhängige Mädchen auf dem Straßenstrich.
1998 eröffnete Domenica eine Kneipe am Hamburger Fischmarkt, die sie bis zum Jahr 2000 betrieb.
Nach dem Tod ihres Bruders 2001 lebte sie in dessen Haus in Boos in der Eifel, bevor es sie 2008 wieder auf den Hamburger Kiez zurückzog. Dort wohnte sie in der Talstraße und war bis zu ihrem Tod immer wieder Anlaufstelle für Bedürftige. Sie starb an einem Lungenleiden. Information zum Grabstein
Hilge Nordmeier
geb. Stuhr
Mitglied (SPD) der Hamburgischen Bürgerschaft



5.7.1896
Hamburg
–
9.9.1975
Hamburg
Hamburg
–
9.9.1975
Hamburg
Mehr erfahren
Hilge Stuhr heiratete 1920 den kaufmännischen Angestellten Carl Otto Nordmeier (1890-1954). 1922 zog sie mit ihm in den Rüsternkamp 12, 1) eine Straße in der Steenkampsiedlung. "Die Steenkampsiedlung in Hamburg-Bahrenfeld ist eine als Gartenstadt nach dem Ersten Weltkrieg angelegte Siedlung, die der Versorgung von Familien mit geringem Einkommen und Kriegsheimkehrern mit Wohnraum dienen sollte." 2) Carl Nordmeier gehörte zu den Gründungsmitgliedern dieser Heimstättenvereinigung und war viele Jahre im Vorstand. 3)
Nach ihrer Heirat wurde Hilge Nordmeier Hausfrau. Das Paar blieb kinderlos.
Hilge Nordmeier und ihr Mann gehörten der SPD an. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus gehörte Hilge Nordmeier als SPD-Abgeordnete der ersten frei gewählten Hamburgischen Bürgerschaft nach dem Zweiten Weltkrieg an (Oktober 1946 bis August 1949).
Gewählt wurden 17 Frauen und 93 Männer. 15 Frauen gehörten der SPD, eine der KPD und eine der FDP an. Zehn der Frauen bezeichneten sich als "Hausfrau". Diese Einstufung entsprach dem als "natürlich" geltenden traditionellen Rollenverständnis, das die Frauen zu diesem Zeitpunkt nicht hinterfragten, war doch die Funktion der Hausfrau entscheidend für das Überleben und dadurch im öffentlichen Bewusstsein auch als gesellschaftlich wichtig anerkannt.
Nach dem Ende der ersten Wahlperiode
wurde Hilge Nordmeier in die Bezirksversammlung Altona gewählt, der sie von 1949 bis 1961 angehörte.
Quellen:
1) Vgl.: Bettina Herrmann: Hilge Nordmeier, in: Die Steenkamper vom 21.6.2020, unter: https://www.steenkamper.de/
2) Wikipedia: Steenkampsiedlung, abgerufen: 25.6.2020 unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Steenkampsiedlung
3) Vgl.: Bettina Herrmann, a. a. O.
Hermine Peine
geb. Kreet
Bürgerschaftsabgeordnete, Mitbegründerin der AWO Hamburg



19.9.1881
Hamburg
–
19.8.1973
Hamburg
Hamburg
–
19.8.1973
Hamburg
Mehr erfahren
Schon vom Elternhaus her war Hermine Peine seit Kindertagen vertraut mit gewerkschaftlichen und politischen Fragen. Ihr Vater, der Schneider Heinrich Kreet, geboren 1837 in Adensen bei Hannover, hatte sich Ende der 1850er Jahre in Hamburg niedergelassen und sich politisch im Allgemeinen deutschen Arbeiterverein engagiert. Bereits 1865 wählten ihn die Kollegen in die Verwaltung der Kranken- und Unterstützungskasse der Schneider, und er wurde 1887 Bevollmächtigter des Krankenunterstützungsbundes. 1902 wurde er zum Vorsitzenden des Verbandes der Schneider gewählt. Am 26. Januar 1897 leistete Heinrich Kreet den Hamburger Bürgereid.
Wahrscheinlich in zweiter Ehe heiratete er Luise, geb. Wellhöfer (1852-1928) aus Großrudestadt (Sachsen-Weimar), die Mutter von Hermine. 1895 lebte die Familie in der Wexstraße 13, danach bis 1900 in der Fuhlentwiete 13, ab 1902 in der Düsternstr. 53, wo Heinrich Kreet am 14.2.1916 verstarb.
Hermine Peine lernte nach Beendigung der Volksschule (1888-1896) in Oldenburg ein Jahr Haushalt und arbeitete bis zur Eheschließung als Hausangestellte. Am 11. April 1902 heiratete sie den Schneidermeister Andreas Friedrich [K]Carl Peine (1871-1939) aus Erxleben. Sie lebten zuerst in der Neuen ABC-Straße, dann in der Kleinen Rosenstraße und ab ca. 1933 in der St. Georgstraße 6. Das Paar hatte zwei Kinder: Hertha (1906-1982) und Kurt (1908-1991).
Am 20.10. 1905 leistete Andreas Peine den Hamburger Bürgereid und am 16.10.1907 erhielt er seine Gewerbeanmeldung als selbstständiger Schneider. Er starb am 27.1.1939.
Hermine Peine war seit 1908 Mitglied der SPD. Von 1922 bis 1929/30 saß sie als Beisitzerin im Vorstand der SPD (Vorsitz: Leuteritz). 1924 wurde sie für die SPD Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft und gehörte ihr bis 1933 an.
Hermine Peine engagierte sich ehrenamtlich in der Sozialfürsorge. Sie war in den Notjahren nach dem Ersten Weltkrieg als Sozialfürsorgerin tätig und gehörte seit 1919 der Deputation der Wohlfahrtsbehörde und dem Ausschuss für die staatlichen Heimeinrichtungen an. 1920 war sie Mitbegründerin des "Hamburger Ausschusses für soziale Fürsorge" (Arbeiterwohlfahrt/AWO). Durch ihre Arbeit in sozialen Ausschüssen kannte sie die Situation der Armen und Alten in den Heimen und Stiften und setzte sich intensiv für eine würdige Unterbringung alter Menschen ein, von denen viele durch die Wirtschaftskrise und deren Folgen veramt waren. (vgl.: StA.351-101-Signatur StW 26. 10 und 26.13).
Im Juli 1929 übernahm sie die Leitung des staatlichen Altersheims in Groß Borstel. Es war das erste staatliche Altersheim, das von der Stadt Hamburg errichtet wurde. Es bot den Bewohnerinnen und Bewohnern abgeschlossene Ein- und Zweizimmerwohnungen mit Kochgelegenheit, eine Neuerung für damalige Zeiten.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde Hermine Peine politisch verfolgt. 1934 durchsuchte die Gestapo ihre Wohnung. Ein Jahr zuvor war sie am 28. Juni 1933 aus ihrem Dienst entlassen worden und war fortan arbeitslos. Drei Jahre lang lebte sie von Arbeitslosenunterstützung. Danach konnte sie sich finanziell nur dadurch über Wasser halten, weil sie Untermieter in ihrer Wohnung aufnahm und ihre Kinder sie unterstützten.
1940 begann gegen Hermine Peine ein Prozess wegen "Wehrkraftzersetzung", der eingestellt wurde, weil die gegen sie erhobenen Vorwürfe nicht bewiesen werden konnten.
1939 war Hermine Peine in die Lübeckerstraße 31 gezogen, wo sie in der Nacht vom 27./28.7. 1943 ausgebombt wurde.
Nach dem missglückten Attentat auf Hitler war Hermine Peine im August 1944 als "politisch unzuverlässig" für zehn Tage im KZ Fuhlsbüttel inhaftiert.
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus engagierte sich Hermine Peine wieder in der Hamburger Arbeiterwohlfahrt und war seit 1945 deren stellvertretende Vorsitzende.
Die Britische Militärregierung setzte sie zum 1. September 1945 wieder als Leiterin des Altersheims in Groß Borstel ein. Diese Funktion hatte sie bis zu ihrer Pensionierung im Jahre 1949 inne.
Nach ihrer Pensionierung zog Hermine Peine, die seit September 1945 in einer Dienstwohnung an der Borsteler Chaussee 301 gewohnt hatte, in eine Einzimmerwohnung am Kreuzweg 2. 1965 bezog sie ein Zimmer im Altenheim Groß Borstel, wo sie bis zu ihrem Tod am 19.8.1973 lebte, das letzte Jahr auf der Pflegestation..
Für ihre Verdienste erhielt Hermine Peine am 29.3.1949 die "Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes" in Bronze.
Text: wesentliche Inhalte von Ingrid H. Verch
Quelle:
Vgl: AWO Landesverband Hamburg: Arbeiterwohlfahrt in Hamburg. Eine Idee setzt sich durch - exemplarisch dargestellt an bedeutsamen Frauen der AWO. Hamburg 2015.
Johanne Reitze
geb. Leopolt
Führende Funktionärin der sozialdemokratischen Frauenbewegung



16.1.1878
Hamburg
–
22.2.1949
Hamburg
Hamburg
–
22.2.1949
Hamburg
Mehr erfahren
Johanne Reitze entstammte einer Arbeiterfamilie. Nach dem Besuch der Volksschule arbeitete sie als Dienstmädchen, später als Arbeiterin in einer Druckerei. Dort lernte sie Kollegen und Kolleginnen kennen, die sie mit der Arbeiterbewegung vertraut machten, so dass Johanne Reitze 1902 den Entschluss fasste, in die SPD einzutreten. Zwei Jahre zuvor hatte sie den sozialdemokratischen Journalisten Johannes Carl Kilian-Reitze geheiratet. Auch er wird ihren politischen Weg beeinflusst haben. Gemeinsam besuchten sie 1904 für ein halbes Jahr die SPD-Parteischule in Berlin.
Von 1908 bis 1919 war Johanne Reitze Vorstandsmitglied im Landesvorstand der Hamburger SPD und bis 1931 regelmäßig Delegierte bei den SPD-Frauenkonferenzen und SPD-Parteitagen auf Reichsebene. Während des Ersten Weltkrieges engagierte sie sich besonders in der Kriegshilfe, nachdem die SPD-Reichstagsfraktion für die Bewilligung der Kriegskredite gestimmt und die Genossinnen zu einer "allgemeinen Hilfsaktion" aufgerufen hatte. Diese Aufforderung entsprach der Burgfriedenspolitik, die die Mehrheit in der SPD-Führung seit Kriegsbeginn in dem Glauben betrieb, Deutschland führe einen "Verteidigungskrieg gegen den russischen Despotismus".
Johanne Reitze fungierte als Beiratsmitglied des Hamburger Kriegsversorgungsamtes sowie des Speiseausschusses der Kriegsküchen und arbeitete für die Kriegsfolgehilfe und die Kriegshinterbliebenenfürsorge.
Von 1919 bis 1921 war sie Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, von 1919 bis 1933 Mitglied des reichsweiten SPD-Parteiausschusses.
Ein Höhepunkt ihrer Parteikarriere war die 1919 erfolgte Wahl in die Nationalversammlung. 310 Frauen waren für die Wahl aufgestellt worden. Neben Johanne Reitze wurden noch weitere 36 Frauen und 386 Männer gewählt. Aus dem Wahlkreis Hamburg kamen neben Johanne Reitze noch vier Männer. Bis 1928 blieb Johanne Reitze die einzige weibliche Reichstagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Hamburg. Sie gehörte von 1919 bis 1932 als Abgeordnete des Wahlkreise Hamburg dem Reichstag an. Die Hauptbetätigungsfelder der Politikerinnen waren die "angestammten" so genannten Frauenbereiche wie Sozialpolitik, Wohlfahrtspflege, Jugend-, Gesundheits- und Schulpolitik. Dadurch war es den Politikerinnen nicht möglich, auf allen Politikfeldern die Interessen der Frauen einzubringen. Die "Große Politik" richtete sich weiter nach den Interessen der männlich dominierten Gesellschaft.
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde Johanne Reitze 1944 von der Gestapo verhaftet und kam in "Schutzhaft". Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie am Wiederaufbau der Arbeiterwohlfahrt beteiligt.
Celly de Rheidt
geb. Funk, verh. Seweloh
Eine der Pionierinnen des Nackttanzes in der Neuzeit

Celly de Rheidt (rechts)



25.3.1889
Altona
–
8.4.1969
Hamburg
Altona
–
8.4.1969
Hamburg
Mehr erfahren
Als Anna Cäcilie Marie Funk wurde sie als Tochter der adligen Mette Maria von der Reith und des Schiffskapitäns Jürgen Diedrich Funk in Altona geboren. Unter ihrem Künstlerinnennamen Celly de Rheidt wurde sie nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er bekannt.
Celly de Rheidt gilt als eine der ersten Nackttänzerinnen der Neuzeit. 1914 - im Todesjahr ihrer Mutter, ihr Vater war bereits durch Suizid gestorben, als Celly 15 Jahre alt war - heiratete sie den zwei Jahre älteren Kaufmann und Leutnant Alfred Seweloh. Er soll auch als Heiratsvermittler aufgetreten sein und sein Institut beworben haben mit dem Slogan: "3000 schöne Frauen suchen einen Partner". Diese Geschäftsidee brachte ihm die Verurteilung zu zwei Jahren Gefängnis wegen Kuppelei und zu fünf Jahren Ehrverlust ein. 1)
Als nach dem Ersten Weltkrieg große Teile des Bürgertums nicht mehr über genügend finanzielle Mittel verfügten, um ein "standesgemäßes" Leben führen zu können, erkannte der ehemalige Leutnant Seweloh, womit Geld zu verdienen war: mit jungen schönen Frauen, die nackt tanzten. Damit war die Celly de Rheidt Tanzgruppe "geboren".
Cellys Ehemann begründete 1919 die Nackttanzdarbietungen wie folgt: "unsere notleidenden Menschen, zerbrochen (….) durch den schrecklichsten aller Kriege, sind in einen düsteren Alltag hinabgesunken. Wir hoffen Schönheit in seiner reinsten und originalen Form zu bringen, (…)." 4)
Laura Nickel analysiert: "In der zermürbten Gesellschaft der Nachkriegszeit mutierte der Nackttanz in den Varietés zu einem Ventil für die"‚[psychische] Depression nach dem verlorenen Krieg". Franz-Peter Kothes beurteilt diese Veränderung wie folgt: "Die Ventilfunktion des Tanzes, der Mode, der Libertinage beeinflusste das von der Zensur befreite Theater und besonders die Ausstattungsrevue. Dies hilft die epidemische Verbreitung zu erklären, die die Nudität zu Anfang der Zwanziger in der Revue fand."" 5)
Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts war es zu ersten Nackttanz-Darstellungen gekommen. Auf "Schönheitsabenden", meist vor geschlossener Gesellschaft, präsentierten sich Frauen entweder in Ganzkörpertrikots, die Nacktheit vortäuschen sollte, aber auch nackt mit z. B. Schleiertänzen, einem ausgewähltem, meist männlichen zahlendem Publikum. 2)
Auch Celly de Rheidt trat zuerst bei "Schönheitsabenden" auf, die zu Anfang "privat in der Wohnung des Verlegers Wilhelm Borngräber statt[fanden]. Unter das Publikum mischten sich weibliche Prostituierte, die sich den von der Nacktheit erregten männlichen Zuschauer im Anschluss an die Vorstellungen anboten.
"[...] später jedoch konnten die Privatveranstaltungen nicht mehr mit den Reizen der Prostitution mithalten: Dort [in einem Bordell] konnte der Kunde "mehr" zu einem besseren Preis bekommen."" 3)
Celly de Rheidts Tanzgruppe bestand aus rund fünf 14 bis 20jährigen jungen Frauen, die nur von Schleiern verhüllt, z. B. griechische Friese nachstellten und wurde von Celly de Rheidt selbst geleitet. Skrupel wegen der Minderjährigkeit einiger Tänzerinnen hatte man nicht. Den Conférencier bei diesen Darbietungen, die in Revuetheatern vorgeführt wurden, machte Cellys Ehemann Alfred Seweloh.
1920 konnte Celly de Rheidt für eine Saison über eine eigene Bühne in der Berliner Motzstraße verfügen. Ein Jahr später trat Celly de Rheidts Tanzgruppe im legendären Nelson-Theater am Kurfürstendamm 217 auf. "Das Grundkonzept", so Michael Brettin in seinem Artikel "Die nackte Wahrheit über Berlin. "Babylon Berlin" wie es wirklich war", "ist an allen drei großen Revuetheatern gleich: eingängige Tanz- und Gesangsnummern, ein paar Sketche und ein paar Stars, viel Exotik und Erotik. Dass es ein großes Publikum für Erotik auf der Bühne gibt, weiß die Branche seit den überraschend erfolgreichen Auftritten des Celly-de-Rheidt-Balletts im Nelson-Theater 1921. Rudolf Nelson, der an seinem Haus an der Ecke Kurfürstendamm/Fasanenstraße nur anspruchsvolles Kabarett macht, hatte sich [von Celly de Rheidts Ehemann] überreden lassen, in der spielfreien Sommerzeit die Bühne der ersten Nackttanztruppe der Republik zu überlassen." 6)
Die Tänzerinnen verfügten über keine professionelle Tanzausbildung. Meist boten sie kurze Pantomimen, die z. B. "Der Vampir", "Salome" oder "Opiumrausch" hießen. Für diese Darbietungen gab es ein zahlungskräftiges, meist männliches Publikum. Deshalb konnten auch hohe Eintrittspreise genommen werden. "Das männliche Publikum wollte einiges mehr zu sehen bekommen, als im täglichen bürgerlichen Umfeld erlaubt war. (…)." 7)
Bettina Müller schreibt in ihrem Artikel "Die Anziehung der Ausgezogenen", veröffentlicht in der taz vom 9.3.2019: "Die Meinungen über die Nackttänzerin divergieren, entweder liebt man oder man verachtet sie. Einige wollen dennoch einen künstlerischen Anspruch ihrer Tänze erkennen, wie etwa Hanna Berger (selbst Tänzerin) in einem Zeitschriftenartikel schrieb: "Der Körper, der im wahrsten Sinne des Wortes entfesselt wird, bewegt sich ungehemmt in große räumlicher Entbundenheit." Das ist moderne Tanzkunst mit Tendenz zum Expressionismus, der von Künstlern wie zum Beispiel Josef Fenneker auch für die Werbeplakate der Tanzveranstaltungen in Varietés und Kabaretts aufgegriffen wird.
Diese Form des für viele allzu freien Tanzes trifft jedoch oft auf Unverständnis. Manche Kritiker werden daher schnell beleidigend. Celly de Rheidt habe "zu viel Speck auf den Rippen", sei nicht besonders schön und eigentlich auch zu alt, somit dürfe sie auch nicht tanzen, so wie sie eben tanzt, urteilt Stefan Großmann im Tage-Buch gnadenlos. Und auch Herwarth Walden resümiert in seinem Buch "Der Sturm" kurz und knapp: "Jedenfalls kann sie nicht tanzen." Ganz Gemeine verwenden gelegentlich das Wort "Hopserei".
Das Publikum entscheidet jedoch Abend für Abend, ob es für die "hopsende" Hüllenlose zum Geldbeutel greifen will oder eben nicht. "Frau Celly tanzt, laßt sie doch ruhig tanzen, wo alle Welt sich heut im Tanze wiegt", dichtet 1921 ein verständnisvoller Josef Wiener-Braunsberg in der ULK, der satirischen Beilage des Berliner Tageblatts, über die umstrittene Künstlerin." 8)
Doch "trotz der neuen Gesetzeslage, in der Nacktheit nicht per se als obszön galt, sondern unter bestimmten künstlerisch motivierten Umständen gestattet war, konnten Künstlerinnen und Künstler für ihre Auftritte wegen Anstößigkeit oder Blasphemie vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Rheidt und Seveloh, die ihre Tanztruppe nicht aus künstlerischen Überlegungen gründeten, bemühten sich zwar um Legitimierungsstrategien, blieben aber von regelmäßigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, Zensurauflagen und hohen Strafzahlungen nicht verschont. Ein initiiertes Strafverfahren gegen Celly de Rheidt und ihren Mann Alfred Seveloh im Jahre 1922 mündete in einer Bußgeldauflage von 37.000 Mark. Dichter, Kabarettisten und Schriftsteller nahmen öffentliche Machtkämpfe [um Moral, Körperkultur und Geschlechterrollen] wie diesen zum Anlass für satirische Texte. Der Revuedichter Marcellus Schiffer beispielsweise schrieb eine Parodie auf die Skandale um das Celly de Rheidt Ballett, in der es im Refrain lautet: "Komm Se rein, komm Se rein, komm Se rein, komm Se rein in die gute Stube! Wir wollen alle gerne nackend sein, ob Mann, ob Weib, ob Mannweib oder Bube! Und schimpft auch die Frau Staatsanwalt, `ne Ziege mies und alt, auf unsre Celly de Rheidt! Nur Neid! Nur Neid! Nur Neid!"" 9)
Nach dem Strafverfahren durfte Celly de Rheidts Tanzgruppe nur von der Polizei kontrolliert weiter tanzen. Die Brüste und Hüften hatten bedeckt zu sein; wenn nicht, dann würde die Truppe aus Berlin verwiesen werden. Diese polizeilichen Auflagen führten zu einem Besucherrückgang.
Auch die Postkarten, auf denen nackte Tänzerinnen aus Celly de Rheidts Ballett abgebildet waren, galten in Augen der polizeilichen Obrigkeit als obszön, da sie keine künstlerische Nacktheit für ein bürgerlich wohlerzogenes Publikum präsentierten, sondern vermeintlich derbe Nacktheit, wie sie angeblich ungebildete Zuschauer der Unterschichten schätzten.
"Die Tänze einer Celly de Rheidt oder Anita Berber schwankten im Urteil ständig zwischen 'unsittlicher' Varieté-Nummer und künstlerischer Sensation. (…) Anita Berber, Isadora Duncan, Celly de Rheidt und andere Avantgarde-Tänzerinnen leisteten zu ihren jeweiligen Lebzeiten große Pionierarbeit in der Loslösung des Tanzes von der 'schematischen Körperlichkeit und dem Bewegungskanon romantischer Balletttradition' und verhalfen somit der (Tanz-) Kunst zu einer Rückführung in die Lebenspraxis." 11)
1922 trennte sich Celly de Rheidt von ihrem Ehemann. Das Ehepaar stritt sich um den Namen der Tanzgruppe, die sich aber auch trennte.
Später trat Celly de Rheidt u. a. in Leipzig mit einem lesbischen Vampirtanz auf. 1924 heiratete sie Moritz Rosner, Direktor des Ronacher-Theaters in Wien. 1925 trat sie auch in der Scala am Hamburger Schulterblatt auf unter der Ankündigung "Celly de Rheidt in ihren naturalistischen Tanzschöpfungen". Wenig später endete ihre Karriere.
Frauen waren zwar Pionierinnen in diesen Grenz auflösenden Theaterformen, aber sie gehörten nicht zu den Profiteurinnen. Denn die Besitzer der Theater oder Regisseure der Shows in den folgenden Jahren waren in der Regel Männer. Zu ihnen zählte z. B. Erik Charell, der auch mit Celly de Rheidt gemeinsam aufgetreten war, so z. B. 1920 in einer Tanzrevue im Ufa Palast am Zoo in Berlin.
Text: Rita Bake unter Mitarbeit von Birgit Kiupel
Quellen:
1) Vgl. Bettina Müller: Die Anziehung der Ausgezogenen", veröffentlicht in der taz vom 9.3.2019. Unter: (http://www.taz.de/!5577490/)
2) zit. nach: Peter Jelavich: Berlin Cabaret. Cambridge, Massachussets 1996, S. 156.
3) Laura Nickel: BA Kunstgeschichte und Medienkulturwissenschaft 4. Fachsemester: Entblößter Körper - Entblößtes Selbst. Die Anfänge des Nackttanzes um 1900 und die Entwicklung bis zu den Auftritten Anita Berbers auf den Bühnen der Weimarer Republik. Köln 2014, S. 8. Und: Franz-Peter Kothes: Die theatralische Revue in Berlin und Wien 1900-1938. Wilhelmshaven 1977, S.69f. zit. nach. Fischer, Lothar: Anita Berber. Göttin der Nacht. Berlin 2007, S.50. Zit. nach Nickel, a. a. O., S. 8.
(Universität zu Köln. Institut für Medienkultur und Theater. Basismodul 4: Formate, Genres, Gattungen Übung: Ausdruckstanz - Die Tanzkultur der 1920er Jahre Frau Dr. Hedwig Müller SS 2014)
4) ebenda.
5) Peter Jelavich: Berlin Cabaret. Cambridge, Massachussets 1996, S. 156., zit. nach Lara Nickel, a. a. O., S. 8f.
6) Michael Brettin: Die nackte Wahrheit über Berlin. "Babylon Berlin" wie es wirklich war: Eine Zeitreise in das Amüsemang der Zwanziger. In Berliner Zeitung unter: https://story.berliner-zeitung.de/der-nackte-wahnsinn/
7) Claudia Balk: Vom Sinnenrausch zur Tanzmoderne, in: Brygida Ochaim, Claudia Balk; Varieté-Tänzerinnen um 1900. Vom Sinnenrausch zur Tanzmoderne. Frankfurt a. M. 1998, S. 22.
8) Bettina Müller, a. a. O.
9) Laura Nickel, a. a. O., S. 9. Und hier auch: Bendow/Schiffer: Der kleine Bendow ist vom Himmel gefallen. Berlin 1923, S. 36f. zit. nach Fischer: Anita Berber. Göttin der Nacht, S.46., zit. nach: Laura Nickel, a. a. O.,. S.9
10) Lara Nickel, a. a. O., S. 14.
Lola Rogge
Tanzpädagogin, Choreographin, Tänzerin


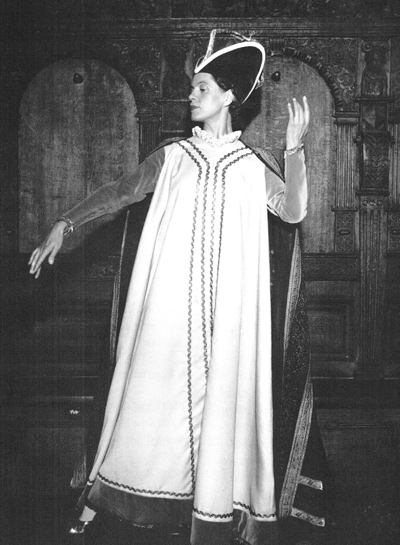
Lola Rogge, Foto: Archiv Lola Rogge Schule

20.3.1908
Hamburg
–
13.1.1990
Hamburg
Hamburg
–
13.1.1990
Hamburg
Mehr erfahren
Sichtbarer als ihre Grabstätte manifestiert sich Lola Rogges Leben und Werk in den Gebäuden ihrer Tanzschule in der Tesdorpfstraße 13, auf dem der Namenszug „Lola Rogge Schule“ prangt, und im Hirschpark in Blankenese. Dass Lola Rogge eine tänzerische Laufbahn einschlagen würde, stand keineswegs von Anfang an fest. Widerstände der Eltern waren zu überwinden, die ihre Tochter in dem für Frauen anerkannten Beruf der Fürsorgerin sahen, und später, während der Ausbildung, Selbstzweifel: Zweifel an der eigenen Begabung und körperlichen Belastbarkeit. Doch ihr kämpferisches und zielstrebiges Naturell ließen sie alle diese Schwierigkeiten überwinden und den Namen Lola Rogge weit über Hamburgs Grenzen hinaus bekannt machen.
Begonnen hatte für die Tochter des Stadtbaumeister in Altona, des Architekten Hans Rudolf Rogge, und seiner Ehefrau Christiane geb. Schönfelder, alles, als sie aufgrund ihres zarten Gesundheitszustandes 1920 aus dem Lyzeum in der Altonaer Chaussee, das sie seit 1914 besuchte, in die jüdische Privatschule von Alice Blömendal umgeschult wurde, wo statt des ihr aus gesundheitlichen Gründen untersagten Sportunterrichts rhythmische und tänzerische Gymnastik auf dem Lehrplan stand. Das junge Mädchen war sofort Feuer und Flamme, gern hätte sie auch außerhalb der Schule Tanzunterricht genommen, doch die Eltern waren strikt dagegen. Erst ein Tanzsolo in einer Schulaufführung nach Gedichten aus Goethes „West-östlichem Divan“, die Fürsprache einer Lehrerin, die mit Lola und ihren Freundinnen eine Tanzszene in einem Theaterstück für den Handwerkertag in Hamburg eingeübt hatte, und vor allem ihr eigenes tägliches Insistieren führten schließlich dazu, dass die Mutter sich bereit erklärte, an einer Unterrichtsstunde in der Tanzschule des Ungarn Rudolf von Laban zu hospitieren. Der Anblick halb nackter, schwitzender Männer ließ sie entsetzt zurückschrecken. Doch die Tochter gab nicht nach, und beim zweiten Besuch hatte sie Glück. Die feinfühlige Jenny Gertz, die dieses Mal den Unterricht erteilte, begriff die Situation und richtete es so ein, dass keine exzessiven Bewegungen bei den Übungen vorkamen. Lola Rogge hatte es geschafft: Auch wenn die Eltern sich niemals mit der Künstlerlaufbahn ihrer Tochter abfanden, willigten sie in ihre Wünsche ein. 1925 begann Lola Rogge ihre Ausbildung an der Schule „Hamburger Bewegungschöre Rudolf von Laban“, die zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr von Laban selbst, sondern von seinem ehemaligen Assistenten, dem gebürtigen Hamburger Albrecht Knust, im Sinne der Ideen Labans geleitet wurde.
Labans Bewegungslehre basierte auf der Überzeugung, dass das gesamte Sein seinen Ursprung im Tanz habe. Daraus ergaben sich alle weiteren Einsichten, dass nämlich in jedem Menschen ein Tänzer stecke, der Gruppentanz die eigentliche adäquate Form und die zwecklose Freude der Tänzerinnen und Tänzer im gemeinsamen Erleben die Zielsetzung des Tanzes sei. Vor diesem Hintergrund ist es auch verständlich, dass Labans Interesse nicht nur der Ausbildung von Profis, sondern vor allem auch der von tanzbegeisterten Laien galt. Aus der Arbeit mit ihnen gingen die Bewegungschöre hervor, deren Übungsstunden zum Pflichtprogramm der Ausbildungsschüler und –schülerinnen gehörten.
Die Lehre Labans musste bei Lola Rogge, die einen besonderen Sinn für Humanität und Toleranz besaß, auf fruchtbaren Boden fallen, auch wenn sie den Schwerpunkt in ihrem eigenen Unterricht später etwas verlagerte. Während es Laban primär um das gesteigerte Ich-Erlebnis in der Gemeinschaft ging, darum, den Menschen aus der Gemeinschaft heraus zu tragen, legte Lola Rogge Wert auf die Durchbildung des Körpers, auf technisches Können. Aus dem Gefühl heraus, selbst keine ausreichende Technik gelernt zu haben, nahm sie nach Abschluss ihrer Ausbildung am Laban-Institut klassischen Tanzunterricht bei OLga Brandt-Knack (ihr Grabstein steht im Garten der Frauen), der damaligen Ballettmeisterin und Choreographin des Hamburger Stadttheaters.
Eine Karriere als Solotänzerin kam für Lola Rogge trotz einer Anfrage aus Braunschweig nicht in Frage. Sie blieb nach ihrem Examen im Jahre 1927 als Assistentin Albrecht Knusts an ihrer Ausbildungsstätte tätig und gründete eine eigene Schule in Altona, die „Altonaer Labanschule Lola Rogge“, wo sie die ersten Kinderbewegungschöre ins Leben rief. Neben den Kindergruppen kam auf Initiative von Frau Bucerius, der Mutter des ehemaligen Herausgebers der „Zeit“, zunächst ein Kurs zustande, den Lola Rogge scherzhaft ihren Crêpe-de-Chine-Kurs nannte. Da sie ihren Beruf nicht nur als künstlerisch-pädagogische, sondern auch als soziale Aufgabe betrachtete, versuchte sie, Menschen aus allen Schichten zu gewinnen – mit Erfolg. Um für ihre Schüler mit geringem Einkommen den Beitrag erschwinglich zu halten, gründete sie den „Altonaer Bewegungschöre e.V.“. Als eingetragenem Verein standen ihm Turnhallen als Trainingsräume zu günstigen Konditionen zur Verfügung. 1931 erweiterte sich ihr Schülerkreis noch einmal erheblich, als sie Gymnastikunterricht über den Rundfunk erteilte.
Im Frühjahr 1934 war Lola Rogge vor eine große Entscheidung gestellt: Albrecht Knust ging nach Essen an die Folkwangschule und bot ihr die Übernahme der Laban-Schule am Schwanenwik an. Sie war inzwischen nicht mehr allein, denn sie hatte 1931den Hamburger Kaufmann Hans Meyer geheiratet, der nach der Eheschließung den Namen seiner Frau als Doppelnamen angenommen hatte, eine auch für heutige Verhältnisse ungewöhnliche Entscheidung, die viel über das Verhältnis des Paares aussagt.
Hans Meyer hatte zunächst Pianist werden wollen, schlug aber dann, als sein Vater starb und er für seinen eigenen Lebensunterhalt und den der Mutter sorgen musste, eine kaufmännische Laufbahn ein. Als er Ende der zwanziger Jahre mit Einbruch der Weltwirtschaftskrise wie viele andere arbeitslos wurde, besann er sich auf seine musikalische Begabung und wurde zum Begleiter und Berater seiner damaligen Freundin und späteren Ehefrau. Er saß während ihres Unterrichts am Klavier und half ihr bei der Musikauswahl für ihre kleinen Choreographien. Später, bei den großen chorischen Tanzwerken, wurde er zu einem wichtigen musikalischen und dramaturgischen Mitarbeiter, der die Musik und den Stoff auswählte und die dramaturgische Konzeption der Choreographie entwarf. Doch waren beide sich stets bewusst, dass sie die begabtere von ihnen war. Ihren „Prinzgemahl“ nannte sie ihn dann auch. Dieser übernahm allerdings eine sehr zentrale Funktion, als das Ehepaar sich entschloss, das Angebot Knusts und Labans anzunehmen und die Schule zu kaufen. Hans Meyer-Rogge wurde quasi zum geschäftsführenden Direktor des Instituts, der sich um alle finanziellen und organisatorischen Belange kümmerte.
Schon ein Jahr vor der Übernahme der Tanzschule hatte sich Lola Rogge nach ersten kleinen Erfolgen als Choreographin an ein abendfüllendes Programm auf eigene Verantwortung und Kosten gewagt. „Thyll“ hieß das Tanzschauspiel, das auf dem Ulenspiegel-Roman des belgischen Dichters Charles de Coster basierte und für das der Hamburger Komponist Claus-Eberhard Clausius nach Lola Rogges choreographischen Vorgaben die Musik schrieb. Es sollte im Altonaer Stadttheater von den Laien der Bewegungschöre und dem Sprech- und Bewegungschor der SPD getanzt werden. Doch kurz vor der Premiere wurde von den nationalsozialistischen Machthabern zur Auflage gemacht, den SPD-Chor zu streichen. Lola Rogge kam dieser Aufforderung nach, um die Aufführung nicht zu gefährden. Die Hauptrolle des Stückes tanzte sie selbst, ebenso wie in ihrem nächsten großen Werk, den „Amazonen“, das sie 1935 mit ihren Bewegungschören im Deutschen Schauspielhaus uraufführte. Das Stück war so erfolgreich, dass es 1935 im Rahmen der deutschen Tanzfestspiel in Berlin gezeigt wurde und 1936 zusammen mit dem Weihespiel Labans „Vom Tauwind und der neuen Freude“ für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gedacht war. Bei der Generalprobe entschied Goebbels sich jedoch anders. Über Labans chorisches Werk, das sich zunächst so mühelos in die nationalsozialistische Ideologie zu fügen schien, notierte er in seinem Tagebuch. „Das ist alles so intellektuell. Ich mag das nicht. Geht in unserem Gewande daher und hat gar nichts mit uns zu tun“ 1). Als Laban Deutschland 1937 verließ, musste sein Name aus den Titeln aller Labanschulen gestrichen werden. Lola Rogge führte ihre Schule unter der Bezeichnung „Lola-Rogge-Schule“ weiter.
Die Geschichte der Amazonenkönigin Penthesilea war als erster Teil einer Trilogie geplant, die aber wegen des Kriegsausbruchs nicht mehr vollendet werden konnte. 1939 wurde lediglich noch der zweite Teil, „Mädcheninsel“, im Schauspielhaus uraufgeführt. Das Tanzspiel erzählt die Sage des jungen Achill, den seine Mutter Thetis vor der Erfüllung des Orakelspruchs zu schützen sucht. Lola Rogge tanzte den Achill. Die Entscheidung für die antiken Stoffe basierte auf der Liebe Hans Meyer-Rogges zur griechischen Mythologie. Zudem waren Figuren wie Penthesilea und Achill der knabenhaften Lola Rogge mit ihrer herben und kraftvollen Ausstrahlung wie auf den Leib geschrieben.
Die Aufführungen waren dann auch ein solcher Erfolg, dass der damalige Intendant des Schauspielhauses, Karl Wüstenhagen, Lola Rogge gleich nach der Premiere der „Amazonen“ einen Vertrag als Bewegungsregisseurin anbot. Über 20 Jahre, bis zum Ende der Spielzeit 1958/59, arbeitete Lola Rogge neben all ihren anderen Verpflichtungen auch noch am Schauspielhaus.
Das Ende des Krieges erlebte Lola Rogge in Stade, wohin sie nach den schweren Bombenangriffen auf Hamburg im Sommer 1943 geflüchtet war. 1945 kehrte sie nach Hamburg zurück und erhielt von der englischen Besatzungsmacht sofort die nötige Unterrichts- und Auftrittsgenehmigung. Die Tanzschule war bereits 1938 in das Haus Tesdorpfstraße 13 verlegt worden, das das Ehepaar erwarb, als ihm der Mietvertrag für das Haus am Schwanenwik, in dem sich die Tanzschule Laban bis dahin befand, gekündigt wurde. Hier in der Tesdorpfstraße wohnte die Familie auch. Die Zusammenlegung von Wohnung und Arbeitsstätte erleichterte manches, besonders die Betreuung der Kinder, der 1935 geborenen Zwillinge Jan und Klaus, und der Töchter Christiane (1944) und Andrea (1948). Zudem gab es eine Hausangestellte, die von frühmorgens bis spätabends für die Kinder da war. Und doch erzählt die Tochter Christiane, heute Leiterin der Lola-Rogge-Schule, wie sie als Kinder spätabends wach in den Betten gelegen und sehnsüchtig auf die von einer Premiere heimkehrende Mutter gewartet hätten. Die gemeinsamen Wochenenden in dem 1951 gekauften Haus in Lüllau in der Heide empfindet sie als eine Art Wiedergutmachung für erlittenen Mangel. Noch heute ist für die Geschwister das Haus in der Heide enorm wichtig: „Da ist Mutter.“
Nach Kriegsende mussten die Eltern allerdings zunächst einmal den mühsamen Wiederaufbau bewerkstelligen. Wofür Lola Rogge schon immer ein Gespür gehabt hatte, für Qualität und Leistung, was sie sofort nach 1934 veranlasst hatte, die Ausbildung am Institut zu reformieren und das Niveau zu verbessern, empfand sie auch jetzt als Notwendigkeit. Wenn der moderne Tanz in Deutschland den Anschluss an das internationale Niveau nicht verpassen wollte, musste etwas geschehen. Als 1949 der schweizerische Berufsverband für Gymnastik und Tanz zum Internationalen Tänzertreffen nach Zürich einlud, fuhr Lola Rogge hin. Hier hatte sie nach vielen Jahren zum ersten Mal die Gelegenheit, wieder Lernende und nicht Lehrende zu sein. Aus der Begegnung mit der Komponistin Aleida Montijn entstand dann auch eine neue Schöpfung Lola Rogges, die sie ganz ohne die Unterstützung ihres Mannes durchführte: „ (...) die ‚Vita Nostra’ ist ein gemeinsames Kind von uns beiden“ 2), schrieb sie an die Komponistin. Die Uraufführung des auf alttestamentarischen Psalmen basierenden Werkes am 15. Mai 1950 erregte große Begeisterung. Der renommierte Ballettkritiker Christian E. Lewalter wertete das Werk, das die durchlebten Schrecken des Krieges zum Ausdruck brachte, in der „DIE ZEIT“ als einzigartiges Werk; der Tanzpublizist Kurt Peters bezeichnete die Choreographie als die bedeutendste der Nachkriegszeit. Auch das letzte große Werk, das Lola Rogge schuf, hatte einen religiösen Hintergrund und beschäftigte sich mit dem Tod: der „Lübecker Totentanz“. Er wurde in verschiedenen Kirchen Lübecks aufgeführt und stellte immer neue Anforderungen an die Choreographin, da die verschiedenen Kirchenräume ganz anders berücksichtigt werden mussten als die „Guckkastenbühne“ des Theaters.
Nach dem Tod ihres Mannes am 5. September 1975 gab Lola Rogge die Leitung ihrer Schule an ihre Tochter Christiane ab. Die Ausbildung für Tänzer hatte sie bereits 1969 aufgegeben. Die Tanzabteilungen der Hochschulen konnten schon aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten dafür inzwischen ein besseres Niveau garantieren als eine Privatschule. Lola Rogge konzentrierte sich ganz auf ihr Lieblingskind, den Laientanz. Darin war sie so erfolgreich, dass sie 1972 eine Zweigstelle in dem klassizistischen Gebäude im Hirschpark in Blankenese einrichtete. Bis zu ihrem Tode am 13. Januar 1990 leitete sie einen Laienkurs.
Text: Brita Reimers
Zitate:
[1] zitiert nach: Nils Jockel, Patricia Stöckermann: „Flugkraft in goldene Ferne ...“ Bühnentanz in Hamburg seit 1900. Hamburg 1989.
[2] Patricia Stöckemann: Lola Rogge. Pädagogin und Choreographin des Freien Tanzes. Wilhelmshaven 1991.
Gerda Rosenbrook-Wempe
Widerstandskämpferin, Archivarin, Privatlehrerin




19.11.1896
–
24.11.1992
–
24.11.1992
Mehr erfahren
Ihre frühe Kindheit verbrachte Gerda Wempe, Tochter von Frieda und Gerhard D. Wempe, mit vier Geschwistern in Oldenburg. Nach dem Tod der Mutter änderte sich das Leben der 7-Jährigen. Ihr Vater heiratete wieder und zog mit der Familie nach Hamburg. Dort eröffnete er im Schulterblatt ein Goldwaren- und Uhrengeschäft und ließ zu, dass seine zweite Frau die drei jüngsten Kinder aus der zum Laden gehörenden geräumigen Parterrewohnung in den Keller verbannte. Tagebucheintrag von Gerda Rosenbrook-Wempe: "Dieser Keller war unsere Welt, hier haben wir gefroren, gehungert, schwer gearbeitet und viel geweint. ... ein liebes Wort haben wir weder im Hause noch in der Schule je gehört." 1) Gerda Wempe hätte gern das Abitur gemacht. Doch der Vater ließ sie in seiner Firma arbeiten. 2)
1928 heiratete sie den Mathematiklehrer Dr. Curt Rosenbrook. Er war kriegstraumatisiert, die Ehe blieb kinderlos. Vier Jahre später trennten sich die Eheleute ohne Scheidung.
1937, dem Jahr, in dem die Fa. Wempe als nationalsozialistischer Musterbetrieb ausgezeichnet wurde, 3) lernte die inzwischen verwitwete Gerda Rosenbrook Walter Funder kennen, einen Freigeist und Publizisten, der schon vor Hitlers Machtübernahme Schriften gegen den Antisemitismus verfasst und veröffentlicht hatte. Konspirativ leistete das Paar Widerstand: Es verfasste kritische Flugblätter und warf sie nachts in Briefkästen immer anderer Hamburger Haushalte und anderer Wohnviertel. In Gerda Rosenbrooks Haus trafen sich Gleichgesinnte, um über das Unrechtsregime zu diskutieren.
Dem Verlangen ihres älteren Bruders, seit dem Tod des Vaters Inhaber der Fa. Wempe, sich von ihrem Lebensgefährten zu trennen, widersetzte sich Gerda Rosenbrook. 4) Nur noch einmal sahen sich die Geschwister: 1944 beim Prozess gegen Walter Funder, sie als Zeugin der Verteidigung, er als Zeuge der Anklage. Diese lautete: "Vorbereitung des Hochverrats". 5)
Funder war am 1.8.1943 gemeinsam mit dem Künstler Hugo Meier-Thur verhaftet worden. Letzterer, Professor am Lerchenfeld, war längst im KZ Fuhlsbüttel ermordet worden, als man Funder den Prozess machte, wegen der schlechten Beweislage nicht vor dem Volksgerichtshof in Berlin, sondern vor einem Hamburger Gericht. Funder erhielt eine Gefängnisstrafe, zeitweise saß er sie in KZs ab. 6) Wenn möglich, reiste Gerda Rosenbrook ihm nach, versuchte, ihm die Haft zu erleichtern. Im März 1945 wurde er freigelassen, körperlich ein Wrack, seelisch gebrochen.
Nach dem Krieg hörten die Verleumdungen gegen Walter Funder nicht auf. Alte Feinde wollten ihn für unzurechnungsfähig erklären lassen, um ihn mundtot zu machen. Gerda Rosenbrook half ihm, sich dagegen erfolgreich zu wehren. Rehabilitierung und Wiedergutmachung blieben ihm jedoch versagt. Walter Funder starb als vorbestrafter Mann 1960. Gerda Rosenbrook überlebte ihn um 32 Jahre, ordnete Korrespondenzen und Prozessakten und gab sie an die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg weiter. Die Verabschiedung des Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile erlebte auch sie nicht mehr. Es annullierte Jahrzehnte nach seinem Tod das Urteil gegen Walter Funder.
Als ihre schönste Zeit bezeichnete sie das Lernen fürs Abitur als Externe: Im Alter von gut dreißig Jahren hatte sie sich zur Abiturprüfung gemeldet und war mündlich in Mathematik durchgefallen. Erst als Rentnerin erfüllte sich ihr Wunsch zu unterrichten. Gratis gab sie Stunden in Latein, Englisch, Französisch und Geschichte. Allen, die ihr begegneten, brachte sie politisches Wissen nahe. Kurz vor ihrem Tod schrieb sie: "Das Gespräch ist mir das Wichtigste in meinem Leben."
Text: Regina Deertz, Iris Pompesius, Brigitte Wempe
Quellen:
1) Tagebuchaufzeichnungen
2) Tagebuchaufzeichnungen
3) Wikipedia unter:
a. Gerhard D. Wempe - Unternehmensgeschichte
b. Kategorie: Nationalsozialistischer Musterbetrieb - Gerhard D. Wempe
4) Tagebuchaufzeichnungen und Ordner in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg (FZH)
5) Anklageschrift und Urteil beim HOLG, AZ: O.Js. 9/44
6) Tagebuchaufzeichnungen - Ordner in der FZH
Charlotte Rougemont
Märchenerzählerin


22.01.1901
Hamburg
–
10.02.1987
Hamburg
Hamburg
–
10.02.1987
Hamburg
Mehr erfahren
Schon als kleines Kind hatte sich Charlotte Rougemont in der Welt der Märchen, insbesondere der Volksmärchen wie zu Hause gefühlt.
Sie arbeitete schon lange als Medizinisch-Technische-Assistentin im Eppendorfer Krankenhaus, als ein Student sie mit zu einer Veranstaltung der Märchenerzählerin Vilma Mönckeberg-Kollmar nahm. Dieser Abend wurde zur Wende in ihrem Leben. Ihr, der Märchen fast nur vorgelesen worden waren, wurde plötzlich klar, dass Märchen, wenn sie ihren ganzen Zauber entfalten sollen, erzählt werden müssen; dass nur das laut gesprochene, den Einzelnen ansprechende erzählende Wort wirklich ergreift, allerdings wortgetreu der schriftlichen Fassung folgend
Am nächsten Tag lag bei einer mechanisch zu verrichtenden Arbeit im Labor ein Reclamband mit Grimms Märchen aufgeschlagen neben ihr. In jahrelanger, mühseliger Arbeit lernte sie neben ihrem eigentlichen Beruf viele Märchen der Welt auswendig - wobei ihr die Grimmschen Märchen immer besonders am Herzen lagen. Sie begann, in ihrer Mittagsstunde im Krankenhaus Bethesda Patienten die auswendig gelernten Märchen zu erzählen. Auch die Ärzte und Schwestern spürten die wohltuende Wirkung der Märchen auf die Patienten und riefen sie bald in dieses oder jenes Zimmer.
Bei den Bombenangriffen im Juli 1943 auf Hamburg wurde das Krankenhaus Bethesda und das Elternhaus Charlotte Rougemonts zerstört. Die Familie zog nach Flensburg, wo Charlotte Rougemont mit ihrem neuen Beruf der Märchenerzählerin begann. Hatte sie schon in den letzten Jahren in Hamburg ihren Kreis der Zuhörerenden über das Krankenhaus hinaus erweitert, Märchen in Altersheimen, bei Mütterabenden und in Kinderkreisen erzählt, so reiste sie jetzt per Bus oder auch oft auf mehrstündigen, beschwerlichen Fußmärschen durch Schleswig-Holstein, erzählte an der Westküste, auf den Inseln und Halligen, in den Kreisen Flensburg, Rendsburg, Schleswig, Eckernförde und in und um Hamburg. Sie erzählte in den Schulen (von der Dorfschule, über das Gymnasium bis zur Berufs- und Volksschule), in Kinder-, Müttererholungs- und Altersheimen, in Ferienheimen und Zeltlagern, bei den Landfrauen, im Frauengefängnis Fuhlsbüttel, im Jugendgefängnis Hanöfersand und auch in den Lazaretten. Fast immer gelang es ihr, auch anfänglich skeptische Jugendliche und Erwachsene zu fesseln. Charlotte Rougemont starb im Alter von 86 Jahren. Sie hatte zuletzt im Altenheim Rabenhorst in Hamburg gelebt.
Emmi Ruben
(geb. Geister)
Mäzenin, Namensgeberin für Emmi-Ruben-Weg, benannt 2016 im Bezirk Harburg, im Stadtteil Hausbruch


7.2.1875
Hamburg
–
4.6.1955
Hamburg
Hamburg
–
4.6.1955
Hamburg
Mehr erfahren
„Zu allererst sei Ihnen mein herzlichster Dank gesagt. – Sie haben ja soviel mit den Künstlern gelebt um richtig einen solchen Dank zu verstehen. Es ist ja nicht allein das Geld gewesen in dieser Zeit, sondern auch das Gefühl damit ausgedrückt, dass Sie dahinter stehn und gerade letzteres ist in den vielen leeren Stunden im Atelier ein tröstliches Bewusstsein gewesen –”,( Mappe „Nachlass Ruben“. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky. Handschriftenabteilung.) schreibt der Maler Willem Grimm am 12.6.1937 an Emmi Ruben und bringt damit auf den Punkt, was diese Frau für die künstlerische Avantgarde in Hamburg bedeutete. In einer Zeit, in der die Hamburger Sezession sich unter dem Druck des Nationalsozialismus auflöste, die Bilder vieler Künstler als entartet galten und aus den Museen entfernt wurden, war eine Mäzenin, die sich von all dem nicht beeindrucken ließ, eine Hoffnungsträgerin für die Kunst, die Künstler und Künstlerinnen. Mit dem Ankauf von Bildern half sie nicht nur finanziell, sondern stärkte die Künstler auch in ihrem Selbstbewusstsein. Und der Nachwelt erhielt sie manches Werk, das ohne sie vermutlich verloren wäre. Emmi Ruben wurde am 7. Februar 1875 geboren. 1897 heiratete sie Albert Ruben, einen Kaufmann jüdischer Abstammung. Neben seiner beruflichen Tätigkeit, zunächst als leitender Angestellter, dann als Teilhaber der Firma Blumenfeld, einem Kohlenimporthandel mit eigenen Schiffen, war Albert Ruben im Hamburger Kulturleben sehr aktiv. Als Mitbegründer der Literarischen Gesellschaft knüpfte er Kontakte zu Gerhart Hauptmann, Richard Dehmel und Detlev von Liliencron, hielt selbst Vorträge für die Arbeiterjugend in der Kunsthalle und unterstützte die Arbeit von Künstlern. So warb er beispielsweise bei seinen Geschäftsfreunden um finanzielle Unterstützung von Projekten und brachte den Maler Ivo Hauptmann in der Firma Blumenfeld unter, der daraufhin von seinen Freunden zum „bestmalenden Kohlenhändler“ ernannt wurde. Emmi Ruben war in dieser Zeit wohl eher „die Frau an seiner Seite“, versorgte den Haushalt und die zwei Kinder (Elisabeth, geb. am 17.7.1898 und Walther, geb. am 26.12.1899, eine weitere Tochter verstarb im Alter von einem Jahr), denn nahezu alle in der Staats- und Universitätsbibliothek befindlichen Briefe von Künstlern sind zu Albert Rubens Lebzeiten an ihn gerichtet. Nach seinem Tod im Jahre 1926 wurde Emmi Ruben selbst aktiv, wobei ihr Interesse in erster Linie der bildenden Kunst galt. 1948 schenkte sie ihre umfangreiche Sammlung von 146 Exponaten, darunter 17 Gemälde, der Hamburger Kunsthalle. Alle wichtigen Hamburger Künstlerinnen und Künstler der damaligen Zeit sind darin vertreten: Friedrich Ahlers-Hestermann, Karl Ballmer, Alma del Banco, Eduard Bargheer, Paul Bollmann, Arnold Fiedler, Fritz Flinte, Fritz Friedrichs, Willem Grimm, Richard Haizmann, Erich Hartmann, Ivo Hauptmann, Eduard Hopf, Paul Kayser, Karl Kluth, Fritz Kronenberg, Kurt Löwengrad, Emil Maetzel, Wilhelm Mann, Rolf Nesch, Franz Nölken, Alexandra Povòrina, Anita Rée, Hans Ruwoldt, Walter Siebelist, Herbert Spangenberg, Heinrich Stegemann, Walter Tanck, Maria Wenz, Albert Woebcke. Gretchen Wohlwill (siehe: historischer Grabstein im Garten der Frauen), Gustav Wolff. „Es ist mein Wunsch“, schrieb sie an Carl Georg Heise, den damaligen Direktor der Hamburger Kunsthalle „dass diese Bilder, die das Ergebnis meiner langjährigen Sammlertätigkeit darstellen, in den Besitz der Kunsthalle meiner Vaterstadt übergehen, um meinen Mitbürgern einen bleibenden Eindruck von einer Epoche hamburgischer Malerei zu geben. Mit der Aufstellung dieser Bilder in der Kunsthalle möchte ich zugleich dazu beitragen, das Andenken an die Künstler, die mir freundschaftlich nahegestanden haben, in Hamburg zu erhalten“ (Unveröffentlichter Brief vom 24. Mai 1948. Hamburger Kunsthalle.) Die Briefe, die ihr Mann und sie von Künstlerinnen und Künstlern erhalten hatten, übergab sie der Staats- und Universitätsbibliothek: „Nachlass Ruben (nach Auskunft von Dr. Voigt ca. 1945 von einer älteren Dame (Frau Ruben) geschenkt worden)“, steht auf der Mappe. Sie enthält neben Briefen an Albert Ruben Briefe an Emmi Ruben von Friedrich Ahlers-Hestermann, Alma del Banco, Paul Bollmann, Arnold Fiedler, Fritz Flinte, Willem Grimm, Richard Haizmann, Erich Hartmann, Ivo Hauptmann, Eduard Hopf, Martin Irwahn, Karl Kluth, Hans Leip, Kurt Löwengard, Rolf Nesch, Alexandra Povòrina, Antia Rée, Hans Ruwoldt, Karl Schmidt-Rottluff, Clara Rilke-Westendorf, Gretchen Wohlwill u.a. Sie alle unterstützte Emmi Ruben durch den Kauf ihrer Bilder, durch Mithilfe bei Ausstellungsvorbereitungen, durch Einladungen und Geschenke, ja manchmal sogar durch Bezahlung des Malmaterials, selbstgebackenen Kuchen und selbst genähte Puppenkleider für die Kinder. Erich Hartmann schreibt ihr am 26.12.1934: „Aber, aber! Kommt sie so ganz heimlich und sachlich hier an, um ihre Lithographie zu holen und ist in Wirklichkeit ein allerliebster Weihnachtsmann. Und was für einer. Ich bin wieder ganz gerührt wie gut Sie es mit uns meinen und wie Sie uns verwöhnen (…)“(Mappe „Nachlass Ruben“ a. a. O.). Und Alma del Banco: „Liebe Frau Ruben, nun schicke ich Ihnen mit Freuden die gewünschte Zeichnung, ob diese wohl Gnade vor den Augen Ihrer Kinder findet? – mir ist es ein Tagebuchblatt - es erzählt mir von den schönen Abendstunden bei Ihnen. – Ich glaube ich mache ganz gute Fortschritte, da ich ausgehen darf – das wird mir sicher gut tun – und Dank der liebevollen Fürsorge meiner Freunde – wozu ich Sie gerne rechnen möchte – für alles Gute tausend Dank“ (Mappe „Nachlass Ruben“ a. a. O.). Die Sierichstraße 132 war bis 1933 ein beliebter Künstlertreff. In ihren späteren Wohnungen am Ahornkamp und in der Binderstraße empfing Emmi Ruben die Künstlerinnen und Künstler wohl eher in kleinem Kreis. Emmi Ruben war eine Mäzenin im besten Sinne des Wortes, eine Förderin, die den Ankauf von Kunst weder als Statussymbol noch als Kapitalanlage betrachtete, sondern mit Kenntnis am Schaffensprozess der Künstler und Künstlerinnen teilnahm und als Sammlerin und Stifterin die Werke für die Nachwelt bewahrte. Sie war zugleich eine Mutterfigur, die offenbar ein großes Einfühlungsvermögen in die Existenzbedingungen der Künstlerinnen und Künstler besaß und ihnen dadurch weit mehr sein konnte als nur Geldgeberin. Hans Leip jedenfalls betont eben diese Fähigkeit, die Emmy Ruben neben ihrem Kunstverstand besaß und worin sie sich deutlich von den wohlbekannten „Gattinnen“ abhob, die sich mit Kunst schmücken: „(…) alles in allem eine der liebenswürdigsten Erscheinungen in der hanseatischen Atmosphäre vor 1933, wo sich ja manche blonde, blauäugige Ehepartnerin vorwagte und zu Kalbsbraten, Mosel und nachfolgender Lesung einlud, ohne sich allerdings weitere Unkosten zu machen bzw. den Gemahl dazu zu veranlassen. Emmi Ruben wusste um die Schwierigkeiten des schöpferischen Menschen; es war ihr nicht um die Dekoration ihrer Tafel und die Unterhaltung ihrer Gäste zu tun. Sie war aus echtem Kunstverstand und aus echter schöner Menschlichkeit hilfsbereit und helfend. Und sie besaß Takt, was so häufig eben nicht ist in unserer Welthafen-Vaterstadt (…)“ (Brief am 7.3.1963. Zitiert nach: Gerhard Kretschmann: Brief an Familie Ruben. Prüfungsarbeit der Hamburger Bibliotheksschule. 1963. Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky.) Und die Malerin Gretchen Wohlwill schreibt ihr einmal: „Für mich war das Beglückende in den vergangenen Jahren, dass Sie ‚da’ waren. Sie sind sich vielleicht selbst nicht darüber klar geworden, was das für mich bedeutet hat (…). Was Maetzel neulich sagte, war mir so aus der Seele gesprochen, dass nämlich, angenommen, die materielle Not sei eines Tages beseitigt und gemildert, so bliebe doch immer die geistige Vereinsamung der Künstler, u. ich möchte hinzufügen die seelische, das Bedürfnis nach Verständnis u. Anteilnahme“ (Mappe „Nachlass Ruben“, a. a. O.). Der zumeist distanzierte, vor allem von Dankbarkeit und Respekt gekennzeichnete Ton in den Briefen der Künstlerinnen und Künstler, der sich allein bei Karl Kluth ins sehr persönlich Freundschaftliche wendet, macht deutlich, dass Emmi Ruben ihre Position einer Mäzenin immer gewahrt, sich niemals angebiedert hat. Dass es auch Misstöne im Umgang mit den Künstlerinnen und Künstlern gab, zeigen nicht nur die Versuche der im menschlichen Umgang wohl komplizierten Anita Rée, bestehende Missverständnisse zu klären und auszuräumen. Auch der schon zitierte Brief von Gretchen Wohlwill ist vor eben diesem Hintergrund entstanden. Angegriffen fühlte Emmi Ruben sich auch, als sie sich 1933, nach der Absetzung der Vorsitzenden Ida Dehmel durch die Nationalsozialisten, entschied, der GEDOK (Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnen) treu zu bleiben. Die Kunsthistorikerin Rosa Schapire, die selbst aus Protest aus der GEDOK ausgetreten war, schrieb ihr daraufhin: „(…) ich danke Ihnen für Ihren ausführlichen Brief und möchte Ihnen auch gleich sagen, dass ich Ihren Schritt für ganz richtig halte. Es ist sehr viel leichter alles zu zerstören als das Bestehende zu halten und weiter auszubauen. Darauf aber kommt es in der schwierigen Epoche, in der wir heute leben, an. Gerade bei Ihnen bin ich fest davon überzeugt, dass Sie sich von sachlichen Beweggründen leiten lassen und frei von Ehrgeiz sind. Die GEDOK kann in der schwierigen Zeit doch mancher Künstlerin eine Erleichterung bringen. Sie haben das Vertrauen der Künstlerinnen, sind eingearbeitet und sicherlich die geeignetste Persönlichkeit, um deren Interessen weiter zu vertreten. Es ist ein besonders glücklicher Umstand, dass diese Tätigkeit Ihren Neigungen in diesem Maße entspricht, nur dann kann freilich auch etwas Vernünftiges geschehen.“ (Brief vom 23.5.33) 1). Neben der GEDOK war Emmi Ruben Mitglied der Freunde der Kunsthalle, der Ernst-Barlach-Gesellschaft, der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, einem radikalen Zweig der bürgerlichen Frauenbewegung, der Musikalischen Jugend Deutschlands, des Künstler-Vereins und der Griffelkunst, des Tierschutz-Vereins, der Deutsch-Griechischen Gesellschaft und des Deutschen Lyceum-Clubs in Hamburg. Text: Brita Reimers
Amelie Ruths
Malerin der Vierlande und der Halligen



28.4.1871
Hamburg
–
3.4.1956
Hamburg
Hamburg
–
3.4.1956
Hamburg
Mehr erfahren
Amelie Ruths war das zweite Kind von Johann Theobald Eduard Ruths und seiner zweiten Ehefrau Maria Amalie geb. Scherzinger. Das erste Kind, ein Sohn, war eine Woche nach der Geburt gestorben. Der 1871 geborenen Amelie folgten 1874 Therese, die bereits 1897 an einer Blinddarmentzündung starb, und jeweils ein Jahr später Rudolph und Frieda, die Lehrer bzw. Lehrerin wurden. Die Familie bewohnte ein kleines Haus in der Böttgerstraße 93 (heute wieder Heinrich-Hertz-Straße). Amelie und ihre um fünf Jahre jüngere Schwester Frieda besuchten die in der Nähe der Wohnung gelegene Höhere Töchterschule von Bonfort und Meinertz . Als der Vater 1895 starb, zog dessen Bruder, der weit über Hamburgs Grenzen hinaus bekannte Landschaftsmaler Valentin Ruths zur Familie.
Amelie Ruths fand durch ihren Onkel Valentin den Weg zur Kunst. Er gab ihr etwa seit ihrem vierzehnten Lebensjahr Zeichen- und Malunterricht, drängte sie jedoch, das Zeichenlehrerinnenexamen zu machen, damit sie sich ernähren könne. Von 1886 bis 1889 besuchte Amelie die Gewerbeschule für Mädchen in der Brennerstraße und schloss die Ausbildung mit dem Zeichenlehrerinnenexamen ab. Ab 1890 arbeitete sie an verschiedenen öffentlichen und privaten Schulen ( Louise Schroeder und Marie Wolf, Laura Nemitz, Dr. H. Michow und Frau, Henriette Müller, Marie Sander und Staatliches Lyceum am Lerchenfeld). In den Schulferien machte sie mit dem Onkel Studienreisen u. a. nach Italien und Ägypten. Als er um die Jahrhundertwende anfing zu kränkeln, pflegte sie ihn bis zu seinem Tode im Jahre 1905. Im selben Jahr beschickte sie zum ersten Mal eine Ausstellung, die Frühjahrsausstellung des Hamburger Kunstvereins. Dass alle Bilder von der Jury angenommen und zwei verkauft wurden, ermutigte sie, die kleine Erbschaft, die der Onkel ihr hinterlassen hatte, für ihre weitere Ausbildung aufzuwenden. Sie nahm Unterricht im Aktmalen bei Carl Rotte, der kurz Leiter der Aktklasse an der Kunstgewerbeschule am Steintor gewesen war und lernte vier Sommer lang bei dem Belgier Henri Luyten an seiner Ecole des Beaux Arts. In Braschaet, einem kleinen Ort in der weiten Küstenlandschaft um Antwerpen, versammelte er eine internationale Schülerschaft. Hatte Amelie bei ihrem ersten Lehrer Valentin Ruths vor allem das Zeichnen gelernt, so beschäftigten sie jetzt Probleme der Freilichtmalerei: „Die ängstlich zeichnerische Kontur entschwand der durch die realistische Schule gegangenen Hamburgerin, der Pinselauftrag wurde leicht und flüssig, die Farbe zum Element der Wirkung. Dazu kam eine Reise nach Paris, das Studium des klassischen Impressionismus an der Quelle“, schreibt Karl Fischer in seinem Beitrag über Amelie Ruths in „Westermanns Monatsheften“ im Mai 1923.
Trotz ihrer internationalen Ausbildung und verschiedener Reisen in den Süden blieb Amelie Ruths eine Malerin ihrer Heimat, der norddeutschen Landschaft. Sie fuhr an die Nordseeküste, auf die friesischen Inseln und in die Vierlande, wo ihre besondere Vorliebe den Vierländer Bauernhäusern galt. Anders als Marie Zacharias oder Ebba Tesdorpf (siehe zu ihr in der Rubrik: frauen auf der Erinnerungsskulptur), mit der sie nach dem Tod des Onkels eine Zeitland gemeinsam auf Motivsuche durch Hamburgs Straßen streifte, war es Amelie Ruths dabei weniger um die Rettung eines Stückes Kulturgeschichte zu tun als um Probleme der Malerei, um Licht und Farbe. Die Dielen ihrer Vierländer Bauernhäuser sind so lichtdurchflutet, dass man fast meint, es handele sich um Räume im Freien. Der Eindruck des für die Interieurmalerei so konventionellen Helldunkels findet sich bei ihr nicht mehr. Licht spielt auch eine wesentliche Rolle bei dem Gegenstand, der zu Amelie Ruths Hauptthema werden sollte: die Halligen. In ihren Notizen schreibt sie dazu: „Zwei Sommer auf Nordstrand gemalt. Dann ging ich im Mai 1920 zuerst auf die Suche nach den Halligen. Auf dem Weg erkrankte ich auf Föhr so schwer durch Ansteckung an einer Kinderkrankheit (Mumps), dass ich kaum noch nach Hause reisen konnte und monatelang zwischen Leben und Tod schwebte. Mitte Oktober setzte ich einen kurzen Besuch auf der Hallig durch. Ein orkanartiger Sturm setzte während meines kurzen Aufenthalts dort die Hallig unter Wasser. Dieses war der Anfang. Daraus entstand eines meiner besten Bilder. Seitdem blieb ich den Halligen treu. Nur selten machte ich seitdem andere Reisen und Studien-Aufenthalte“ 1). Selbst als sie so schwer krank war, dass sie vorzeitig in den Ruhestand versetzt wurde, hielt sie an der Halligmalerei fest. Frau Gebhard, eine Bekannte Amelie Ruths, berichtet: „Sie war ja bis zu ihrem Tode rastlos tätig und hat uns erzählt, wie noch im letzten Jahr ihre Freundin, Frl. Minna Steinfatt, und ihre Schwester im Sturm die Staffelei festhalten mussten, damit sie überhaupt malen konnte“ 1). Von Frau Gebhard wissen wir auch, dass Amelie Ruths eine sehr warmherzige und humorvolle Frau war, die „enorm viele Freunde“ hatte und eine „sehr beliebte Gastgeberin“ war 1).
Zunächst hatten die Geschwister Amelie, Frieda und Rudolph weiter in der Böttgerstraße gewohnt, wo Amelie das Atelier des Onkels übernommen hatte. Auf Dauer waren ihnen die Räumlichkeiten jedoch zu eng geworden, und so zogen die drei 1937 in ein größeres Haus in der Erikastraße 174 mit Blick auf den Mühlenteich. Das neue Domizil konnten sie jedoch nur wenige Jahre gemeinsam genießen. Es fiel 1943 den Bomben zum Opfer. Ein Jahr später starb der Bruder.
Die Schwestern verkauften das Grundstück nach dem Krieg und erhielten in dem darauf neu gebauten Zweifamilienhaus die Wohnung in der ersten Etage in Erbpacht. Hier lebten sie in enger, harmonischer Gemeinschaft miteinander. Als Amelie Ruths im Frühjahr 1956 ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und keine Hoffnung auf Besserung bestand, nahm sich ihre Schwester diesen Umstand derart zu Herzen, dass sie einem Herzschlag erlag. Amelie Ruths hat das nicht mehr erfahren. Niemand traute sich, ihr die Wahrheit zu sagen. Man erzählte ihr, die Schwester könne sie nicht besuchen, weil sie sich den Knöchel verstaucht habe. Amelie Ruths starb knapp einen Monat nach ihrer Schwester Frieda.
Amelie Ruths war seit 1910 Mitglied des Deutschen Künstlerbundes und hatte zu Lebzeiten Ausstellungen in verschiedenen Städten in Schleswig-Holstein, in Hamburg in der Kunsthandlung Commeter, im Kunstverein, im Museum für Hamburgische Geschichte und im Altonaer Museum. In den beiden letztgenannten Museen befinden sich heute Bilder von ihr, ebenso in der Kunsthalle. Der Verkauf ihrer Werke erzeugte stets zwiespältige Gefühle in Amelie Ruths. Bei aller Freude über den Erfolg war es ihr doch immer, als ginge „ein Kind von ihr fort“. Jedes Bild war für sie ein Stück erlebte Natur, das mittlerweile nicht mehr existiert: „Es gibt keine malerischen Kanten mehr, durch die Steindämme wird alles so langweilig.“ (Hamburger Freie presse vom 28.4.1951).
Text: Brita Reimers
Zitate:
[1] Mappe Amelie Ruths im Archiv der Hamburger Kunsthalle. Zusammengestellt von Henny Wiepking. 1964.
Amelie Ruths entstammte einer bürgerlichen Familie und besuchte die Höhere Töchterschule von Helene Bonfort und Anna Meinertz. Als sie 24 Jahre alt war, starb ihr Vater und sein Bruder, der bekannte Landschaftsmaler Valentin Ruths zog zur Familie in die heutige Heinrich-Hertz-Straße. Seit etwa ihrem vierzehnten Lebensjahr hatte Amelie Ruths bei ihm Zeichen- und Malunterricht erhalten. Nun drängte er sie, das Zeichenlehrerinnenexamen zu machen, damit sie ihre Existenz sichere. Nach dem dreijährigen Besuch der Gewerbeschule für Mädchen mit dem Abschluss als Zeichenlehrerin arbeitete sie ab 1890 an verschiedenen Schulen. Als Valentin Ruths um 1900 erkrankte, pflegte sie ihn bis zu seinem Tod im Jahre 1905. Im selben Jahr beschickte sie zum ersten Mal eine Ausstellung.
Der Erfolg motivierte sie und mit Hilfe der kleinen Erbschaft von ihrem Onkel erlernte sie bei dem Belgier Henri Luyten Freilichtmalerei und studierte in Paris den Impressionismus. Doch ihre Liebe galt der Nordseeküste, den Vierlanden und besonders den Halligen, die sie 1920 zuerst besuchte. In der Malerei ging es ihr um Licht und Farbe. Selbst als sie so schwer erkrankte, dass sie 1929 vorzeitig in den Ruhestand versetzt wurde, hielt sie an der Halligmalerei fest. Privat lebte sie mit ihren fünf Jahre jüngeren Geschwistern Frieda und Rudolph zusammen, die beide als Lehrer/in tätig waren. 1937 zogen sie in die Erikastraße 174. 1944 starb der Bruder. Als Amelie Ruths 1956 ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, erlitt ihre Schwester einen Herzschlag. Amelie Ruths, der man davon nichts erzählte, starb einen Monat später. Bilder von Amelie Ruths befinden sich z. B. in der Kunsthalle und im hamburgmuseum. Jedes Bild war für sie ein Stück erlebte Natur, das mittlerweile nicht mehr existierte.
Elisabeth Schucht
geb. Krause
Schriftstellerin, Sozialfürsorgerin in Männergefängnissen


3.7.1888
Kiel
–
8.10.1954
Hamburg
Kiel
–
8.10.1954
Hamburg
Mehr erfahren
Elisabeth Schucht war eine Romanautorin und Erzählerin. Im Munzinger Archiv heißt es über sie: "Nach dem Besuch des Lyceums bildete sie sich zunächst in Weimar zur Bildhauerin aus. Später arbeitete sie als Sozialfürsorgerin hauptsächlich in Männergefängnissen. Nach ihrer Verheiratung mit dem späteren Geheimrat Schucht im preussischen Verwaltungsdienst wandte sie sich schriftstellerischer Arbeit zu.
Von ihren Werken seien erwähnt die Romane ‚Die von uns geboren' (1920) ‚Eros' Irrfahrt' (1921), ‚Die Gezeichneten' (1930), ein Niederschlag ihrer Tätigkeit im Gefängnis, auch ins Tschechische übersetzt, weiter ‚Jo liebt einen alten Mann' (1934), auch in holländischer und englischer Sprache erschienen, ‚Unica' (1936) und ‚Der Weg in eine andere Welt' (1938).
Trotz körperlicher Behinderung - Elisabeth Schucht verlor anlässlich eines Verkehrsunfalles bei der Rettung eines ihrer Kinder selbst ein Bein - gelang es ihr aus eigener Kraft, große Reisen zu unternehmen, die sie fast durch die ganze Welt führten. So bereiste sie im Jahre 1935 die USA, Mexiko und Hawaii, in den Jahren 1938 und 1939." [1]
Zu ihren Werken zählen auch: "Eine Frau fliegt nach Fernost", "Unter der silbernen Sichel: Eine Reise durch Pakistan", "Anette im Zwielicht".
Bevor sie in Hamburg lebte, hatte sie von 1932 bis 1945 in Dresden gewohnt, wo sie mehrere Jahre dem Vorstand der Goethe-Gesellschaft angehörte. In der NS-Zeit gehörte sie keiner NS-Organisation an.
Quellen
1 Vita, siehe: Munzinger Archiv www.munzinger.de
Hanna Schüẞler
Leiterin des Evangelischen Frauenwerks Hamburg, Begründerin der Hamburger Familienbildungsstättenarbeit



23.5.1909
Rüstern/Liegnitz
–
26.6.1985
Hamburg
Rüstern/Liegnitz
–
26.6.1985
Hamburg
Mehr erfahren
Hanna Schüßler entstammte einem Pastorenhaushalt. Nach dem Abitur absolvierte sie bis 1930 eine kirchliche Ausbildung im Burckhardthaus Berlin-Dahlem und lernte die kirchliche Frauenarbeit kennen. Von 1933 bis 1934 widmete sie sich als Pfarrgehilfin in einer Berliner Kirchengemeinde der Jugendarbeit. Hanna Schüßler lehnte die "Deutschen Christen", die eine rassistische, antisemitische und am Führerprinzip orientierte Strömung im deutschen Protestantismus waren, ab. Nachdem Hanna Schüßler 1934 eine Veranstaltung der "Bekennenden Kirche", eine Oppositionsbewegung evangelischer Christen gegen Versuche einer Gleichschaltung von Lehre
und Organisation der Deutschen Evangl. Kirche in der NS-Zeit, besucht hatte, wurde sie bedrängt, den "Deutschen Christen" beizutreten. Sie weigerte sich und erhielt die fristlose Kündigung. Hanna Schüßler verließ Berlin und trat 1935 in Hamburg die Stelle als Leiterin der Landesstelle Hamburg des Burckhardthauses an, des größten deutschen Verbandes weiblicher Jugend. Diese Funktion hatte sie bis 1958 inne. Ihre schriftlichen Ausarbeitungen, die sie für die Bibelarbeit mit Heranwachsenden verfasste, führten mehrfach zu Verhören durch die Gestapo. Von 1947 bis 1956 leitete sie den Aufbau des Evangelischen Mädchenpfadfinderbundes der BRD, dessen erste Vorsitzende sie von 1949 bis 1953 war. Ab 1948 fungierte sie für 30 Jahre als Kirchenvorsteherin in der Hauptkirche St. Katharinen. 1952 beteiligte sie sich federführend an der Eröffnung und Führung des "Hauses der Offenen Tür", eines kirchlichen Klubheimes für Jugendliche in der Sierichstraße. Im selben Jahr übernahm sie Ausbau und Leitung des "Evangelischen Frauenwerkes der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate". Diese Funktion behielt sie bis zum Eintritt in den Ruhestand 1974 inne. Gleichzeitig war sie bis 1958 Leiterin des Evangelischen Jugendwerkes, außer-dem von 1952 bis 1976 Synodale der Synode der Hamburgischen Landeskirche und ab 1953 Deputierte der Hamburger Jugendbehörde. Zwischen 1953 und 1958 amtierte sie als Vorsitzende des Arbeitskreises für Jugendgildearbeit, welcher sich an Jugendliche wandte, die aus der sowjetisch besetzten Zone nach Hamburg kamen. Darüber hinaus widmete sie sich der Müttergenesungsarbeit und koordinierte sowie organisierte in Hamburg mit anderen die jährl. Sammlungen. Auch war sie maßgeblich an der Einrichtung der Mütterkurheime in Dahmeshöved/ Ostsee und Bispingen/ Lüneburger Heide beteiligt. Hanna Schüßler sorgte durch ihr kirchliches und politisches Engagement für eine Vernetzung zwischen den Organisationen und Trägern, deren ehrenamtliches Mitglied, deren Leitung, Vorstand oder Präsidentin sie war. Alle diese Tätigkeiten wiesen auf ein Ziel Hanna Schüßlers hin, die Arbeitsbereiche der Frauen- und Jugendarbeit, an der sie beteiligt war, an einem Ort zusammenzuziehen. Deshalb forderte sie 1956 auf der Landeskirchlichen Synode einen zentralen Ort für die Arbeit. 1959 war es dann so weit: Im Mai wurde das "Haus der Frau" im von der Evangelischen Kirche erworbenen Haus am Loogeplatz 16 eingeweiht. Hier erfolgte eine Zusammenführung und Zentralisierung aller Aktivitäten, Funktionen, Tätigkeiten und Ämter. 1974 ging Hanna Schüßler in den Ruhestand. Ein Jahr später wurde ihr das Bundesverdienstkreuz überreicht
Elisabeth Schulz
Oberschulrätin, erste Frau, die dem Landeskirchenrat angehörte

© kulturkarte.de/schirmer

© kulturkarte.de/schirmer

18.5.1903
Concepción/Chile
-
24.3.1957
Hamburg
Concepción/Chile
-
24.3.1957
Hamburg
Mehr erfahren
Elisabeth Schulz besuchte von 1909-1911 die Volksschule in Langengrassau im Regierungsbezirk Merseburg, von 1912-1916 die gehobene Mädchenschule in Luckau (Niederlausitz). Darauf folgten drei Jahre Lyzeum in Berlin-Pankow und von 1920-1922 das Oberlyzeum in Hermannswerder sowie in Potsdam, wo sie die Reifeprüfung ablegte. Dort besuchte sie bis 1923 die Seminarklasse und erlangte die Lehrbefähigung für Lyzeen. Im März 1924 legte sie zudem die Reifeprüfung des Humanistischen Gymnasiums ab.
Die junge Frau war von der Jugendbewegung stark beeinflusst. So studierte Elisabeth Schulz zwischen 1923 uns 1928 evangelische Theologie, Germanistik und Geschichte in Leipzig, Tübingen, Münster und Hamburg.
Karl Barth, einer ihrer Professoren, (1886-1968, Mitbegründer der "Bekennenden Kirche"), habe sie stark geprägt und besonders geschätzt. Als Schülerin hatte der Besuch von Mädchen-Bibelkreisen ihre Frömmigkeit vertieft; während des Studiums war sie Mitglied der Deutschen Christlichen Vereinigung studierender Frauen (DCVSF). Ihre erste Theologische Prüfung legte sie 1927 in Münster ab, 1929/30 folgten die beiden Staatsexamina für das Höhere Lehramt in den Fächern Deutsch, Geschichte und Religion in Hamburg.
Ihr Referendariat absolvierte Elisabeth Schulz an der Helene-Lange-Schule in Hamburg bei Emmy Beckmann (1880-1967). Seit 1930 war sie wissenschaftliche Hilfslehrerin an der Elise-Averdieck-Schule, und 1940 folgte die Ernennung zur Studienrätin. Nachdem sie drei Jahre später an die "Oberschule für Mädchen im Alstertal" versetzt worden war, wurde ihr 1944 vorübergehend die Leitung der Elise-Averdieck-Schule übertragen.
In der Zeit des Nationalsozialismus gehörte sie nicht der NSDAP an. Im September 1945 übernahm Elisabeth Schulz die kommissarische Leitung der "Oberschule für Mädchen am Lerchenfeld". Dort wurde sie 1947 zur Oberstudiendirektorin ernannt.
In ihrer als schwungvoll und tatkräftig beschriebenen Art sei es ihr gelungen, diese Schule äußerlich und innerlich wieder aufzubauen. Ostern 1955 wechselte sie als Oberschulrätin, zuständig für die wissenschaftlichen Oberschulen für Mädchen, in die Hamburger Schulbehörde, wo sie ein gutes Jahr bis zu ihrer Krebserkrankung wirkte.
Neben ihrer schulischen Tätigkeit war Elisabeth Schulz kirchlich sehr engagiert, unter anderem als Kirchenvorsteherin in ihrer St. Lukaskirche Fuhlsbüttel. Sie stand in engem Kontakt zum späteren Landesbischof Volkmar Herntrich (1908-58), der ihre Zivilcourage schätzte. Seit 1946 war sie Mitglied der Kirchensynode. Als erste und einzige Frau gehörte sie dem Landeskirchenrat an, in dem sie das Frauenwerk und das Schulreferat betreute. Ihr gelang es 1947, Karl Barth für einen Gottesdienst in Fuhlsbüttel zu gewinnen, was von Landesbischof Simon Schöffel (1880-1959) scharf gerügt worden sei.
Elisabeth Schulz war Mitglied des Kirchenrats und vom Sommersemester 1949 bis zum Wintersemester 1951/52 nebenamtliche Dozentin bzw. Lehrbeauftragte für Katechetik an der Kirchlichen Hochschule Hamburg (gegründet 1948 zur Vorbereitung der Evangelisch-Theologischen Fakultät an der Universität Hamburg).
Text: Dr. Cornelia Göksu
Adele Schwab
geb. Mennerich, Buchpseudonym Lexa Anders
Diakonisse, Sozialfürsorgerin, Buchautorin



14.6.1907
Hamburg
–
30.7.1991
Hamburg
Hamburg
–
30.7.1991
Hamburg
Mehr erfahren
Adele Schwab äußerte über ihr Leben: "Mein Leben verlief in stark ansteigenden und steil abfallenden Linien, unter viel Krankheitsnot und manchen inneren Kämpfen. Menschen, zu denen ich aufgesehen hatte im Leben, wurden mir genommen, auf dass Jesus mir alles würde. Er erfüllt meinen Alltag mit dankbarer Freude!"
Adele Mennerich wuchs gemeinsam mit ihrer älteren Schwester in Hamburg in der Heinrich-Hertz-Straße 118 auf. Ihre Mutter betrieb ein Handarbeitsgeschäft. Adele war handwerklich begabt, besuchte neben dem regulären Schulunterricht die Kunstgewerbeschule und fertigte noch zu Schulzeiten Bastpuppen an, für deren Herstellung sie ein Patent erwarb. Diese Erfindung half der Familie durch die schweren Zeiten der Wirtschaftskrise.
Im Alter von zwölf Jahren entschied sich Adele bewusst für Christus. Ihr geistiges Zuhause fand sie in der Freien evangelischen Gemeinde in Hamburg am Holstenwall. Auch ihre Eltern sowie ihre Schwester Olga stellten sich in den Dienst des diakonischen Werkes innerhalb der Freien evangelischen Gemeinde.
Nach der Schulentlassung 1922 wurde Adele Mennerich auf Anraten des Leiters der Freien evangelischen Gemeinde, der gleichzeitig auch Direktor des Hamburger Krankenhauses "Elim" war, Diakonisse. Im März 1935 machte sie ihr Krankenschwesterstaatsexamen. Doch bald bekam sie Schwierigkeiten. Ihr wurde vorgeworfen, sich nicht mehr zur Elimschwesternschaft zu zählen. Als sie von ihrer ehemaligen Mitschwester Heidi erfuhr, dass diese sich an "die Partei" (NSDAP) wenden wolle, um sie aufzuklären "wie man in Elim mit Menschen umgeht, die Jesus nachfolgen wollen", warnte Adele die Mutter Oberin. Adele wurde daraufhin aufgefordert, die Elim-Haube abzulegen. Wenige Tage später wurde der Rauswurf zurückgenommen unter der Bedingung, dass Adele Heidi nicht mehr sehen dürfe. Doch Adele weigerte sich, und so verließ sie am 31. August 1936 die Diakonie Elim.
Nun begann ihr Leben als freie Schwester. Zuerst erhielt sie Arbeit im "Abendroth-Haus" in Hamburg-Hamm. Dort wurden Prostituierte und geschlechtskranke Frauen aufgenommen. Später wurde sie als behördliche Krankenhausfürsorgerin in Hamburger Krankenhäusern tätig. In diese Zeit fällt auch ihre Heirat. Ein ihr unbekannter Witwer, der ebenfalls Mitglied der Freien evangelischen Gemeinde war, stellte ihr einen Heiratsantrag. Im Mai 1943 wurde Hochzeit gefeiert. Doch schon bald merkte Adele, wie sie es beschreibt: "daß er als Mann nicht zu seinem Recht kam". Eine gynäkologische Untersuchung ergab, dass Adele Schwabs Geschlechtsorgane infolge einer in der Kindheit erlittenen Rachitiserkrankung unterentwickelt waren. Das Paar ließ sich scheiden und Adele Schwab begann wieder in ihrem alten Beruf zu arbeiten.
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus war Adele Schwab noch viele Jahre als Fürsorgerin tätig, so auch auf St. Pauli.
Unter dem Pseudonym "Lexa Anders" veröffentlichte sie in den 1960er bis 1980er Jahren eine Vielzahl von Büchern, in denen sie u. a. über ihr Leben und ihre Hinwendung zu Gott berichtet und z. B. auch über ihre Erlebnisse als Fürsorgerin auf St. Pauli und in Hamburgs Straßen.
Anna Marie Simon
Schriftstellerin, Pseudonym: Mania Korff



25.6.1864
Walsrode
–
14.4.1931
Hamburg
Walsrode
–
14.4.1931
Hamburg
Mehr erfahren
Anna Simon war die Mutter von Leonore Toepke und Ellen Simon. Geboren als Tochter des Textilkaufmanns Julius Seckel und seiner Ehefrau Helene geb. Seckelsohn erkrankte Anna im Alter von sieben Jahren schwer und musste jahrelang das Bett hüten. Unregelmäßig erhielt sie Privatunterricht. Ihre Liebe galt der Literatur. Nach ihrer Genesung wollte sie Medizin studieren, doch ihre Eltern empfanden diesen Beruf als zu anstrengend für ihre Tochter. In dieser Zeit lernte sie Georg Simon kennen. 1889 heiratete das Paar. Es unternahm viele Reisen. Auf einer dieser Reisen nach Schweden lernte Anna Simon einige Schriftsteller kennen. Durch diese angeregt begann auch sie eine schriftstellerische Laufbahn. 1897 erschien in
einem Erfurter Verlag ihr erster Roman. Die Themen ihrer Romane behandelten Liebe, Leid, Krankheit, Freude und Tod. Später beschäftigte sie sich literarisch auch mit sozialen Fragen, so mit dem Leben von Arbeiterfrauen. Anna Simon veröffentlichte unter dem Pseudonym Mania Korff. Sie hatte Erfolg. 1897 trat Anna Simon mit ihrem Mann und ihren drei Kindern zum Christentum über. Nach dem Tod ihres Mannes Ende 1903, der es bis zum Landgerichtsrat gebracht hatte, schrieb Anna Simon keine größeren Werke mehr. Zunehmende gesundheitliche Probleme waren wohl die Ursache. Nach dem Ersten Weltkrieg zog sie mit ihren beiden Töchtern (der Sohn war verstorben) nach Hamburg in den Uhlenhorsterweg 30, später dann an den Andreasbrunnen 8.
Recherchen Dr. Stephan Heinemann, Potsdam
Anna Simon
(geb. Schwarz)
Direktorin des St. Pauli-Theaters von 1941 bis 1964


3.8.1892
Hamburg
–
16.12.1964
Hamburg
Hamburg
–
16.12.1964
Hamburg
Mehr erfahren
„Sie war die Chefin wie sie im Buche steht. Eine unglaublich faszinierende dominante Persönlichkeit, die kein Hehl daraus machte, dass sie ihre Position genoss und einen gewissen Pomp brauchte. Also eine offene Limousine, hinten Anna Simon, vorn der Chauffeur. So fuhr sie durch Hamburg. Die Direktorin kommt! Das hatte jeder zu sehen und zur Kenntnis zu nehmen. Wenn sie den Raum betrat, mussten die Anwesenden aufhören zu reden, zu essen oder was auch immer. Anna Simon rauschte herein und es ging nur noch um sie. Wenn die Aufmerksamkeit nicht auf sie gerichtet war, gab´s Ärger.
Man hatte manchmal das Gefühl, sie leite nicht das St. Pauli-Theater, sondern die Oper“, berichtet Sven Simon über seine Großmutter.
Anna Simon erlebte in den Jahren ihrer Direktorinnenarbeit am St. Pauli-Theater Höhen und Tiefen, gute und schlechte Zeiten. Mit Erfolg brachte sie das Privattheater ohne einen Pfennig Zuschuss vom Staat durch mehrere Krisenzeiten.
Sie, die ganz plötzlich nach dem Tode ihres Mannes und Direktors des Ernst-Drucker-Theaters, wie das Theater bis 1941 hieß, den Betrieb übernehmen musste, lernte, sich Respekt zu verschaffen. Als ihr Mann Siegfried Simon (geb. 1875), mit dem sie nur neun Jahre verheiratet gewesen war, 1924 starb, stand die 32jährige mit zwei kleinen Kindern, Kurt (1916-1975) und Edith (1918-1982), allein da und musste sich in den von ihrem Mann erst drei Jahre zuvor von der Witwe Ernst Druckers übernommenen Theaterbetrieb einarbeiten.
Dabei half ihr der Umstand, dass sie ihren Mann, als dieser Mitbesitzer und Direktor des Hamburger Flora-Theaters am Schulterblatt gewesen war, während des Ersten Weltkrieges vertreten hatte. Auch als Siegfried Simon Direktor des Ernst-Drucker-Theaters war, hatte sie immer großes Interesse an der plattdeutschen Bühne gehabt. Außerdem war sie, die Tochter eines Straßenbauunternehmers aus Hamburg-Hohenfelde, während ihrer Kindheit und Jugendzeit durch ihren Vater mit dem plattdeutschen Wesen bekannt geworden und hatte darüber hinaus viel vom Geschäftsleben ihres Vaters mitbekommen.
Nach einer ca. einjährigen Einarbeitungszeit hatte Anna Simon es geschafft – das Theater wurde ihre Lebensaufgabe. Sie kümmerte sich um die Schauspielerinnen und Schauspieler, Autoren, Dekorationen, Kostüme, um die Kasse – praktisch um alles.
Das Ernst-Drucker-Theater war Hamburgs ältestes Volkstheater. Es war am 24.Mai1841 unter dem Namen Urania-Theater eröffnet worden, 1844 umbenannt in Actien-Theater. 1863 erhielt es den Namen Varieté-Theater, ab 1895 hieß es Ernst-Drucker-Theater. Gespielt wurden in dieser Zeit Schauspiele, Opern, Lustspiele, Possen, seit 1863 auch viele Lokalstücke in Hamburger Platt. Ab 1884 kamen vorwiegend Volkstücke und Hamburger Lokalpossen auf die Bühne. Am 1.August 1921 übernahm Siegfried Simon das Theater. Sein Spielplan zeigte an Vor- und Nachmittagen vor geschlossenen Gesellschaften niederdeutsche Dramatiker, abends wurden Hamburger Volksstücke gegeben. Als Anna Simon nach dem Tod ihres Mannes, am 18. Dezember 1924, das Theater übernahm, behielt sie dieses Konzept bei. Der Abendspielplan zeigte vorwiegend Hamburger Lokalstücke mit Musik und Gesang, nachmittags wurden niederdeutsche Dramatiker (Bossdorf, Stavenhagen, Schurek etc.) gespielt. Dieses Konzept hatte Erfolg.
Ihre beiden Kinder unterstützen sie später bei der Arbeit. Edith Simon kümmerte sich um den kaufmännischen Bereich. Kurt Simon wurde künstlerischer Leiter.
Der größte Erfolg war die am 21.12.1940 uraufgeführte und von Paul Möhring geschriebene „Zitronenjette“ – (siehe: Erinnerungsstein für Zitronenjette im Garten der Frauen) ein echtes Hamburger Volksstück. Es wurde im Laufe der Zeit in mehreren Serien über 600mal in Szene gesetzt. Dieses erstmals im Nazi-Deutschland aufgeführte Theaterstück konnte nicht über die Gewaltherrschaft der Nazis hinwegtäuschen. Und auch das St. Pauli-Theater bekam des Despotismus dieses Regimes zu spüren. Die Geschwister Simon schrieben dazu 1965 in ihrer „Denkschrift an unsere Freunde“: „Wer diese Zusammenhänge in den Jahren zwischen 1933 und 1945 kennt, weiß, dass kein Hamburger Theater so sehr dem Druck der nazistischen Machthaber ausgesetzt gewesen ist wie das damalige ‚Ernst-Drucker-Theater´. Es kam 1941 zum hundertjährigen Bestehen des Hauses schließlich so weit, dass man unserer Mutter das Theater nehmen wollte. ‚Wir wollen den Namen Simon nicht mehr sehen!´, hieß es im damaligen Gau-Propaganda-Amt.“ Anna Simon war massiven Schikanen seitens der Nazis ausgesetzt. Als das 100-Jährige Bühnenjubiläum am 24.5.1941 gefeiert werden sollte, erging der Befehl, das Theater umzubenennen. Der Name „Ernst Drucker“ war jüdischer Herkunft. Von nun an sollte das Theater St. Pauli-Theater genannt werden – und so heißt es heute noch.
Auch die Festschrift, die zum Jubiläum gedruckt worden und noch unter dem Titel „Ernst-Drucker-Theater“ erschienen war, wurde sofort nach Erscheinen mit der Begründung verboten, sie enthalte zwei Abbildungen nicht-arischer Theaterangehöriger, die von Kurt und Edith Simon.
Dessen ungeachtet übernahm Kurt Simon im selben Jahr die Inszenierung fast aller nun am St. Pauli-Theater zu spielenden Stücke. Zum Jubiläum inszenierte er das Stück „Hamborger Luft vor hunnert Johr“ von Paul Möhring. Der Presse wurde verboten, den Namen Kurt Simons zu nennen. Ein einziger Journalist bewies Zivilcourage und schrieb: „Für die Spielleitung verantwortlich zeichnet Kurt Simon.“ Kurt Simons Inszenierungen kamen beim Publikum an, mehr als 50 Volksstücke und Lokalpossen inszenierte er im Laufe der Jahre. Seine Spezialität war ein Volkstheater mit viel Musik und Gesang.
Am 1.September 1944 wurden alle Theater in Deutschland geschlossen. Viele Theaterhäuser fielen den Bomben zum Opfer, das St. Pauli-Theater wurde verschont. Es erhielt gleich nach dem Krieg als erstes Theater Hamburgs von Feldmarschall Montgomery eine Sonderlizenz zur Wiedereröffnung. Am 29.August 1945 wurde wieder gespielt: die „Zitronenjette“.
In Hamburg begann der mühsame Wiederaufbau mit seinen Hungerjahren und finanzieller Knappheit. Das St. Pauli-Theater überlebte. Die Menschen wollten Volksstücke sehen, sie wollten lachen und sich einige schöne Stunden bereiten. Ausverkaufte Vorstellungen waren deshalb in den 50er Jahren keine Seltenheit. Aber es gehörte viel Tatkraft dazu, in dieser geldknappen Nachkriegszeit das Theater aufrechtzuerhalten. „Der Besitzer eines Privattheaters muss genau rechnen. Und er muss sehr darauf sehen, dass er Besucher bekommt“, sagte Anna Simon. In ihrer „Denkschrift an unsere Freunde“ aus dem Jahre 1965 schrieben die Geschwister Simon, die nach dem Tod ihrer Mutter 1964 den Theaterbetrieb übernommen hatten, über die finanziellen Krisen, die das Theater im Laufe der Jahre erschütterten: „Seit Jahrzehnten galt unser Theater als krisenfest. Aber der Wandel der Zeit brachte auch hier eine Änderung. Als Rundfunk und Tonfilm aufkamen, setzte der Besucherrückgang ein; da aber damals noch Reserven an Kapital vorhanden waren, konnte dieser Zustand überwunden werden. Diese Reserven wurden jedoch in der Nazizeit, im Kriege und nach der Währungsreform immer geringer. Das Fernsehen wirkte sich auf unser Haus äußerst katastrophal aus“ 1).
Welche Achtung Anna Simon in Hamburg entgegengebracht wurde, zeigt die Verleihung der „Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes“ durch den Hamburger Senat zu ihrem 65.Geburtstag.
Anna Simon stand bis zuletzt als Direktorin dem Theater vor. Über die letzten Jahre ihrer Mutter am St. Pauli-Theater berichten ihre Kinder: „Unsere Mutter, Anna Simon, war trotz ihres Alters und ihres schweren Leidens (sie starb an Krebs) von morgens bis in den späten Abend im Theater und baute bis zuletzt auf die Anhänglichkeit und Treue der Hamburger zu diesem alten Volkstheater. Sie hat sich im wahrsten Sinne des Wortes für ihr Theater aufgearbeitet.“
Text: Rita Bake
Zitate:
Vgl.: Marilen Andrist: Das St. Pauli Theater. Hamburg 1991.
[1] Denkschrift an unsere Freunde! St. Pauli-Theater. Direktion Geschwister Kurt und Edith Simon. Herbst 1965.
Dr. Ellen Simon
Jugendamtsleiterin



16.7.1895
Nordhausen bei Erfurt
–
13.7.1982
Berlin
Nordhausen bei Erfurt
–
13.7.1982
Berlin
Mehr erfahren
Dr. Ellen Simon, Schwester von Lola Toepke, studierte nach bestandenem Abitur im Jahre 1915 Volkswirtschaft, Jura, Philosophie und Psychologie. 1921 promovierte sie in Jura über das Thema "Schutzerziehung und Besserungserziehung". Von 1925 bis 1931 war sie Abteilungsleiterin des Jugendamtes und des Landesjugendamtes in Hamburg. 1931, nach dem Tod der Mutter Anna Simon, zog sie nach Königsberg, um dort die Leitung des Jugendamtes zu übernehmen. 1932 führte sie den ersten Arbeitsdienst für erwebslose Mädchen ein. Wegen ihrer Parteizugehörigkeit (seit 1930) zur SPD wurde sie 1933 von den Nazis ihres
Amtes enthoben. Im selben Jahr emigrierte sie in die Schweiz, arbeitete dort als Dozentin an einer Schwesternschule und als Privatpflegerin und ging 1938 nach London. Dort war sie als Sozialarbeiterin im East End tätig, hielt Verbindung zur bekennenden Kirche in Deutschland und kehrte im Mai 1948 nach Deutschland zurück. Nachdem sie 1950 in den USA einen Ausbildungskursus für Einzelfallhilfe absolviert hatte, wurde sie 1951/52 Lehrbeauftragte für Vormundschaftsrecht an der Universität Frankfurt/Main. Von 1953 bis 1960 arbeitete sie als Leiterin des Pestalozzi-Fröbel-Hauses in Berlin. Dr. Ellen Simon war Gründungsmitglied der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und Beiratsmitglied im deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Bis zu ihrem Tod lebte die unverheiratet und kinderlos Gebliebene in Westberlin.
Recherchen Dr. Stephan Heinemann, Potsdam
Elsa Teuffert
(geb. Jansen)
Bürgerschaftsabgeordnete der FDP



12.6.1888
Hamburg
–
10.3.1974
Hamburg
Hamburg
–
10.3.1974
Hamburg
Mehr erfahren
Als Elsa Teuffert im März 1966 im Alter von 77 Jahren nach zwölfjähriger Zugehörigkeit – von 1954 bis 1957 als Abgeordnete des Hamburg Blocks und von 1958 bis 1966 als Abgeordnete der FDP – aus der Hamburgischen Bürgerschaft ausschied, schrieb sie einen offenen Brief an die Hamburger Bevölkerung: „Liebe Mitbürger! Erlauben Sie mir, Ihnen anlässlich meines Ausscheidens aus der Hamburger Bürgerschaft die nachstehenden Zeilen zu übermitteln: Die hinter mir liegenden Jahre haben mich mit Dankbarkeit darüber erfüllt, dass ich vielen Männern und Frauen in mannigfachen Nöten und Anliegen zur Seite stehen konnte. Das mir dabei entgegengebrachte Vertrauen veranlasst mich, Ihnen zu sagen, dass mein Verzicht auf eine Kandidatur für die neue Bürgerschaft nicht das Ende meiner Arbeit überhaupt bedeutet. Ich habe mich bereit erklärt, dem Wunsche meiner Partei zu entsprechen und als ihre Sozialreferentin alle Fragen des sozialen Bereichs zu bearbeiten, allen Anliegen nachzugehen und den Schwierigkeiten abzuhelfen, soweit dafür nur irgend die Voraussetzungen gegeben sind. (...) In guter Verbundenheit Ihre Elsa Teuffert.“
Elsa Teuffert hatte in Hamburg die Paulsenstiftschule (siehe dazu historischer Grabstein von Anna Wohlwill und Historischer Grabstein von Hanna Glinzer) zur besucht und 1907 einen Telegraphendirektor geheiratet. 1928 wurde sie Witwe.
1923, im Alter von 35 Jahren, begann Elsa Teuffert ehrenamtlich für die Wiedergutmachung des „Inflationsunrechtes“ tätig zu werden. Bis 1933 betreute sie durch die Inflation um ihre Ersparnisse gebrachte Menschen. Nach der Ausbombung während des Zweiten Weltkrieges wurde Elsa Teuffert nach Ostpommern evakuiert und kehrte 1945 nach Hamburg zurück. Ein Jahr später, 1946, im Alter von 58 Jahren, trat sie der FDP bei. Damit begann ihre politische Karriere. Bevor Elsa Teuffert 1954 als Abgeordnete in die Bürgerschaft gewählt wurde, war sie von 1951 bis 1954 Bezirksabgeordnete in Hamburg-Altona und von 1953 bis 1954 Deputierte der Baubehörde gewesen. Außerdem war sie von 1953 bis 1959 Vorsitzende der FDP-Landesfrauengruppe und in den 50er-Jahren Vorstandsmitglied des Hamburger Frauenringes.
Was sie trieb, die vielen politischen Belastungen auf sich zu nehmen, beschrieb sie 1958 in einem Brief an Wilm Sanders, einen Sohn der Familie Sanders, bei der sie wohnte: „Sie [die Arbeit] befriedigt mich (..) sehr durch ihre Vielseitigkeit. (...) Wie oft kann man doch helfen oder wenigstens einen Weg zeigen. (...) Heute war ich unterwegs, um eine Kleingarten-Kolonie, die räumen soll, zu retten, was günstigstenfalls auf dem Wege über viele Verhandlungen möglich ist.“ Privat lebte Elsa Teuffert sehr bescheiden. In Zeiten der Wohnungsnot wurde sie 1947 in den Kielkamp 23 bei Familie Sanders und ihren fünf Kindern einquartiert. Die Juristin Dr. Maria Sanders (1905–1998) war langjährige Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes Hamburg und Mitbegründerin der Katholischen Frauen- und Familienbildungsstätte Hamburg gewesen. Elsa Teuffert wählte dort das kleinste Zimmer, welches spartanisch mit einem Bett, Tisch, Waschtisch, Spiegel, Stuhl und Schrank ausgestattet war. Dort lebte sie, bis sie 1971 in eine Seniorenwohnung zog. Elsa Teuffert wurde den fünf Sanders-Kindern eine Ersatzgroßmutter. Mit dem Sohn Wilm – später Msgr. Wilm Sanders, Geistlicher Rektor der Katholischen Akademie Hamburg und Priester der katholischen Gemeinde St. Ansgar (Kleine Michaelis Kirche) – pflegte sie während seiner Studienjahre in Rom einen regen Briefwechsel, der auch Einblick gibt in die knappe Gestaltung des Privatlebens von Elsa Teuffert. So schrieb sie kurz vor Weihnachten 1955: „Zur Zeit wird ein gedämpftes Privatleben geführt, d. h. ohne Sitzungen und Termine, nur dringende Anrufe verlangen ganz schnell noch die Regelung kompliziertester Fälle (mal eben) und viele interessante ‚Vorlagen‘ (...) müssen bis Anfang Januar bearbeitet sein, denn dann steigen wir in die Haushaltsberatungen.“ Ihr Zimmer wurde von Frau Ladiges sauber gehalten: „Meine gute Frau Ladiges hielt heute Zimmerputz, so dass ich mich an einer schönen und geordneten Umwelt freuen kann, was leider nicht immer der Fall ist. Kein Wunder, wenn man immer so durch die Gegend sausen muss und meistens abgekämpft heimkommt.“ Noch im hohen Alter freute sich Elsa Teuffert, wenn sie helfen durfte. So schrieb sie 1972 aus ihrem Alterswohnsitz: „Von meiner Bleibe ließe sich auch viel erzählen; es ist nämlich ein weit verbreiteter Irrtum, dass es in Altersheimen eintönig zugeht. Selbst bei einer Belegschaft von nur sechs Insassen ist immer etwas ‚los‘; ich bin froh, dass ich in meiner Frau Klatt einen Schützling gefunden habe, der mich sehr nötig braucht, und auch somit mancherlei Pflichten habe, die mich ausfüllen.“
Text: Dr. Rita Bake
Quellen:
Briefe: Privatarchiv R. Bake
Charlotte Thiede Eisler-Rodewald
Malerin

Ausschnitt aus "Selbstportrait mit Otto Rodewald"


4.4.1917
–
4.5.1979
Hamburg
–
4.5.1979
Hamburg
Mehr erfahren
Charlotte Thiede Eisler-Rodewald verstarb im Alter von 62 Jahren an Anorexie, an einer Krankheit, die sie schon zu Lebzeiten zum langsamen Verschwinden von dieser Welt brachte. Dass sie in dieser realen Welt nicht leben konnte, zeigen ihre Zeichnungen und unterstreichen ihre Weggefährten. So schreibt ihr Neffe Roger Thiede in seinem Nachruf auf seine Tante: "Ihre Kunst war (…) anachronistisch. (…) das heißt soviel wie aus der Zeit gefallen. (…) das heißt, gar nicht voll in einer Zeit aufzugehen, sich den Glauben an etwas anderes, besseres zu bewahren. (…) fast gibt es kein Bild, keine Zeichnung, die nicht eine paradiesische Landschaft, die nicht jene anmutigen Mädchenfiguren abbilden, (…) die unserer Gegenwart, den Realitäten unserer Welt, der Industrie, dem Älterwerden krass entgegengesetzt ist. Damit ist Charlottes Künstlertum ungefähr beim Namen genannt: die fixierende Beschwörung einer Jugend, eines Mädchentums voller Schönheit und Geheimnis,
einer Entrückung, einer fast sakralen Unantastbarkeit, die allen Verwertungen europäischer Lebensläufe entgegensteht. (…) Charlotte hat dieses Bild von einer mädchen-haften Existenz nicht nur gemalt, sondern auch zu leben versucht. Wer sie in ihrem Atelier besuchte, konnte oft wirklich meinen, es mit einem ihrer Geschöpfe zu tun zu haben - dem Exotismus ihrer Person entsprach ihre Leidenschaft für das Uneuropäische, für China, Indien, für Afrika und die indianischen Kulturen. Umso schlimmer traf sie die Erkenntnis, dass eben jene Kulturen der Dritten Welt einem unaufhaltsamen (…) Zerstörungsprozess ausgeliefert sind. Denn mit den Völkern sah sie sich selbst bedroht - eine letzte Zuflucht vor der Profanität unserer Gesellschaft wurde mit jedem Tag irrealer, wurde mit jeder Nachricht drastischer zerstört, die man im Fernsehen hören konnte. (…) Das übermächtige Bild einer mädchenhaften Idylle konnte der Wirklichkeit auf die Dauer doch nicht standhalten. (…) Es ist nicht übertrieben zu sagen, daß Charlotte Eisler-Rodewald an solchen Konflikten gestorben ist." 1) Und auch der Publizist Erich Lüth schlug ähnliche Töne an in seinem Nachruf auf Charlotte Thiede Eisler-Rodewald: "Könnte sie noch zu uns sprechen, die wir uns ihr so ganz nahe fühlen, so würde sie, die in ihrer Selbstkritik so unbeirrbar gewesen ist, entgegen den Konventionen sagen: Dieses doch so oft grausame und unbarmherzige Leben - mein Leben - war nicht erfüllt, denn meine künstlerischen Träume sind nur zu einem viel zu kleinen Anteil gereift. Ich habe sie nicht erfüllt und ich konnte sie, so viel ich auch geschaffen habe, nicht erfüllen - denn sie wollte in ihrer fast beispiellosen Intensität mehr. Als sie noch jung war, gertenschlank, ja geradezu zerbrechlich, strahlte sie Hoffnung aus, durch die sie uns, ihre Gefährten und ihre Freunde, mitriss. Aber sie hat immer in zwei Welten gelebt, die offenbar nicht zu vereinigen waren. Das war die Welt des Aussatzes und der Barbarei, gegen die sie und Otto Rodewald sich immer wieder radikal bis an die Grenze der Selbstvernichtung, empört haben. Deshalb widmete sie sich noch bis zuletzt der Gesellschaft für bedrohte Völker. Das andere aber war die Welt ihrer schöpferischen Visionen, in denen sich alle Banalitäten des Alltags dichterisch in eine Zauberwelt verwandelten." 2)
Mit 15 Jahren war Charlotte Thiede 1932 zu ihrem Lehrer und späteren Ehemann, den 25 Jahre älteren Maler und Grafiker Otto Rodewald (1891-1960) gekommen. Geprägt durch die Schrecken des Ersten Weltkrieges und die dabei erlittenen Verwundungen zog sich Rodewald mit seinen Bildern ins Märchenhafte und Symbolistische zurück. Als Charlotte Thiede Rodewalds Schülerin wurde, "war Rodewald gerade von einem mehrjährigen Aufenthalt im nordafrikanischen Sidi Boussaid (1929-1931) zurückgekehrt. Noch ganz erfüllt von jener so andersartigen Welt (…) hat Rodewald zweifellos seiner jungen Schülerin viel von dieser anderen, entrückten Welt erzählt, so wie sich auch seine Bewunderung für die ostasiatische Kunst und Geisteswelt auf seine Schülerin übertrug." 3) Denn hier trafen sich zwei verwandte Seelen: Charlotte Thiede war "aus der eigenen Gemütsstimmung heraus offenbar voll leidenschaftlicher Empfänglichkeit für die kritische Welterfahrung Rodewalds und seine Gedanken. Sie begriff, welch wesentlichen Wert, welchen Schutz die Flucht in eine imaginäre, dem Zugriff des Alltags entrückte Welt bot." 3) 1937 wurden Arbeiten von Rodewald als "entartete Kunst" von den Nazis beschlagnahmt. Ende der 1940er Jahre heirateten Rodewald und Charlotte Thiede. Für Rodewald war es die zweite Ehe. Auch nach Rodewalds Tod setzte sich Charlotte Eisler-Rodewald für das Werk ihres verstorbenen Mannes ein und erhielt darin Unterstützung durch ihren zweiten Ehemann, den Verleger George B. Eisler, ein Freund Rodewalds. Zum Gelderwerb illustrierte Charlotte Thiede Eisler-Rodewald in den 1950er Jahren Romanfortsetzungen im Hamburger Abendblatt, so z. B. die Fortsetzungsfolge "Percy ist zu jung für Dich! Aus den Briefen eines jungen Mädchens" von Marga Berck. Und sie illustrierte auch die vom Hamburger Abendblatt zwischen 1961und 1952 zur Adventszeit veröffentlichten "Märchen aus uralten Zeiten". Aber sie arbeitete zehn Jahre lang auch für die internationale Zeitschrift "scala international" und illustrierte z. B. Carl-Albert Langes Nachdichtung chinesischer Lyrik "Der Pavillon aus Porzellan". Über Charlotte Thiede Eisler-Rodewald als Person äußert ihr Neffe: "Sie war Künstlerin von Beruf, (…). Momente eines trotzigen Boheme-Lebens bestimmten ihr Bild, jene für den Normalbürger oft so verwirrende Mischung von Entsagung und Freude am Schönen - auch am ‚Luxus', der nicht den vermögenden Philistern vorbehalten sein sollte. Ihre Jugendlichkeit prägte ihr Leben und ihre Kunst." 1) Und Erich Lüth berichtet: "Dieser zarte Mensch, der von einem anderen Stern zu uns gekommen schien, hatte in seiner Feinfühligkeit, eine ungewöhnliche Kraft, im Hause an der Sierichstraße eine jeden ihrer Freunde oder Besucher entrückende Atmosphäre zu schaffen. Sie liebte die kleinen Dinge der Welt und des Lebens: Gläser, Mineralien, winzige Statuetten. Sie blieb aber auch als Surrealistin immer einer blühenden Wirklichkeit nahe." 2) Über ihr Schaffen in ihren letzten Lebensjahren resümierte Werner Timm: "Die Zeichenkunst der Charlotte Thiede erreicht am Ende ihres Lebens in einer Gruppe von Zeichnungen um 1977-78 einen letzten Höhepunkt. Hierbei handelt es sich überwiegend um reine, ideale Landschaften und Blumen Arrangements. Diese Landschaften sind menschenleer, einsam, von seltsamer Melancholie erfüllt. (…) mehrmals stößt man bei diesen Landschaften auf die Trauerweide, die mit der schwermütigen Gebärde der herabhängenden Zweige geradezu wie ein Leitmotiv oder Leitsymbol der seelischen Stimmung dieser Zeichnungen wirkt. Eine unsagbare Trauer und Einsamkeit spricht aus diesen Werken. (…) Gelegentliche Notizen der Künstlerin auf einigen Zeichnungen lassen die tiefe Verzweiflung erkennen, die hinter der noblen Gebärde der Trauer steht, die ihre Landschaftszeichnungen erfüllt. ‚Warum sie mich hassen. Meine Blumen wollen sie nicht und die Tiere' heißt es 1978 und im Todesjahr 1979 voll Resignation und Wissen um den Tod der lakonische Vermerk ‚Die Zeit ist um'." 3)
Quellen:
1) Roger Thiede: Nachruf, in: Charlotte Thiede 1917-1979. Aus ihrem künstlerischen Schaffen mit einer Einführung von Werner Timm und Nachrufen von Erich Lüth und Roger Thiede. Hamburg 1980.
2) Erich Lüth: Nachruf, in: siehe unter 1)
3) Werner Timm: Zu den Zeichnungen von Charlotte Thiede, in: siehe unter 1)
Marie Thierfeldt
Handweberin



20.2.1893
Frankenhof
–
31.12.1984
Hamburg
Frankenhof
–
31.12.1984
Hamburg
Mehr erfahren
Geboren wurde Marie Thierfeldt auf dem väterlichen Hof in Frankenhof, Kreis Gumbinnen, in Ostpreußen. Sie hatte zwei Brüder und eine äItere Schwester. Ihre Mutter war bereits verstorben, als im Ersten Weltkrieg das Elternhaus zerstört wurde. Den Auftrag für den Wiederaufbau des Hauses bekam der damals noch junge und unbekannte Architekt Hans Scharoun. Er, der später ein bedeutender Architekt wurde, war es, der Marie Thierfeldt, die eine Weblehre mit Gesellen- und Meisterprüfung an der höheren Textilschule in Berlin absolvierte, riet, nach Weimar zu gehen und dort am Bauhaus zu studieren. Marie Thierfeldt folgte dem Rat und studierte
zwischen 1924 und 1925 am Bauhaus in Weimar und 1926 am Bauhaus in Dessau.
"Gropius vermittelte mir das Gefühl für den Raum, Kandinsky die Fläche, Klee die Farbe", erzählte sie später.
"Meine künstlerische Arbeit bekam dann ihre Bestätigung in meiner Berufung zur außerordentlichen Lehrerin an der Königsberger Kunstakademie". Dort war sie von 1927 bis 1933 tätig. Dann betrieb sie eine eigene Webwerkstatt in Insterburg. 1941 ließen die nationalsozialistischen Behörden die Werkstatt schließen. Marie Thierfeldt wurde dienstverpflichtet. Silvester 1944 floh sie nach Schleswig-Holstein, wo sie als Jute-Weberin ihren Lebensunterhalt verdiente. Später übernahm sie in Ahrensburg eine kleine Weberei, bis sie 1950 in Hamburg am Mittelweg 145 Hinterhof eine Werkstatt errichten konnte. Dort standen drei große Webrahmen. Ein Webrahmen erlaubte sogar Spannbreiten bis zu drei Metern. Über ein Holztreppchen ging es zur Wohnwerkstatt. Auch hier standen Spinnräder und ein Webstuhl. Die Wohnung teilte sie sich mit ihrer älteren Schwester Lina Bartschat (26.7.1888 - 2.10.1970), die den Haushalt führte und auch die Angestellten - eine Weberin und zwei Lehrlinge - bekochte.
Marie Thierfeldt beschäftigte sich vor allem mit der Mischung und Abstufung der Materialfarben. Für einen Teppich in der St. Petri Kirche in Hamburg verwendete sie die Farbe Rot in 40 Varianten. Ihre Arbeiten waren und sind in vielen öffentlichen Gebäuden und Museen zu finden, so im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Sie stellte u. a. Wandteppiche für das Gemeindehaus Langenhorn, das Gemeindehaus Geesthacht, den Sitzungsraum der Großmarkthalle und für die Deutsche Botschaft in Stockholm her. Für die Hamburgische Staatsoper schuf sie den Wandteppich "Petruschka", der heute im Ballettzentrum hängt. Für den Wandteppich, den sie für das Gästehaus der Deutschen Bank herstellte, erhielt sie 1966 den Preis der Hamburger Kulturbehörde.
Leonore (Lola) Toepke
Bildhauerin, Opfer des Nationalsozialismus



4.7.1891
Leopoldshall
–
3.1.1945
im KZ Stutthoff
Leopoldshall
–
3.1.1945
im KZ Stutthoff
Mehr erfahren
Als Edith Leonore Caroline Simon wurde Lola Toepke am 4. Juli 1891 in Leopoldshall nahe Staßfurt im Herzogtum Anhalt geboren. Sie war die älteste Tochter des Juristen Georg Simon und seiner Frau Anna Marie geb. Seckel.
Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in Staßfurt, Nordhausen und Halle an der Saale (durch berufsbedingte Umzüge des Vaters). Lola besaß als Mädchen eine überbordende Phantasie und war sehr verspielt. Das ließ sie in Konflikt mit dem strengen, auf Autorität ausgerichteten preußischen Schulsystem geraten. Schließlich wurde sie vom Schulunterricht als zu „unaufmerksam“ ausgeschlossen. Ihre Eltern brachten sie mit elf Jahren im 1890 gegründeten Schulinternat für entwicklungsgeschädigte und -gestörte Kinder des Pädagogen Johannes Trüper (1855-1921) in Jena unter, das zu der Zeit das erste Heilerziehungsheim in Deutschland war. Dort entdeckte man ihre große künstlerische Begabung, die man durch eine musische Erziehung auffing. Sie soll anlässlich eines Streits mit einem Familienmitglied entdeckt worden sein, bei dem Lola erregt ein Stückchen Ton in ihrer Hand hin- und herknetete und am Ende feststellte, dass daraus eine Figur geworden war. Nach Abschluss der mittleren Reife auf einer Schule im schweizerischen Neuchâtel, wo sie in natürlicher Umgebung zu sportlicher Betätigung angeregt wurde und sich mit der französischen Sprache und Dichtung vertraut machte, kehrte sie mit 16 Jahren zu ihren Angehörigen nach Halle an der Saale zurück (ihr Vater war 1903 gestorben).
Lola Simon beschloss, ihren künstlerischen Neigungen weiter nachzugehen. An der Universität Halle erwirkte sie mit Hilfe ihrer Mutter, die dort Kunstgeschichte studierte, eine Zulassung als Gasthörerin bei den kunstgeschichtlichen Kollegs. Nachfolgend besuchte sie die Kunstgewerbeschule in Halle, wo sie das Handwerk der Bildhauerei erlernte. Die Kunstgewerbeschulen hatten sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts nur zögernd für Frauen geöffnet. Kunst sollte nicht der Berufsfindung, sondern der Geschmacksbildung für höhere Töchter dienen. Daher waren die hauptberuflich Lehrenden auch alle Männer, die darauf achteten, dass die Zahl zu unterrichtender Frauen begrenzt blieb, um genügend Studienplätze für männliche Kommilitonen bereithalten zu können. Doch gelang es der temperamentvollen Lola Simon augenscheinlich, sich auf dem Gebiet der Kunst durchzusetzen.
Im Alter von 20 wurde sie Meisterschülerin von Professor Engelmann und folgte ihm an die Kunsthochschule nach Weimar. Richard Engelmann (1868-1966) gehörte vor dem Ersten Weltkrieg zu den führenden deutschen Bildhauern und Radierern. Zwischen 1913 und 1933 wirkte er als Professor für Bildhauerei an der Weimarer Hochschule für bildende Kunst. 1935 wurde er als Jude offiziell mit Berufsverbot belegt; dank einer „arischen Mischehe“ konnte er die NS-Zeit in der Nähe von Freiburg im Breisgau überleben.
1914 meldete sich Lola Simon freiwillig als Hilfsschwester für das Rote Kreuz, das sie nach Ostpreußen schickte.
Erst 1919 kehrte sie nach Weimar zurück, wo der bekannte Architekt Walter Gropius (1883-1969) im Frühjahr die Kunsthochschule in das neue Staatliche Bauhaus Weimar eingegliedert hatte. Nach Differenzen mit Gropius verließ Engelmann allerdings das Bauhaus und leitete ab 1921 die Bildhauerklasse an der wieder errichteten Hochschule für bildende Kunst.
Lola Simon heiratete 1921 einen Herrn Toepke aus Guatemala, dessen Vater Deutscher war. Doch während ihr Ehemann wieder dorthin zurückkehrte, um den Familienbesitz aufzubauen, blieb sie weiter in Deutschland. (Möglicherweise wird es sich bei dem Ehemann um Hermann Toepke gehandelt haben. 1939 berichtete Professor Franz Termer, von 1935 bis 1962 Direktor des Museums für Völkerkunde in Hamburg und Lehrbeauftragter für Ethnologie an der dortigen Universität, über seine Reise durch den Westen Guatemalas, bei der er auch auf der Finca „des Herrn Hermann Töpke“ Station gemacht hatte.) 1923 ließ Lola sich wieder scheiden. Nach Meinung einer Zeitzeugin soll die kurze Ehe, aus der keine Kinder hervorgingen, von Lola nur aus dem Grund geschlossen worden sein, um ihren allzu jüdisch klingenden Nachnamen ablegen zu können. Eine andere Dame ist der Überzeugung, dass die Ehe scheiterte, weil Lola nicht mit in die Heimat ihres Mannes kommen wollte, der sie zudem ohne Zustimmung seiner Eltern geheiratet habe. Auch habe sie sein späteres Angebot, aus dem nationalsozialistischen Deutschland zu ihm nach Mittelamerika zu kommen, abgelehnt.
Der Verlegung des Bauhauses nach Dessau im Jahr 1925 folgte Lola Toepke nicht. Sie verließ Weimar und richtete sich in Hamburg-Wandsbek ein eigenes Atelier ein. In Hamburg, wo zu der Zeit auch ihre Mutter und ihre jüngere Schwester Ellen Simon (auch auf dem Grabstein verewigt) wohnten, besuchte sie die Landeskunstschule und erhielt Unterricht vom Bildhauer und Illustrator Johann Bossard (1874-1950). Als freie Künstlerin war sie zwei Jahre in Holland tätig. Daneben nahm sie mehrere Portraitaufträge an: Sie lebte dazu in verschiedenen Familien in Deutschland, wo sie die Kinder im freien Spiel beobachtete, um dann eine Büste von ihnen anzufertigen. 1927 bezog Lola ein Atelier im Mittelhaus in der Breiten Straße 14.
Groß, dunkelhaarig mit modischem Bubikopf und von attraktivem Äußeren ging Lola Toepke ganz in ihrem Beruf auf und genoss die Freiheiten des Künstlerlebens, die sich ihr in den zwanziger Jahren in Hamburg boten. Sie galt als großzügig und warmherzig, soll aber auch gelegentlich verschwenderisch gewesen sein. Sicherlich nahm sie an vielen der ausgelassenen Feste der Hamburgischen Sezession und Künstlerschaft teil. Der „Hamburger Anzeiger“ schrieb dabei über eines der von vielen Hamburger Bürgern als zu freizügig empfundenen Künstlerfeste beruhigend, „dass selbst um die vierte Morgenstunde alles aufs Fleißigste tanzte, aufs Lustigste scherzte, und dennoch die so leicht im Sekt ertrinkenden Grenzen innerlicher Wohlanständigkeit immer spürbar blieben“.
Jeden Donnerstagnachmittag traf sich im Atelier von Lola Toepke eine kleine Künstlergruppe zum gemeinsamen Arbeiten. Lolas Vorbilder waren Rodin und Barlach. Als Mitglied der Hamburgischen Künstlerschaft stellte sie zwischen 1928 und 1932 ihre figürlichen Ton- und Gipsplastiken in der Hamburgischen Sezession sowie im Hamburger Kunstverein aus. Die meisten ihrer wenigen Arbeiten, meist kleinformatige Keramiken, befinden sich heute in Privatbesitz. Ausnahmen bilden die Büste des Kunstkritikers Harry Reuss-Löwenstein (1880-1966) von 1928, die das Hamburger Staatsarchiv in dessen Nachlass verwahrt, sowie die Feinkeramik „Tänzerin“ von 1928/29, die sich im Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof befindet.
Daneben war Lola Toepke auch pädagogisch tätig. So versuchte sie, die Frau des Volksschullehrers Fritz Borchert mit Tonarbeiten an ein plastisches Verständnis heranzuführen. Dies gelang auch zunächst: Hertha Borchert (17.2.1895 Altengamme - 26.2.1985 Hamburg. Ihr Grab befindet sich auf dem Ohlsdorfer Friedhof: Grablage: AC 5, 6, siehe zu ihr in de rRubri: Frauen auf der Erinnerungsskulptur) schaffte sich einen Töpferbock an und arbeitete bis spät in die Nacht hinein in ihrer Küche an Plastiken. Doch schien ihr das bald zu mühevoll; sie wandte sich der Schriftstellerei zu und wurde eine bedeutende plattdeutsche Autorin. Überrundet wurde sie in ihrer Berühmtheit allerdings von ihrem 1921 geborenen Sohn Wolfgang Borchert, dessen bekanntestes Stück „Draußen vor der Tür“ (das kurz nach seinem Tod am 21. November 1947 in Hamburg seine Uraufführung erlebte) bis heute auf deutschen Bühnen gespielt wird. Als Kind werden sich Lola Toepke und er sicherlich im Haus seiner Eltern begegnet sein.
Da Lola Toepke gern mit anderen, speziell jungen Menschen zusammen war, müssen sie die antijüdischen Gesetze nach dem Machtantritt Hitlers schwer getroffen haben. Am 25. April 1933 wurde sie unehrenhaft aus der Hamburgischen Künstlerschaft ausgestoßen. Die Bestimmungen der „Nürnberger Gesetze“ machten die 1897 evangelisch Getaufte wegen ihrer jüdischen Vorfahren wieder zur Jüdin. Sie durfte nicht mehr ausstellen und wurde 1937 schließlich aus der Reichskammer der Bildenden Künste ausgeschlossen. Eine dortige Mitgliedschaft war Bedingung, um im nationalsozialistischen Deutschland künstlerisch arbeiten und öffentlich ausstellen zu können. Aus Protest gegen den Rassismus der NS-Machthaber hatte sie sich aus dem Hamburger Hafen einen schwarzen Matrosen als Modell in ihr Atelier geholt und von ihm eine Büste angefertigt. Wegen dieser (damals so bezeichneten) „Negerbüste“ wurde sie von einem Bewohner aus ihrem Haus angezeigt, der der SS angehörte. Seit 1934 wohnte Lola Toepke im vierten Stock in der Lübecker Straße 82 (heute Lübecker Straße 78a).
Nach ihrem Ausschluss aus der Kulturkammer konnte sie sich für einige Zeit ihren Lebensunterhalt bei einem Steinmetz verdienen. Daneben unterstützten Lola, die durch die zunehmende Zahl antijüdischer Verordnungen immer stärker aus dem öffentlichen Leben gedrängt wurde, aber auch viele Freunde und Bekannte weiter finanziell, indem sie ihr Skulpturen abkauften oder sie in der Vorweihnachtszeit zum Basteln und Töpfern mit ihren Kindern einluden. Auch ihre nach London emigrierte Schwester Ellen Simon half ihr so gut es ging, indem sie ihr monatlich einen kleinen Geldbetrag zukommen ließ. Daneben bot sie ihr an, nach England zu kommen, was Lola, die an das Gute im Menschen glaubte und die Nationalsozialisten vollkommen unterschätzte, aber ablehnte. Vielleicht fürchtete sie sich auch vor einem Neubeginn in einer für sie unbekannten Umgebung, zumal man ihr im Ausland mit über 40 Jahren nur schwer eine Stelle hätte vermitteln können.
Trotz allem wurde Lola Toepkes finanzielle Situation zunehmend schlechter. Dazu litt sie Anfang der vierziger Jahre auch unter gesundheitlichen Problemen. Sie versuchte, den Kontakt zu alten Bekannten aufrechtzuerhalten, soll sogar noch eine kurze Liebesbeziehung zu einem Mann eingegangen sein. Auch bemühte sie sich, weiterhin am großstädtischen Leben teilzuhaben. So habe sie nach den Erinnerungen einer Zeitzeugin trotz Verbots für Juden weiterhin die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt und dabei ihren Judenstern mit ihrem Mantelkragen verdeckt.
Als im Herbst 1941 die Deportationen aus Hamburg begannen, gehörte Lola Toepke als allein stehende Frau ohne weitere Familie mit zu den ersten, die einen Deportationsbefehl erhielten. Er war verbunden mit der Erklärung, dass man sie zum Arbeitseinsatz in den Osten bringen würde, um dort zu siedeln. Daher sollten Winterbekleidung und ein Spaten mitgebracht werden. Lola Toepke machte sich keine großen Gedanken und glaubte weiterhin an nichts Schlechtes. Und so verabschiedete sie sich von ihren noch verbliebenen Freunden, wobei sie mit einer Bekannten erörtert haben soll, ob es wohl ratsam sei, wegen des herannahenden Weihnachtsfestes auch Tannenbaumschmuck mit einzupacken. Am 6. Dezember 1941 ging vom Bahnhof Sternschanze ein Transport nach Riga mit 753 Menschen ab, unter ihnen auch Lola Toepke. Einige ihrer Bekannten hatten zuvor zwar überlegt, sie zu verstecken, doch hätte das lebhafte Wesen Lolas wahrscheinlich schnell zu ihrer Entdeckung geführt – so deren Befürchtung.
In Riga war am 1. Dezember 1941 ein Ghetto für Juden aus dem Deutschen Reich eingerichtet worden. Viele Insassen fielen den regelmäßigen Mordaktionen zum Opfer oder den harten Lebensbedingungen. Die Überlebenden des Ghettos wurden ab dem Spätsommer 1943 ins KZ Riga überstellt, wo sie Zwangsarbeit leisten mussten. Die weiblichen Häftlinge des KZ Riga wurden bei Herannahen der russischen Armee ab Sommer 1944 ins KZ Stutthof evakuiert. Zu ihnen gehörte auch die mittlerweile 53-jährige Lola Toepke.
Das östlich von Danzig gelegene Lager Stutthof war am 1. September 1939 für „minderschwere Fälle“, d. h. noch „besserungsfähige“ Häftlinge, eröffnet worden. Die ab Ende Juni 1944 aus Riga und Auschwitz kommenden, meist völlig erschöpften Häftlinge wurden überwiegend in der 1943 eingerichteten Gaskammer ermordet oder erschossen. Der am 1. Oktober 1944 in Stutthof eingetroffenen Lola Toepke gelang es, noch bis zum 3. Januar 1945 zu überleben. Man kann sich sicherlich kaum vorstellen, welche Qualen sie in den mehr drei Jahren nach ihrer Deportation aus Hamburg hat erleiden müssen. Bei alldem muss sie einen starken Willen zum Überleben gehabt haben, gemäß dem einzigen Satz, der auf einer von ihr geschriebenen und dann aus dem nach Riga fahrenden Zug geworfenen Postkarte stand: „Der Roman Lola geht weiter!“
Text: Dr. Stephan Heinemann
Zitate, Literaturverzeichnis:
• Maschinengeschriebenes Manuskript von Dr. Ellen Simon zur Biografie ihrer Schwester Lola Toepke [Original im Besitz von Dr. Herbert Gartmann, München].
• Silke Opitz: Leben und Werk des Bildhauers Richard Engelmann, Aufsatz zu finden unter: http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/text/79875/.
• Neunseitiger Artikel über die Bauhaus-Universität Weimar, zu finden unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Bauhaus-Universität_Weimar.
• Fünfseitiger Artikel über Johannes Trüper, zu finden unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Trüper.
• Biografische Angaben zu Franz Termer, zu finden unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Termer.
• Franz Termer: Beobachtungen im Bereich des Staukegels Santiago des Vulkans Santa Maria in Guatemala, in: Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Bd. 91 (1939), S. 766-769.
• Angaben zur Feinkeramik „Tänzerin“ von Lola Toepke im Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof lassen sich über die Internetseite der Museen in Schleswig-Holstein finden (http://www.museen-sh.de).
• Staatsarchiv Hamburg. Hamburger Adressbücher von 1924 bis 1940.
• Interviews mit Frau Mossdorf und Frau v. F. aus Hamburg vom September 2006.
• Bruhns, Maike: Kunst in der Krise. Bd. 1: Hamburger Kunst im „Dritten Reich“, Hamburg/München 2001. Bd. 2: Künstlerlexikon Hamburg 1933-1945. Verfemt, verfolgt - verschollen, vergessen. Hamburg/München 2001, bes. S. 389f.
• Dies.: Jüdische Künstler im Nationalsozialismus, in: Ulrich Bauche (Hrsg.): Vierhundert Jahre Juden in Hamburg. Eine Ausstellung des Museums für Hamburgische Geschichte vom 8.11.1991 bis 29.3. 1992. (= Die Geschichte der Juden in Hamburg 1590-1990. Bd. 1), Hamburg 1991, S. 345-360.
• Buch der Erinnerung. Die ins Baltikum deportierten deutschen, österreichischen und tschechoslowakischen Juden, bearbeitet von Wolfgang Scheffler und Diana Schulle. Hrsg. vom „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.“ und dem „Riga-Komitee der deutschen Städte“ gemeinsam mit der Stiftung „Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum“ und der Gedenkstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“. 2 Bde., München 2003.
• Gedenkbuch Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945, bearbeitet und hrsg. vom Bundesarchiv Koblenz. 2. Wesentlich erweiterte Aufl., Bd. 4, Koblenz 2006, S. 3496.
• Hamburger jüdische Opfer des Nationalsozialismus. Gedenkbuch, bearbeitet von Jürgen Sielemann unter Mitarbeit von Paul Flamme (= Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg, Bd. 15). Hamburg 1995, bes. S. 413.
• Schröder, Claus B.: Wolfgang Borchert. Biografie, Hamburg 1985, bes. S. 45f.
• Weimar, Friederike: Die Hamburgische Sezession 1919-1933. Geschichte und Künstlerlexikon. Fischerhude 2003.
• Wolff-Thomsen, Ulrike: Lexikon schleswig-holsteinischer Künstlerinnen, hrsg. vom Städtischen Museum Flensburg. Heide 1994, bes. S. 320f.
Auf Lola Toepkes Grabstein steht auch der Namen ihrer Verwandten Lena Brückmann, deren Mutter sich vor ihrer Deportation nach Theresienstadt im Juli 1942 selbst tötete.
Anny Tollens
geb. Hock
Kommunalpolitikerin, Leiterin und Geschäftsführerin der Kinderstube Rahlstedt.

Bildquelle: Bürgerverein Rahlstedt e. V.


Bildquelle: Bürgerverein Rahlstedt e. V.

3.12.1911
Hildesheim
–
10.4.1989
Hamburg
Hildesheim
–
10.4.1989
Hamburg
Mehr erfahren
Weddinger Weg 1 (Geschäftsstelle der Rahlstedter Kinderstube)
Namensgeberin für: Anny-Tollens-Weg, seit 2002
Die als Anna Hock in Hildesheim geborene Anny Tollens kam bereits als Kind mit ihren Eltern nach Hamburg. Sie heiratete einen Kaufmann und bekam drei Kinder, die sie großzog.
Bald nach dem Zweiten Weltkrieg begann Anny Tollens, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Sie war Mitglied im Ortsausschuss Rahlstedt und in der Wandsbeker Bezirksversammlung. Politisch war sie in der CDU beheimatet.
1963 wurde sie Mitglied im Bürgerverein Rahlstedt e. V. Im Rahmen ihrer dortigen aktiven Mitgliedschaft als Leiterin des Arbeitskreises Soziales gründete Anny Tollens 1964 den bis heute bestehenden Seniorenkreis „Du und ich“. 1969 hob sie zusammen mit der Vereinigung Jugendheim die Kinderstube Rahlstedt aus der Taufe, deren Leitung und Geschäftsführung sie bis zu ihrem Tod 1989 übernahm. Die Idee zu diesem Halbtagskindergarten für drei- bis sechsjährige Kinder, der Spielstunden und später für fünf- bis sechsjährige Kinder auch eine Vorschule anbot und mit 40 Kindern begann, kam ihr, weil sie feststellte, dass damals viele Mütter einen Kindergartenplatz für ihre Kinder suchten. Die Kinderstube fand ihre Räumlichkeiten im Jugendheim, das im Jugendpark liegt, denn Anny Tollens war aufgefallen, dass Jugendheime vormittags leer standen, denn ihr Betrieb begann schließlich erst in den Nachmittagsstunden.
Für ihr unermüdliches ehrenamtliches Engagement bekam Anny Tollens 1976 das Bundesverdienstkreuz verliehen und 1989 von der Bezirksversammlung Wandsbek die Wandsbeker Medaille. Ebenfalls 1989 erhielt sie die Rahlstedter Silbermünze. Der Portugaleser in Bronze wurde ihr 1988 für ihren großen persönlichen Einsatz bei der Seniorenbetreuung des Bürgervereins Rahlstedt e. V. verliehen.
Anny Tollens starb nach einem Schlaganfall im Alter von 77 Jahren. Dreizehn Jahre später wurde im Stadtteil Rahlstedt der Weg, der direkt an der Park-Kita Altrahlstedt, die aus der von Anny Tollens ins Leben gerufenen Kinderstube des Rahlstedter Bürgervereins hervorging, vorbeiführt in Anny-Tollens-Weg benannt.
Quelle:
Staatsarchiv Hamburg: A 770, Verdienstkreuz für Anna Tollens. Antonie Wilhelmine Traun
(geb. Westphal)
Gründerin des Vereins "Die Sozialen Hilfsgruppen"; Mitbegründerin des "Bundes Hamburgischer Hausfrauen" und des "Stadtbundes Hamburgischer Frauenvereine"




6.12.1850
Hamburg
–
28.10.1924
Hamburg
Hamburg
–
28.10.1924
Hamburg
Mehr erfahren
Antonie Westphal war die älteste Tochter von Carl Wilhelm Ludwig Westphal, Kaufmann und Mitinhaber der Firma G.W.A. Westphal Sohn & Co. und dessen Ehefrau. Die Teefirma besteht noch heute und hat ihren Sitz in der Speicherstadt. Einer ihrer fünf Geschwister war der Senator Otto Westphal (Wirtschaft und Verkehr). Im Alter von 21 Jahren heiratete Antonie Westphal den acht Jahre älteren Kaufmann und Harburger Fabrikanten Otto Traun. Dessen Mutter war Bertha Traun, geb. Meyer. Diese hatte sich für die Selbstständigkeit und Rechte der Frauen stark gemacht, und mit Emilie Wüstenfeld 1850 die Hochschule für das weibliche Geschlecht gegründet. In zweiter Ehe hatte sie 1851 den Prediger der Deutschkatholiken Johannes Ronge geheiratet, der ebenfalls für die Emanzipation der Frau eintrat.
Wie ihre Schwiegermutter wurde auch Antonie Traun eine Anhängerin und Aktivistin der bürgerlichen Frauenbewegung. Als sie mit 48 Jahren Mitglied des "Allgemeinen Deutschen Frauenvereins" wurde, hatte sie in 26 Jahren sechs Kinder geboren, von denen eins im Alter von einem Jahr gestorben war. Und als Antonie Traun 1900 den Verein "Die sozialen Hilfsgruppen" gründete, waren die jüngeren Kinder 19, 17 und 11 Jahre alt. Ihr ältestes Kind war bereits verheiratet und hatte sie schon zur Großmutter gemacht. Die "Sozialen Hilfsgruppen" waren ein Zweigverein des "Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, Ortsgruppe Hamburg". Ihr Ziel war: "Frauen und Mädchen zur tatkräftigen, persönlichen Teilhabe an solchen Unternehmungen heranzuführen, die das Elend der ärmeren Volksklassen zu lindern bestimmt sind." Durch diese gemeinnützige Tätigkeit sollten die weiblichen Vereinsmitglieder auch eine Bereicherung des eigenen Lebens und innere Befriedigung erlangen.
1907, ein Jahr nach dem Tod ihres Ehemannes, wurde Antonie Traun Mitglied des Hauptvorstandes des "Allgemeinen Deutschen Frauenvereins", acht Jahre später,1915, Mitbegründerin des "Bundes Hamburgischer Hausfrauen" und nach einem weiteren Jahr, im Alter von 66 Jahren Mitbegründerin des "Stadtbundes Hamburgischer Frauenvereine". Ziel des Hausfrauenbundes war: die Vertretung der volkswirtschaftlichen Interessen der Hausfrauen als Konsumenten und Produzenten. Der Bund wollte die Arbeit der Hausfrau mit der Tätigkeit in anderen Berufen gleichsetzen.
Dieser Passus wurde jedoch 1918 gestrichen, denn gegen Ende des Ersten Weltkriegs entwickelten sich die Hausfrauenvereine immer mehr zu nationalistischen, konservativen Frauenvereinigungen. Die Ausdehnung des Ersten Weltkrieges machte es für die bürgerlichen Frauenverbände notwendig, ihre losen Verbindungen in eine straffe Zusammenfassung aller Hamburgischer Frauenvereine umzuwandeln. Deshalb wurde der "Stadtbund Hamburgischer Frauenvereine" gegründet, dessen Ziel es war, die gemeinsamen Interessen der angeschlossenen Frauenvereine zu vertreten und zu stärken. Antonie Traun starb acht Jahre, nachdem sie den Stadtbund mitbegründet hatte, im Alter von 73 Jahren.
Dr. Marie Unna
geb. Boehm
Dermatologin


03. 06. 1881
Schewen/Westpreußen (heute Szewa/Polen)
–
23.12.1977
Hamburg
Schewen/Westpreußen (heute Szewa/Polen)
–
23.12.1977
Hamburg
Mehr erfahren
Marie Unna war die Tochter eines Gutsbesitzers in Westpreußen. Nachdem sie einige Zeit Privatunterricht erhalten hatte, besuchte sie zwischen 1894 und 1896 die städtische höhere Töchterschule in Thorn und von 1898 bis 1902 die Gymnasialkurse für Frauen bei der Frauenrechtlerin Helene Lange in Berlin. Im September 1902 machte sie am kgl. Luisengymnasium in Berlin ihr Abitur. Zwischen 1902 und 1906 studierte sie dann Medizin in Freiburg, München und Berlin. 1906 promovierte sie an der Universität in Freiburg i. Br. und erhielt ein Jahr später ihre Approbation. 1910 ließ sie sich als Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten nieder. Sie war in den Jahren 1911, 1912, 1914, 1917, 1919, 1926/27, 1929, 1933, 1935, 1937, 1952 niedergelassene Ärztin in Hamburg mit Praxis in ihrem Privatwohnhaus in der Wentorferstraße 74 in Hamburg Bergedorf, wo sie mit ihrem Mann, dem Dermatologen Karl Unna (1880-1964) und den gemeinsamen drei Kindern lebte. Karl Unna entstammte einer Dermatologenfamilie. Sein Vater, der Dermatologe Paul Gerson Unna, nach dem in Hamburg der Unna-Park und die Unnastraße, an der das Hauptgebäude der Beiersdorf AG steht, benannt wurden, arbeitete eng mit dem Apotheker Paul Carl Beiersdorf zusammen. Zur Unna-Familie gehörte auch die Malerin Julie de Boor. Auch Karl Unna praktizierte eine Zeitlang in eigener Praxis in der Wentorferstraße 47, hatte später aber seine Praxis in der Dammtorstraße 27.
In der Zeit des Nationalsozialismus fiel Karl Unna als "Mischling 1. Grades" unter die NS-Rassegesetze. Einer ihrer Söhne, der Pharmakologe Klaus Robert Walter Unna (geb. 30. Juli 1908 in Hamburg, gestorben am 26.6.1987 in Santa Fe/New Mexico) emigrierte 1933 nach Österreich und 1937 in die USA.
1925 beschrieb Marie Unna eine neue, bis dahin unbekannte Form der Alopezie (des Haarausfalls). Diese seltene Erbkrankheit wird heute auch als "Unna-Syndrom" oder als hereditäre kongenitale Hypotrichose Typ Marie Unna bezeichnet. Diese Erkrankung zeigt sich oft schon nach der Geburt. Manchmal sind die Haare kurz nach der Geburt noch normal oder auch schon sehr dünn, bzw. gar nicht vorhanden. Waren Haare bei der Geburt vorhanden, werden sie in den ersten Lebensjahren schütter und spärlich, später dann grob und unregelmäßig gedreht. Kam das Kind ohne Haare auf die Welt, so wachsen zwar die Haare, sind dann aber auch grob, von drahtiger Struktur und schwer zu kämmen. Der Haarausfall beginnt dann in der Pubertät. Als Therapie gibt es nur die Möglichkeit einer Haartransplantation oder das Tragen einer Perücke.
Marie Unna war Gründungsmitglied des 1924 gegründeten Bundes Deutscher Ärztinnen (BDÄ). Über dessen Gründungsversammlung schrieb sie in der Vierteljahresschrift Deutscher Ärztinnen einen Bericht. Unter der Leitung von Marie Unna wurde 1925 auf der Tagung des Gesamtvorstandes des BDÄ ein Entwurf zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten diskutiert. Marie Unna gehörte dem Ausschuss zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten des BDÄ an, aus dem sie 1927 austrat. Außerdem war sie Mitglied des Hartmannbundes, aus dem sie 1953 ausschied.
Marie Unna war auch Schriftleiterin der von ihrem Schwiegervater Paul Gerson Unna geführten "Dermatologischen Wochenschrift".
Anna Wilhelmine Catharina Veldkamp
"Mutter Veldkamp", Besitzerin eines Dom-Cafés



5.7.1865
Hamburg
–
13.12.1944
Hamburg
Hamburg
–
13.12.1944
Hamburg
Mehr erfahren
„Mutter Veldkamp“ wie es auf ihrem Grabstein steht, besaß das über Hamburgs Grenzen bekannte Dom Café Veldkamp auf dem Hamburger Winterdom.
Schon ihre aus Groningen stammende Großmutter kam aus dieser Branche. Sie hatte 1821 in Groningen einen Zuckerwarenhandel gegründet und später, als sie nach Hamburg gezogen war, am Gänsemarkt ein Café eröffnet. Dieses vermachte sie ihrer Tochter, die später auf dem Hamburger Dom (Freimarkt, Kirmes) ein Dom-Café errichtete, welches diese dann ihrer Tochter Anna Wilhelmine vererbte.
Unter der erfolgreichen Leitung von Anna Wilhelmine, die 1900 den bei ihr angestellten Konditor geheiratet hatte, mit dem sie drei Söhne bekam (1901: August; 1903: Jan; 1904: Willi), wurde das kleine Dom-Café zu einem über 1200 Sitzplätze fassenden Kaffeehaus vergrößert.
Während eine Musikkapelle spielte und 42 Kellnerinnen und Kellner die Kuchen- und Kaffeewünsche der Gäste befriedigten, saß Mutter Veldkamp wie eine Matrone hinter der Kasse und kontrollierte den reibungslosen Ablauf der Bedienung. Auf ihrem Kopf trug sie eine, von ihrer Großmutter geerbte, golddurchwirkte holländische Haube, zu der ein Brüsseler Spitzentuch gehörte, dessen Ränder mit Brillanten besetzt waren. In dieser Aufmachung fiel Mutter Veldkamp allen Gästen sofort ins Auge.
Die Haube wurde Mutter Veldkamps Markenzeichen. Ihr, aus vielen tausend blinkenden Glühbirnen arrangiertes Portrait mit Haube prangte als Reklame für ihr Café in luftiger Höhe auf einem Turm, der an der Außenwand des Cafés errichtet worden war. Und auch auf ihrem Grabstein ist ihr Portrait mit Haube geschaffen worden.
[Bild:3143_Cafe_Veldkamp|right]Während des Winterdoms gehörte das Café für einen Tag den Hamburger Waisenkindern. Dann war das Café für die übrigen Dombesucherinnen und –besucher geschlossen und Mutter Veldkamp ließ die Waisenkinder mit Kakao und Schmalzgebäck bewirten und gab ihnen kleine Geldgeschenke. Wegen dieser Wohltätigen wurde Anna Wilhelmine Catharina Veldkamp „Mutter Veldkamp“ genannt.
Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde wegen der Luftangriffe kein Dom mehr veranstaltet. So ließ Mutter Veldkamp 1940 ihr in Einzelteile zusammengelegtes Café in Lagerhallen unterbringen. In der Julinacht vom 24. auf den 25. Juli 1943 wurden die Lagerhallen und die Privatwohnung der Veldkamps durch Bomben zerstört. Mutter Veldkamp zog mit ihrem Mann zu ihrem Sohn Jan, der in der Annenstraße 32, 1, Stock allein lebte. Seine Frau Emmi Veldkamp geb. Schill (3.1.1907 - 14.12.1944) war wegen „Hehlerei mit 1000 Lebensmittelkarten“ verhaftet und zum Tode verurteilt worden. Mutter Veldkamp, die schon seit längerer Zeit herzkrank war, starb am Abend vor der Hinrichtung ihrer Schwiegertochter, deren Todesurteil am Morgen des 14.12.1944 im Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis vollstreckt wurde. Vater und Sohn erreichten, dass die Leiche der Hingerichteten freigegeben wurde, so dass beide Frauen am 20.12.1944 auf dem Ohlsdorfer Friedhof bestattet werden konnten. Hamburgs Waisenkinder geleiteten mit brennenden Kerzen in den Händen den Sarg zur Grabstätte. Drei Jahre später wurde der Grabstein am Grab aufgestellt..
Text: Dr. Rita Bake
Anne-Marie Vogler
Bildhauerin und Grafikerin





7.6.1892
Altona
–
30.5.1983
Hamburg
Altona
–
30.5.1983
Hamburg
Mehr erfahren
Anne-Marie Vogler stammte aus einer großbürgerlichen Familie. Ihre Mutter war Clara Mathilde Vogler, geb. Leopold, ihr Vater der Exportkaufmann Friedrich Vogler. Mit ihren vier Brüdern wuchs Anne-Marie in Altona an der Elbchaussee auf. Sie segelte und ruderte mit den Brüdern auf der Elbe und lernte durch den ständigen Umgang mit ihnen Manches, worum Freundinnen sie bewunderten oder beneideten. Nach dem Besuch einer Höheren Mädchenschule verbrachte sie ein Jahr in London bei ihrem Onkel, um Hauswirtschaft und Englisch zu lernen. Sie bekam Klavier- und Gesangsunterricht, und erwog, Musikerin zu werden. Mit ihrem Bruder Kurt, der Geige spielte, arbeitete sie an einer gemeinsamen musikalischen Laufbahn. Nachdem ihr Bruder Karl 1916 als Soldat getötet worden war, spielte sie jedoch nie wieder mehr Klavier und wandte sich der bildenden Kunst zu.
Von 1916 bis 1918 besuchte sie die graphische Klasse des Graphikers und Bildhauers Carl Otto Czeschka an der Kunstgewerbeschule. Sie begann in Elfenbein zu arbeiten und schnitt Tiere, Becher, Schalen, Griffe, etc. aus diesem Material. Später arbeitete sie mit Holz und nahm von 1922 bis 1925 Unterricht bei dem Holzbildhauer August Henneberger an der Handwerker- und Kunstgewerbeschule in Altona. Dann ging sie nach München an die Akademie der bildenden Künste und beschäftigte sich auch mit Christlicher Kunst. 1929 zog sie nach Berlin, arbeitete dort in einem eigenen Atelier und kehrte 1931 nach Hamburg zurück, wo sie sich ein Atelier im Mittelweg einrichtete. Sie versammelte einen Kreis geistig interessierter Menschen um sich, zu dem auch die Malerinnen Anita Rée und Gretchen Wohlwill gehörten.
In der Zeit des Nationalsozialismus gehörte sie zu der Gruppe von Gegnern und Gegnerinnen des NS-Regimes um den Buchhändler Felix Jud, die sich in seiner Buchhandlung in den Collonaden traf.
Anne-Marie Vogler blieb unverheiratet.
Die ersten Aufträge, die sie erhielt, waren Türreliefs für eine Fliegerschule, Intarsien für die spanische Botschaft in Berlin, Kaminplatten und Brunnenwände für Privathäuser bzw. -gärten, Grabmale, vor allem aber Plaketten und Portraitbüsten.
1947 erhielt sie den ersten größeren Auftrag, der in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregte. Sie sollte die sechs Glocken des Limburger Doms, die im Zweiten Welt-krieg eingeschmolzen worden waren und nun nachgegossen wurden, mit Schrift und Bildschmuck versehen. Anne-Marie Vogler arbeitete in einer überlieferten, doch seit Jahrhunderten nicht mehr angewendeten Technik, indem sie vor dem Guss Figuren, Ornamente und Schrift von innen in den Ton ritzte, was bedeutete, dass sie in das Innere der Glocke kriechen und seitenverkehrt arbeiten musste.
1959 schuf sie ihre erste lebensgroße Vollplastik "Mutter und Kind" für einen Schulhof in Dockenhuden. Ein weiteres Werk ist z. B. der Marmortrinkbrunnen im Hauptbahnhof-Süd. Die meisten ihrer großen, als "Kunst am Bau" entstandenen Arbeiten führte sie nicht selbst aus. Sie lieferte die Entwürfe und ließ sie unter ihrer Anleitung und Korrektur vom Steinmetz verwirklichen.
1978 hatte die damals 85-Jährige im Kunstverein ihre erste Einzelausstellung in Hamburg. Besondere Aufmerksamkeit erregte eine Gruppe von Fußballspielern, die um 1970 entstanden war und die der Freund und Kollege Karl August Ohrt als Thema aufgriff, als er für die im Alter von 91 Jahren Verstorbene eine Grabplatte aus schwarzem Granit schuf. Was sie an den Sportlern faszinierte, waren ihre Bewegungen und die Aufgabe, sie in eine künstlerische Form zu bringen.
Wesentliches aus Brita Reimers Portrait über Anne-Marie Vogler, in: Rita Bake, Brita Reimers: Stadt der toten Frauen. Hamburg 1997.
Edith Weiss-Mann
(geb. Weiss)
Cembalistin, Klavierpädagogin, Musikkritikerin



11.5.1885
Hamburg
–
18.5.1951
Westfield/New Jersey, USA
Hamburg
–
18.5.1951
Westfield/New Jersey, USA
Mehr erfahren
Die in Hamburg geborene Edith Weiss-Mann war eine in ihrer Heimatstadt sehr angesehene Künstlerin, die das Hamburger Musikleben in den zwanziger und dreißiger Jahren außerordentlich stark beeinflusst und gefördert hat. „MANN WEISS – EDITH WEISS MANN“ 1), warb damals ein Plakat.
Ihre Ausbildung zur Pianistin hatte die Tochter des Kaufmanns Emil Weiss und seiner Ehefrau Hermine, geb. Rosenbaum von 1900 bis 1904 in Berlin an der Hochschule für Musik und danach bei verschiedenen Privatlehrern erhalten: von 1904 bis 1908 bei James Kwast, danach bei José Vianna da Motta, Carl Friedberg und Bruno Eisner.
Nach dem Examen ging sie nach Hamburg zurück und entfaltete eine umfangreiche musikalische Tätigkeit. Sie gab privaten Klavierunterricht, veranstaltete als Mitglied im Musikausschuss der „Gesellschaft der Freunde des Vaterländischen Schul- und Erziehungswesens“ zusammen mit anderen Künstlern in Schulen „Musikvorträge für die Jugend“ und bildete, da es in Hamburg noch keine Musikhochschule gab, in Seminaren an der Universität Musiklehrer aus, wobei sie von 1929 bis 1933 die Klavierklasse leitete. 1923 wirkte sie beim Aufbau der Volksmusikschule mit und gab fortgeschrittenen Schülern Klavierunterricht.
Aber nicht nur auf pädagogischem Gebiet zeigte Edith Weiss-Mann sich mit ihren zum Teil neuen und ungewöhnlichen Aktivitäten und reformpädagogischen Ideen als Wegbereiterin, sondern auch auf künstlerischem: Sie wurde eine der ersten Cembalistinnen und brachte das Cembalo als Konzertinstrument wieder zur Geltung.
Ihr Interesse an diesem Instrument hatte das Konzert der polnischen Pianistin Wanda Landowska im Museum für Hamburgische Geschichte erweckt. Auch Edith Weiss-Mann bekam die Erlaubnis, dort zu üben und zu konzertieren. Die 1925 von ihr gegründete „Vereinigung zur Pflege alter Musik in Hamburg“ veranstaltete ihre ersten Konzerte in den Räumen des Museums für Hamburgische Geschichte. Sie wurden aufgrund der großen Resonanz aber bald in den kleinen Saal der Musikhalle verlegt. Ab 1927 hatte Edith Weiss-Mann ihr eigenes Cembalo, einen Nachbau des Instrumentes aus der Berliner Musikinstrumentensammlung, das als „Bach-Cembalo“ galt.
Neben ihrem Engagement für die barocke Aufführungspraxis, die heute wieder große Bedeutung hat, setzte Edith-Weiss-Mann sich auch für zeitgenössische Musik ein, zum einen durch Aufführungen von Werken, zu denen sie möglichst die Komponisten zur Mitwirkung heranzog, zum anderen durch ihre Tätigkeit als Musikkritikerin. Sie schrieb für zahlreiche Zeitungen wie für das „Hamburger Fremdenblatt“, die „Deutsche Allgemeine Zeitung“, die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, für die Schweizer Fachpresse und den „Musical Courier“ in New York.
In ihrer großen Wohnung in der Alten Rabenstraße 34 veranstaltete Edith Weiss-Mann häufig Hauskonzerte, zu denen sie die nötigen Instrumentalisten hinzuzog. Oft wirkte auch ihr Sohn Alfred mit, der aus ihrer Ehe mit dem Kunstmaler Wilhelm Mann (1882-1957) stammte und 1917 geboren war. Er hatte ihre musikalische Begabung geerbt, spielte bereits vor dem Abitur alle Streichinstrumente und Blockflöte, komponierte und betätigte sich schreibend auf musikwissenschaftlichem Gebiet. Er ist heute Professor in den USA.
1935 richtete Edith Weiss-Mann eine regelmäßige häusliche Veranstaltung ein, die so genannte Sonntagsstunde, zu der sich Schüler, deren Eltern und Freunde einfanden. Eine ehemalige Schülerin, Irmgard Schumann-Reye, berichtet von diesen Stunden: „Ein bestimmtes Thema wurde aufgestellt, z.B. ‚Händel’. Dazu legte sie Abbildungen des Komponisten und seiner Wirkungsstätte auf dem Flügel aus, las aus entsprechender Literatur vor und brachte Musikbeispiele zu Gehör, bei denen sie selber spielte und je nach Bedarf Streich-, Blas- oder Gesangssolisten eingeladen hatte, die mitwirkten“ 2). Diese Sonntagsstunden fanden auch dann noch statt, als Edith Weiss-Mann 1937 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft gezwungen wurde, in eine sehr viel kleinere Wohnung in der Johnsallee 2 zu ziehen. Als Lehrkraft war sie bereits 1933 entlassen worden, und öffentlich auftreten durfte sie seitdem nur noch im Jüdischen Kulturbund, einer Einrichtung, die mit dem Ziel, den zahlreichen entlassenen jüdischen Künstlern Beschäftigungsmöglichkeiten zu eröffnen, zuerst 1933 in Berlin mit staatlicher Genehmigung gegründet worden war. Der jüdische Kulturbund Hamburg entstand 1934. Er war die einzige noch erlaubte Wirkungsstätte für jüdische Künstler. Auch als Publikum waren nur Juden zugelassen.
Freunde und Kollegen wie Wilhelm Furtwängler, Armin Knab von der Akademie für Kirchenmusik in Berlin und Professor Stein von der Hochschule für Musik in Berlin taten alles, um Edith Weiss-Mann zu schützen und zu unterstützen. Um ihre materielle Lage zu verbessern, ließ der Freund und Theaterkritiker Hans Sommerhäuser Wilhelm Furtwängler und Armin Knab Artikel für den „Hamburger Anzeiger“ schreiben. Das fürstliche Honorar wurde Edith Weiss-Mann überwiesen. Furtwängler verschaffte ihr trotz des Auftrittverbots sogar noch einmal die Gelegenheit, öffentlich zu spielen. Hans Sommerhäuser berichtet: „Furtwängler bestellte sie in jener Zeit einmal auf den Hauptbahnhof in Hamburg, wo man unbeobachteter miteinander verhandeln konnte als in offiziellen Diensträumen oder Kulturinstitutionen, und bat sie um ihr ‚großartiges Cembalo’. Edith sagte zu, wie früher oft. Als Edith von den Besuchern des Konzertes sprach und auf die Gefährlichkeit der Situation hinwies, antwortete Furtwängler: ‚Aber, gnädige Frau, selbstverständlich sitzen Sie am Cembalo!’ Das war tapfer von Furtwängler. Edith Weiss-Mann war überglücklich, denn sonst durfte sie nicht mehr spielen“ 3).
Am 7.1.1939 heiratete Edith Weiss-Mann Jens Grau, der ebenfalls wie sie jüdischer Herkunft war. Diesen wesentlich jüngeren Mann soll sie nur deshalb geheiratet haben, um über Dänemark, wo der Däne Jens Grau lebte, in die USA emigrieren zu können. Gut zwei Wochen nach der Heirat emigrierte Edith Weiss-Mann am 23. März 1939 per Schiff mit ihrem Cembalo in die USA, wo ihr Sohn 1939 bis 1942 in Philadelphia Musik studierte. Die Schiffsreise führte über Englang, wo sich Edith Weiss-Mann von Jens scheiden ließ. An den USA angekommen zog sie jedoch nicht zu ihrem Sohn, sondern nach New York. Mit fast 54 Jahren musste sie noch einmal ganz von vorne anfangen. An ihre Schülerin Irmgard Schumann-Reye schreibt sie am 6. November 1939: „Tröstet es Sie, wenn ich Ihnen sage, dass ich ähnlich wie Sie völlig ungewohnte schwere Arbeit tue, immer noch mit der Angst dabei, in Form zu bleiben für die Musik und für die unvorstellbaren Ansprüche an äußerer Bereitschaft überhaupt. Die sind hier märchenhaft … Ich renne umher, unvorstellbar, um etwas bekannt zu werden“ 2). Mit zäher Energie und eisernem Willen schaffte es Edith Weiss-Mann, sich eine neue Karriere aufzubauen. Sie spielte bald in Konzertsälen und im Rundfunk, auch zusammen mit ihrem Sohn. Ihr wohl größter Anfangserfolg aber war im Herbst 1940 die Einspielung sämtlicher Cembalokonzerte Bachs und der Werke der norddeutschen Barockmeister unter Otto Klemperer. Weitere Schallplattenaufnahmen sollten folgen.
Trotz eines schweren Krebsleidens in den letzten fünf Jahren ihres Lebens arbeitete Edith Weiss-Mann unermüdlich weiter. Sie bestand darauf, alleine zu wohnen und zu unterrichten, als sie es schon längst nicht mehr konnte. Erst als sie 1951 in ihrer Wohnung bewusstlos wurde, willigte sie ein, in das Haus ihres Sohnes und seiner Familie zu ziehen, wo sie kurz nach ihrem 66. Geburtstag, am 18. Mai 1951, starb. Ihre Asche wurde nach Hamburg überführt und auf der Grabstelle ihrer Schwiegereltern beigesetzt. In dem Glauben, mit der schweren Magenoperation im Jahre 1946 den Krebs überwunden zu haben, hatte sie an ihre Schülerin geschrieben: „Aber dem Leben und der Musik wiedergegeben zu sein ist herrlich“ 2).
Text: Brita Reimers
Zitate:
[1] Diesen Hinweis verdanke ich einer Schülerin von Edith Weiss-Mann , der Komponistin Felicitas Kuckuck..
[2] Irmgard Schumann-Reye: Edith Weiss-Mann (1885-1951). In: Hamb. Geschichts- und Heimatblätter. Bd. XI. 8. Dezember 1985.
[3] Erich Lüth: Hamburger Theater 1933-1945. Ein Theatergeschichtlicher Versuch. Hrsg. von der Theatersammlung der Hamburgischen Universität. Hamburg 1962.
Bertha Wendt
geb. Bahnson
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (DDP), organisiert in der bürgerlichen Frauenbewegung



6.10.1859
Hamburg
–
14.3.1937
Hamburg
Hamburg
–
14.3.1937
Hamburg
Mehr erfahren
Geboren wurde Bertha Bahnson als erstes von acht Kindern von Rosalie Bahnson, geb. Philipp und deren Mann, dem Gymnasiallehrer Prof. Dr. Franz Wilhelm Bahnson. Rosalie Bahnson war jüdischer Herkunft und ließ sich vor ihrer Hochzeit evangelisch taufen. Bertha Bahnson besuchte die Höhere Töchterschule und die Klosterschule St. Johannis. 1878, im Alter von knapp 19 Jahren, heiratete sie den Lehrer und späteren Reichstagsabgeordneten Prof. Dr. Gustav Wendt (1848-1933), der 1901 Leiter, der vom Verein Frauenbildung und Frauenstudium gegründeten Real- und später Gymnasial-Kurse für Mädchen wurde. Bertha Wendt bekam mit ihrem Mann acht Kinder.
Außerdem nahm sie nach dem frühen Tod ihrer Mutter (gest. 1884) ihre beiden jüngeren Brüder Fritz (acht Jahre) und Rudolph (drei Jahre) auf. Kinderschutz, hauswirtschaftliche Ausbildung für Mädchen und die Abstinenzbewegung, das waren Bertha Wendts Themen, denen sie ihre Kraft widmete. Bertha Wendt war führend in der bürgerlichen Frauenbewegung, und schon Jahre bevor die Frauen das Wahlrecht erlangten, begann sie sich politisch zu betätigen. So wurde sie 1911 in den Vorstand der Vereinigten Liberalen gewählt. Bertha Wendt trat z. B. für die Abschaffung des Lehrerinnenzölibats ein, denn sie war der Auffassung, dass alle Frauen das Recht auf einen Beruf haben sollten. Im Ersten Weltkrieg wandte sie sich anderen Aufgaben zu. Sie organisierte Kriegsküchen und leistete Aufklärung über praktische Ernährung. Außerdem stellte sie Unterkünfte für heimkehrende Soldaten und alleinstehende Frauen bereit. Nach dem Krieg und nachdem 1918 die Frauen das Wahlrecht erlangt hatten, begann Bertha Wendt mit der politischen Frauenbildungsarbeit. Als Führerin der demokratischen Frauen richtete sie für Frauen Notkurse in politischer Bildung ein und leitete solche Kurse selbst noch im Alter von 70 Jahren. Von 1919 bis 1924 war sie für die Deutsche Demokratische Partei Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. In dieser Zeit als Abgeordnete beschäftigte sie sich besonders mit Frauen- und Kinderfragen. Außerdem war sie Vorsitzende der demokratischen Frauengruppe Hamburg. Außerhalb der Parteipolitik engagierte sie sich in der Ortsgruppe Hamburg des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins auf dem Gebiet des Jugendschutzes. Hier kümmerte sie sich insbesondere um die Unterbringung und weitere Betreuung schulentlassener Mädchen und um die Überwachung des Koststellennachweises für uneheliche Kinder. Außerdem richtete sie Heimstuben für weibliches Hauspersonal ein, übernahm Vormundschaften, arbeitete im Verein gegen Ausnutzung und Misshandlung von Kindern und in der Bewegung für Mütterabende, war als Waisenpflegerin und in der Ferienkolonie Waltershof tätig. Sie war Mitglied im Frauenklub Hamburg, im Deutschen Bund Abstinenter Frauen, im Verband Norddeutscher Frauenvereine und im Hamburger Zweig des Deutschen Verbandes für Frauenstimmrecht. Zu ihrem 70. Geburtstag organisierte der Stadtbund hamburgischer Frauenvereine für sie eine Teestunde, an der rund 100 Frauen teilnahmen. Emma Ender, die diesen Nachmittag vorbereitet hatte, Klara Fricke, als Vorsitzende der Ortsgruppe Hamburg des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins und Helene Bonfort hielten kleine Reden. Für ihre karitativen Arbeiten erhielt Bertha Wendt das Verdienstkreuz. 1933, nach dem Tod ihres Mannes, zog sich Bertha Wendt aus der Öffentlichkeit zurück und starb am 14.3.1937 in ihrer Wohnung in der Oderfelderstraße 11.
Paula Westendorf
geb. Gühlk
Politikerin, Bürgerschaftsabgeordnete



26.10.1893
Hamburg
–
3.10.1980
Hamburg
Hamburg
–
3.10.1980
Hamburg
Mehr erfahren
1917, im Alter von 25 Jahren, heiratete Paula Westendorf und bekam vier Söhne (geb. 1918, 1922, 1923, 1925). Später ließ sie sich scheiden und wurde 1949 wieder berufstätig.
Das SPD-Mitglied wurde im Oktober 1946 in die erste frei gewählte Bürgerschaft nach dem Ende des Nationalsozialismus gewählt. Der Bürgerschaft gehörte sie bis 1953 an.
Als Mitglied der Bürgerschaft brachte Paula Westendorf 1947 einen ergänzenden SPD-Antrag zum KPD-Antrag von Magda Langhans (siehe zu ihr in der Rubrik: Erinnerungsskulptur) zur Einstellung der Strafverfahren bei Verstoß gegen den Paragraphen 218 ein. Sie forderte die Einrichtung öffentlicher Ehe- und Sexualberatungsstellen und setzte sich für die soziale Indikation ein. In diesen Beratungsstellen wollte sie das Thema des Schwangerschaftsabbruchs nicht biologisch behandelt wissen, sondern im Zusammenhang mit der „Menschheitsfrage", aus Ehrfurcht vor dem Leben im Sinne Albert Schweitzers und im Gegensatz zu den „menschheitszerstörenden Praktiken der Nazis". Als einseitigen Machtausdruck des Staates lehnte sie Strafverfolgung wegen Abtreibung ab und gab grundsätzlich zu bedenken, dass Verbote die Menschheit nicht erzögen, weil Moral nicht befohlen werden könne.
Paula Westendorf versicherte dem Parlament, dass die Beratungsstellen nicht leichtfertig Schwangerschaftsabbrüche anempfehlen, sondern das Verantwortungsbewusstsein dem Leben gegenüber stärken würden. Trotz lebhaften Beifalls war die Reaktion der Männer im Parlament hinhaltend. Der Gesundheitsausschuss verwarf aus juristischen Gründen den Antrag der KPD. Erfolg hatte nur Paula Westendorfs ergänzender Antrag. Und so wurden in den Räumen des Gesundheitsamtes eine öffentliche Ehe- und Sexualberatungsstelle eingerichtet, die als erste ihrer Art in den Westzonen im August 1948 ihre Arbeit aufnahm.1)
Auch Paula Westendorfs Einsatz zur Freigabe des Vertriebes von Verhütungsmitteln hatte Erfolg. Am 1. Juni 1948 gab der Senat bekannt, dass die Polizeiverordnung des früheren Reichsinnenministers vom Juni 1941 über „Verfahren, Mittel und Gegenstände zum Schwangerschaftsabbruch" aufgehoben sei.2)
1947 wurde Paula Westendorf Beisitzerin des Verwaltungsgerichtes. Sie war Deputierte der Kulturbehörde (1947, 1953) und der Baubehörde (1948) und außerdem stellvertretendes Mitglied des beratenden Ausschusses für das Pressewesen (1949).
2007 wurde im Stadtteil Ohlsdorf den Paulen-Westendorf-Weg eingeweiht.
Text: Rita Bake
Quelle:
[1] Vgl.: Inge Grolle, Rita Bake: „Ich habe Jonglierebn mit drei Bällen geübt,“ Frauen in der Hamburgischen Bürgerschaft 1946 bis 1993. Hamburg 1995, S. 67f.
[2] Vgl.: Inge Grolle, Rita Bake, a. a. O., S. 68.
Die politische Karriere der geschiedenen Frau mit vier Kindern begann gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Bereits in der ersten Wahlperiode im November 1946 wurde Paula Westendorf für die SPD als Abgeordnete in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt, der sie bis 1953 angehörte.
Paula Westendorf setzte sich besonders für die Straffreiheit bei Abtreibung und für die soziale Indikation ein und forderte in diesem Zusammenhang die Einrichtung öffentlicher Ehe- und Sexualberatungsstellen. Als einseitigen Machtausdruck des Staates lehnte sie Strafverfolgung wegen Abtreibung ab und gab zu bedenken, dass Verbote die Menschheit nicht erzögen, weil Moral nicht befohlen werden könne.
Auf ihre Initiative hin wurde dann in den Räumen des Gesundheitsamtes eine öffentliche Ehe- und Sexualberatungsstelle eingerichtet, die als erste ihrer Art in den Westzonen im August 1948 eröffnet wurde.
Auch ihr Einsatz zur Freigabe des Vertriebes von Verhütungsmitteln hatte Erfolg. Am 1. Juni 1948 gab der Senat bekannt, dass die Polizeiverordnung des früheren Reichsinnenministers vom Juni 1941 über "Verfahren, Mittel und Gegenstände zum Schwangerschaftsabbruch" - worunter auch Verhütungsmittel fielen - aufgehoben sei.
Adele Will
geb. Hessberger
Kindergärtnerin mit Privat-Kindergarten in Hamburg-Eppendorf



25.2.1903
in Antwerpen
–
28.5.1997
in Hamburg
in Antwerpen
–
28.5.1997
in Hamburg
Mehr erfahren
Adele wurde als einziges Kind der Gouvernante Maria Klü und des Seemanns Johann Hessberger in Antwerpen geboren. Im selben Jahr zog die Familie nach Hamburg-Eimsbüttel. Im Seminar der Vereinigten Fröbelkindergärten erfolgte von 1918 bis 1919 die Ausbildung zur Kindergärtnerin. In den Jahren danach arbeitete Adele Hessberger als "Kinderfräulein" in Familien und als Kindergärtnerin in verschiedenen staatlichen Einrichtungen - unter anderem in der Nähe der Reeper-bahn, wo sie sich Plattdeutsch aneignete, um die Kinder der Hafenarbeiterfamilien verstehen zu können. Zur beruflichen Selbstständigkeit entschied sie sich vor dem Hintergrund der Fröbel-Pädagogik: "Ich wollte keinen Massenbetrieb, sondern pädagogische Betreuung für jedes einzelne Kind."
Am 1.10.1925 gründete sie einen Privatkindergarten in Hamburg-Eppendorf: zunächst im Billiardraum der Conditorei C. W. Nobiling, Eppendorfer Landstraße, 1927 in ihrer Privatwohnung Erikastr. 143, bald darauf Im Winkel 21. Es war der vierte Privatkindergarten in Hamburg.
Am 17. Mai 1928 heiratete sie Max Will. Ihr Mann, ein gelernter Kaufmann, arbeitete als Buchhalter, später als Prokurist. Sobald er frühmorgens zur Arbeit ging, wurde die Wohnung mit routinierten Handgriffen kindgerecht verwandelt, sodass sich 15 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren wohlfühlen und verschiedene altersgemäße Spiel- und Lerngruppen stattfinden konnten. Mittags wurde aus dem Kinderparadies wieder eine Familienwohnung für Max und Adele Will, ab 1931 mit Tochter Eva-Maria. Der "fröhliche singende Kindergarten" wurde über sechs Jahrzehnte zu einer Institution in Eppendorf: jeden Vormittag zog Adele Will in Begleitung der angestellten Kinderpflegerin mit der Kindergartengruppe singend durch das Viertel an die Alster zu den Spielwiesen oder an den Mühlenteich, wo sich ein Spielplatz befand, der auf Adele Wills Initiative hin eingerichtet worden war. Viele Jahre organisierte sie Sommerferien an der Nordsee für ihre Kinder. Zuhause ging es regelmäßig ins Schwimmbad. Der jahreszeitliche Rhythmus prägte das Kindergartenjahr mit Frühlingsfest, Osterfeuer, Apfelernte, Nikolaus und Weihnachten ebenso, wie mit dem Puppenfest, Kasperltheater, Hafenausflug, Geburtstagsritual oder Abschiedsfest zum Schulbeginn für jedes Kind. Mit Unterstützung der dafür von Adele Will entwickelten Vorschulmappe, wurden die Kinder auf die Einschulung vorbereitet. 1970 entwarf sie ein "Uhren-Lotto", das der Ravensburger Verlag jahrelang verlegte, mit dem auch lernbehinderte Kinder spielerisch die Uhr kennenlernen konnten.
Durch die Gleichschaltung der Kindergärten während der nationalsozialistischen Diktatur 1933 bis 1945 wurde der Erhalt des Privatkindergartens zu einer besonders schwierigen und oft nur mit Verhandlungsgeschick zu lösenden Aufgabe: jede privatpädagogische Initiative war dem Reichsjugendamt verdächtig, besonders auch das Feiern von Ostern und Weihnachten. Während der Kriegsjahre wurde der Kindergarten so lange wie möglich offengehalten, bis der Beginn des Bombardements Hamburgs die Schließung nötig machte. Auf Initiative eines Arztes betreute Adele Will in dieser Zeit Kinder von Bombenopfern in der Lüneburger Heide und dem Kleinwalsertal.
Den Eltern der Kinder und auch "Ehemaligen" stand Adele Will immer mit Rat und Tat in schwierigen Erziehungs- und Familiensituationen zur Seite. Viele hielten über Jahrzehnte den Kontakt, manche waren inzwischen selber (Groß-)Eltern und brachten ihre Kinder zu "Tante Will" in den "Winkel 21".
1986 - bald nach dem sechzigjährigen Jubiläum und kurz vor Eintritt in den Ruhestand - bekam sie das Bundesverdienstkreuz am Bande "für ihr beispielhaftes Engagement bei der Betreuung von Kindern" verliehen. Sie nahm den Orden nur entgegen: "stellvertretend für meine Kolleginnen der anderen privaten Kindergärten Hamburgs". Einige Jahre war sie deren Sprecherin im "Verein der privaten Kindergärten von Hamburg und Umgebung" gewesen. 1990 wurde ihr der Portugaleser Taler in Bronze "BÜRGER DANKEN" durch den "Zentralausschuss Hamburgischer Bürgervereine v. 1886" überreicht.
Ehrenamtlich engagierte sich Adele Will in der Ökumene ihrer Kirchengemeinde St. Antonius sowie im Seniorenheim Anscharhöhe in Eppendorf, wo sie auch ihren Lebensabend verbrachte.
Am 1.10.1925 gründete sie einen Privatkindergarten in Hamburg-Eppendorf: zunächst im Billiardraum der Conditorei C. W. Nobiling, Eppendorfer Landstraße, 1927 in ihrer Privatwohnung Erikastr. 143, bald darauf Im Winkel 21. Es war der vierte Privatkindergarten in Hamburg.
Am 17. Mai 1928 heiratete sie Max Will. Ihr Mann, ein gelernter Kaufmann, arbeitete als Buchhalter, später als Prokurist. Sobald er frühmorgens zur Arbeit ging, wurde die Wohnung mit routinierten Handgriffen kindgerecht verwandelt, sodass sich 15 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren wohlfühlen und verschiedene altersgemäße Spiel- und Lerngruppen stattfinden konnten. Mittags wurde aus dem Kinderparadies wieder eine Familienwohnung für Max und Adele Will, ab 1931 mit Tochter Eva-Maria. Der "fröhliche singende Kindergarten" wurde über sechs Jahrzehnte zu einer Institution in Eppendorf: jeden Vormittag zog Adele Will in Begleitung der angestellten Kinderpflegerin mit der Kindergartengruppe singend durch das Viertel an die Alster zu den Spielwiesen oder an den Mühlenteich, wo sich ein Spielplatz befand, der auf Adele Wills Initiative hin eingerichtet worden war. Viele Jahre organisierte sie Sommerferien an der Nordsee für ihre Kinder. Zuhause ging es regelmäßig ins Schwimmbad. Der jahreszeitliche Rhythmus prägte das Kindergartenjahr mit Frühlingsfest, Osterfeuer, Apfelernte, Nikolaus und Weihnachten ebenso, wie mit dem Puppenfest, Kasperltheater, Hafenausflug, Geburtstagsritual oder Abschiedsfest zum Schulbeginn für jedes Kind. Mit Unterstützung der dafür von Adele Will entwickelten Vorschulmappe, wurden die Kinder auf die Einschulung vorbereitet. 1970 entwarf sie ein "Uhren-Lotto", das der Ravensburger Verlag jahrelang verlegte, mit dem auch lernbehinderte Kinder spielerisch die Uhr kennenlernen konnten.
Durch die Gleichschaltung der Kindergärten während der nationalsozialistischen Diktatur 1933 bis 1945 wurde der Erhalt des Privatkindergartens zu einer besonders schwierigen und oft nur mit Verhandlungsgeschick zu lösenden Aufgabe: jede privatpädagogische Initiative war dem Reichsjugendamt verdächtig, besonders auch das Feiern von Ostern und Weihnachten. Während der Kriegsjahre wurde der Kindergarten so lange wie möglich offengehalten, bis der Beginn des Bombardements Hamburgs die Schließung nötig machte. Auf Initiative eines Arztes betreute Adele Will in dieser Zeit Kinder von Bombenopfern in der Lüneburger Heide und dem Kleinwalsertal.
Den Eltern der Kinder und auch "Ehemaligen" stand Adele Will immer mit Rat und Tat in schwierigen Erziehungs- und Familiensituationen zur Seite. Viele hielten über Jahrzehnte den Kontakt, manche waren inzwischen selber (Groß-)Eltern und brachten ihre Kinder zu "Tante Will" in den "Winkel 21".
1986 - bald nach dem sechzigjährigen Jubiläum und kurz vor Eintritt in den Ruhestand - bekam sie das Bundesverdienstkreuz am Bande "für ihr beispielhaftes Engagement bei der Betreuung von Kindern" verliehen. Sie nahm den Orden nur entgegen: "stellvertretend für meine Kolleginnen der anderen privaten Kindergärten Hamburgs". Einige Jahre war sie deren Sprecherin im "Verein der privaten Kindergärten von Hamburg und Umgebung" gewesen. 1990 wurde ihr der Portugaleser Taler in Bronze "BÜRGER DANKEN" durch den "Zentralausschuss Hamburgischer Bürgervereine v. 1886" überreicht.
Ehrenamtlich engagierte sich Adele Will in der Ökumene ihrer Kirchengemeinde St. Antonius sowie im Seniorenheim Anscharhöhe in Eppendorf, wo sie auch ihren Lebensabend verbrachte.
Aenne Willkomm
verh. Kettelhut
Kostümbildnerin


17.06.1902
Shanghai
–
20.06.1979
Hamburg
Shanghai
–
20.06.1979
Hamburg
Mehr erfahren
Über Aenne Wilkomm's Herkunft ist nichts bekannt. Kurz nachdem sie ihre Ausbildung in der Modeklasse des Lette-Vereins zur Förderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts abgeschlossen hatte, kam sie zum Film. Der Filmproduzent Erich Pommer hatte sie engagiert, nachdem er sich bei den öffentlichen Abschlussprüfungen des Lette-Vereins die Arbeiten der Schülerinnen angesehen hatte. Er benötigte Aenne Willkomm zur Unterstützung des kranken Kostümdesigners Paul Gerd Guderian (1896-1924). Aenne Willkomms Ehemann, Erich Kettelhut, schreibt dazu in seinen Erinnerungen: "Herr Guderian starb an Tuberkulose (…). Die erst zwanzig Jahre alte Aenne Willkomm, direkt von der Schule in das hektische Filmgeschäft gestellt, befand sich in keiner beneidenswerten Lage.
Neben den noch zum Teil in Arbeit befindlichen Kostümen zum ersten Teil der ‚Nibelungen' war die Hunnenbekleidung zum zweiten Teil bei Umlauff in Hamburg über das Anfangsstadium noch nicht hinausgekommen. Arthur von Gerlach, der Regisseur des Grieshuus-Filmes, wartete indes auf die Kostümentwürfe, denn auch er hatte Herrn Guderian als Kostümberater verpflichtet." 1) Diese desolate Situation fand Aenne Willkomm vor und musste nun tätig werden.
"Fräulein Willkomms Pastellenentwürfe trugen ihr sofort die Achtung aller Beteiligten ein. Ebenso folgten die ausführenden Firmen willig ihren Anweisungen. Aenne Willkomm hat sich mit einem Schlag durchgesetzt. Fritz Lang bestand jetzt darauf, dass die junge Frau ausschließlich für ihn arbeiten sollte; genau dasselbe forderte auch Arthur von Gerlach. Andere Regisseure wollten auch nicht zurückstehen. So avancierte Fräulein Willkomm zur Leiterin der Ufa Kostümabteilung." 2)
Später kam es wegen Aenne Willkomm zwischen Fritz Lang und Arthur von Gerlach "zu einem heftigen Tauziehen". 3) Jeder der beiden Regisseure wollte sie exklusiv für seine damals gedrehten Filme. "Pommer entschied schließlich diesen Streit. Fräulein Willkomm sei nicht nur für diese beiden Filme, sondern für alle in Babelsberg produzierten Filme angestellt."4)
Aenne Willkomm und Heinrich Umlauff waren für die Kostüme der zweiteiligen Großproduktion "Die Nibelungen" von Fritz Lang zuständig. "Er und Fräulein Willkomm leisteten Teamarbeit mit dem Garderobenpersonal. Es galt die Garderobe von mehreren hundert Hunnenkriegern und -frauen zu sichten, zu ordnen und sie griffbereit zu halten. Erstaunlich schnell hatte sich Fräulein Willkomm im Filmbetrieb eingearbeitet. Sie verstand es, immer zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. So war der Grieshuus-Film, was Kostümentwürfe und deren Ausführung betraf, reibungslos fertiggestellt worden. Auch jetzt [beim Nibelungenfilm] betreute sie mehrere Filme mit Kostümen der unterschiedlichsten Zeitepochen" 5), so ihr Ehemann Erich Kettelhut.
Aenne Willkomm entwarf auch die futuristischen Kostüme von Fritz Langs Metropolis-Film (1927). Ihre Einkleidung der Schauspielerin Brigitte Helm, die die Maria spielte, setzten Akzente. Aenne Willkomm wollte mit ihren Kostümentwürfen - wie sie sagte - "den Realismus und die Authentizität des Phantastischen" betonen.
"Aenne, die mit einem umfangreichen Mitarbeiterstab, Garderobiers, Schneidern und Näherinnen in einem extra für sie erbauten Garderobentrakt die Kostümausstattung aller in Neubabelsberg [Ufa] hergestellten Filme besorgte und für Entwürfe und Ausstattungen verantwortlich zeichnete, hatte Kontakt zu großen, leistungsfähigen Textilfirmen. Sie vermittelte uns Stoffe oder Posamente für unsere Bauten, und wir konnten ihr helfen, wenn sie Anfertigungen von anderen Werkstätten brauchte, zum Beispiel Stirnreifen, Armspangen und dergleichen". 6)
Zwischen Aenne Willkomm und Erich Kettelhut entspann sich bei den Filmarbeiten eine Liebesbeziehung: "Ich mochte die Aenne vom ersten Moment an sehr und lernte sie im Laufe der Zeit immer mehr schätzen. Selbstverständlich brachte ich sie abends [nach der Arbeit] bis zu ihrer Haustür in der Charlottenstraße [Berlin], und wenn es nicht gar zu spät war, saßen wir noch eine Stunde in einem Café beieinander." 7)
Wie es in solchen Fällen oft vorkommt: es kam zur Heirat. Im Frühsommer 1926 gaben sich beide das Ja-Wort. Und damit endete wenig später auch Aenne Willkomms Karriere als viel beachtete Kostümbildnerin. Neben Kostümen für die Filme "Nibelungen" (1922-1924) und "Metropolis" (1925/26) hatte sie auch Kostüme u. a. für die Filme "mein Leopold" (1924), "Zur Chronik von Grieshuus" (1924), "Schwester Veronika" (1926), "Der Katzenstieg" (1927) und "Heimkehr" (1928) entworfen.
Aenne Willkomm, nun verheiratete Kettelhut und der Filmarchitekt Erich Kettelhut lebten in Hamburg. Aenne Kettelhut scheint als verheiratete Frau noch eine Zeitlang ein Mode-Atelier gehabt zu haben. So fertigte sie z. B. die Garderobe der Schauspielerin Lydia Potechina (1883-1934).
Aenne Kettelhut überlebte ihren Ehemann um drei Monate. Er starb im Alter von 85 Jahren am 13.3.1979 und sie im Alter von 77 Jahren am 20.6.1979.
Quellen:
1) Erich Kettelhut: Der Schatten des Architekten. Hrsg. von Werner Sudendorf. München 2009, S. 72.
2) Ebenda.
3) Erich Kettelhut, a. a. O., S. 134.
4) Ebenda.
5) Erich Kettelhut, a. a. O., S. 103.
6) Erich Kettelhut, a. a. O., S. 127.
7) Erich Kettelhut, a. a. O, S. 174.
Neben den noch zum Teil in Arbeit befindlichen Kostümen zum ersten Teil der ‚Nibelungen' war die Hunnenbekleidung zum zweiten Teil bei Umlauff in Hamburg über das Anfangsstadium noch nicht hinausgekommen. Arthur von Gerlach, der Regisseur des Grieshuus-Filmes, wartete indes auf die Kostümentwürfe, denn auch er hatte Herrn Guderian als Kostümberater verpflichtet." 1) Diese desolate Situation fand Aenne Willkomm vor und musste nun tätig werden.
"Fräulein Willkomms Pastellenentwürfe trugen ihr sofort die Achtung aller Beteiligten ein. Ebenso folgten die ausführenden Firmen willig ihren Anweisungen. Aenne Willkomm hat sich mit einem Schlag durchgesetzt. Fritz Lang bestand jetzt darauf, dass die junge Frau ausschließlich für ihn arbeiten sollte; genau dasselbe forderte auch Arthur von Gerlach. Andere Regisseure wollten auch nicht zurückstehen. So avancierte Fräulein Willkomm zur Leiterin der Ufa Kostümabteilung." 2)
Später kam es wegen Aenne Willkomm zwischen Fritz Lang und Arthur von Gerlach "zu einem heftigen Tauziehen". 3) Jeder der beiden Regisseure wollte sie exklusiv für seine damals gedrehten Filme. "Pommer entschied schließlich diesen Streit. Fräulein Willkomm sei nicht nur für diese beiden Filme, sondern für alle in Babelsberg produzierten Filme angestellt."4)
Aenne Willkomm und Heinrich Umlauff waren für die Kostüme der zweiteiligen Großproduktion "Die Nibelungen" von Fritz Lang zuständig. "Er und Fräulein Willkomm leisteten Teamarbeit mit dem Garderobenpersonal. Es galt die Garderobe von mehreren hundert Hunnenkriegern und -frauen zu sichten, zu ordnen und sie griffbereit zu halten. Erstaunlich schnell hatte sich Fräulein Willkomm im Filmbetrieb eingearbeitet. Sie verstand es, immer zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. So war der Grieshuus-Film, was Kostümentwürfe und deren Ausführung betraf, reibungslos fertiggestellt worden. Auch jetzt [beim Nibelungenfilm] betreute sie mehrere Filme mit Kostümen der unterschiedlichsten Zeitepochen" 5), so ihr Ehemann Erich Kettelhut.
Aenne Willkomm entwarf auch die futuristischen Kostüme von Fritz Langs Metropolis-Film (1927). Ihre Einkleidung der Schauspielerin Brigitte Helm, die die Maria spielte, setzten Akzente. Aenne Willkomm wollte mit ihren Kostümentwürfen - wie sie sagte - "den Realismus und die Authentizität des Phantastischen" betonen.
"Aenne, die mit einem umfangreichen Mitarbeiterstab, Garderobiers, Schneidern und Näherinnen in einem extra für sie erbauten Garderobentrakt die Kostümausstattung aller in Neubabelsberg [Ufa] hergestellten Filme besorgte und für Entwürfe und Ausstattungen verantwortlich zeichnete, hatte Kontakt zu großen, leistungsfähigen Textilfirmen. Sie vermittelte uns Stoffe oder Posamente für unsere Bauten, und wir konnten ihr helfen, wenn sie Anfertigungen von anderen Werkstätten brauchte, zum Beispiel Stirnreifen, Armspangen und dergleichen". 6)
Zwischen Aenne Willkomm und Erich Kettelhut entspann sich bei den Filmarbeiten eine Liebesbeziehung: "Ich mochte die Aenne vom ersten Moment an sehr und lernte sie im Laufe der Zeit immer mehr schätzen. Selbstverständlich brachte ich sie abends [nach der Arbeit] bis zu ihrer Haustür in der Charlottenstraße [Berlin], und wenn es nicht gar zu spät war, saßen wir noch eine Stunde in einem Café beieinander." 7)
Wie es in solchen Fällen oft vorkommt: es kam zur Heirat. Im Frühsommer 1926 gaben sich beide das Ja-Wort. Und damit endete wenig später auch Aenne Willkomms Karriere als viel beachtete Kostümbildnerin. Neben Kostümen für die Filme "Nibelungen" (1922-1924) und "Metropolis" (1925/26) hatte sie auch Kostüme u. a. für die Filme "mein Leopold" (1924), "Zur Chronik von Grieshuus" (1924), "Schwester Veronika" (1926), "Der Katzenstieg" (1927) und "Heimkehr" (1928) entworfen.
Aenne Willkomm, nun verheiratete Kettelhut und der Filmarchitekt Erich Kettelhut lebten in Hamburg. Aenne Kettelhut scheint als verheiratete Frau noch eine Zeitlang ein Mode-Atelier gehabt zu haben. So fertigte sie z. B. die Garderobe der Schauspielerin Lydia Potechina (1883-1934).
Aenne Kettelhut überlebte ihren Ehemann um drei Monate. Er starb im Alter von 85 Jahren am 13.3.1979 und sie im Alter von 77 Jahren am 20.6.1979.
Quellen:
1) Erich Kettelhut: Der Schatten des Architekten. Hrsg. von Werner Sudendorf. München 2009, S. 72.
2) Ebenda.
3) Erich Kettelhut, a. a. O., S. 134.
4) Ebenda.
5) Erich Kettelhut, a. a. O., S. 103.
6) Erich Kettelhut, a. a. O., S. 127.
7) Erich Kettelhut, a. a. O, S. 174.
Marianne Wöbcke-Nagel
Bildhauerin



31.12.1906
Hamburg
–
16.09.1988
Hamburg
Hamburg
–
16.09.1988
Hamburg
Mehr erfahren
Ihre berufliche Laufbahn begann Marianne Nagel mit einem Schneiderkurs an der Gewerbeschule, danach ab 1926 mit einer Ausbildung zur MTA am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf und einem halbjährigen Handelsschulkursus im Jahr 1931. Schließlich absolvierte sie zwischen 1933 und 1936 eine Bildhauerausbildung bei Johann Bossard.
Nachdem sie ein Jahr im Atelier von K. Bauer gearbeitet hatte, bekam sie 1937 ein eigenes Atelier im Künstlerheim Birkenau 24. Ein Reisestipendium für Paris verwendete sie zu dessen Ausstattung.
Als der Zweite Weltkrieg begann, musste ein Praktikum in der keramischen Fabrik Meimerstorf absolvieren, in der sie ‚Winterhilfspakete‘ herstellte. Marianne Woebke-Nagel trat damals nicht der NSDAP bei. 1943 wurde ihr Atelier ausgebombt. Sie floh nach Tübingen, wo sie schwer erkrankte. 1944 kehrte sie nach Hamburg zurück.
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus arbeitete sie ab 1946 an der Kunstschule und heiratete 1952 den Bildhauer, Maler, Grafiker Albert Woebcke (1896-1980).
Das Paar lebte in Marianne Woebcke-Nagels Elternhaus in der Erikastraße 178.
Marianne Woebcke-Nagel, die auch Weihnachtskrippen für Kirchen anfertigte, bekam zwischen 1960 und 1975 Aufträge für das Hamburger Panoptikum, womit sie das Geld für den Unterhalt der Familie verdiente. So modellierte sie für das Panoptikum zum Beispiel in Ton den Kopf des Fußballspielers Uwe Seeler. Insgesamt fertigte sie 33 Büsten an.
Sie wurde bei ihrem Ehemann auf dem Ohlsdorfer Friedhof bestattet. Das Grab gilt als Prominentengrab, weil Albert Woebcke – im Gegensatz zu seiner ebenfalls bildhauerisch tätigen Ehefrau – als prominent eingestuft wurde. Marianne Woebcke-Nagel wurde in der Prominentenliste des Friedhofes nicht aufgeführt.
Margarethe Wöhrmann
geb. Brosterhues
Politikerin (SPD)




19.7.1900
Hamburg
–
7.1.1989
Hamburg
Hamburg
–
7.1.1989
Hamburg
Mehr erfahren
Margarethe, genannt Grete, war das dreizehnte Kind eines Schusters und einer gelernten Weißnäherin, die als Putzfrau arbeitete. Politisch tendierten die Eltern der SPD zu. Schon früh nahmen die älteren Geschwister Grete mit zu Veranstaltungen der Arbeiterjugend. 1914 trat sie dem Arbeiter-Jugend-Bund bei, wo sie zunächst Obmännin, später Leiterin einer Jüngerengruppe wurde.
Nach Abschluss der Volksschule absolvierte sie eine zweijährige kaufmännische Lehre und arbeitete von 1917 bis 1919 als Kontoristin und von 1919 bis 1923 als Sekretärin im Büro der Filiale des Transportarbeiterverbandes.
1918 trat sie der SPD bei, lernte dort ihren späteren Mann, den kaufmännischen Angestellten Bernhard Wöhrmann, kennen, und leitete mit ihm eine Jugendgruppe in der Neustadt.
Nach der Hochzeit im April 1923 wurde Grete Wöhrmann aus ihrer Stellung entlassen. Sie betätigte sich nun ehrenamtlich in einem Hamburger Mädchenheim. Diese Arbeit übte sie bis zur Geburt ihres ersten Kindes im Jahre 1924 aus. Vier Jahre später wurde ihre zweite Tochter geboren. Ihr Mann war seit Anfang der zwanziger Jahre Geschäftsführer der städtischen Blindenfürsorge in Altona.
Grete Wöhrmann war eine der wenigen Frauen, die Mitglied des Hauptvorstandes der Hamburger AWO (Arbeiterwohlfahrt) war. Außerdem arbeitete sie seit 1927 als Frauendistriktsleiterin der Altonaer SPD und war von 1929 bis 1933 Mitglied des Vorstandes der SPD Hamburg-Altona. 1930/31 wurde sie in der SPD zur Leiterin der Frauenarbeit gewählt und setzte sich gezielt für die Teil-nahme von Frauen an der Parteienpolitik ein. Zur selben Zeit wurde sie Kandidatin der Stadtverordnetenversammlung und 1931 Delegierte auf dem Reichsparteitag.
Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernahmen, wurde Bernhard Wöhrmann wegen seiner Mitgliedschaft im Arbeiter-Jugend-Bund, in der SPD, der AWO sowie bei den freien Gewerkschaften, aus dem Dienst entlassen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligte sich das Ehepaar Wöhrmann bei der Neuorganisation der SPD und wurde in der AWO wieder aktiv. Von 1946 bis 1949 gehörte Grete Wöhrmann als Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft an.
Anna Cunigunde Wohlwill
Schöpferin der Schule des Paulsenstiftes



20.6.1841
Seesen
–
30.12.1919
Hamburg
Seesen
–
30.12.1919
Hamburg
Mehr erfahren
„Der Schöpferin der Schule des Paulsenstiftes" steht auf ihrem Grabstein. Länger als ein halbes Jahrhundert war Anna Wohlwill Lehrerin und viereinhalb Jahrzehnte leitete sie die Schule des Paulsenstiftes.
Anna Wohlwill wurde am 20. Juni 1841 als viertes von fünf Kindern geboren. Ihre Mutter war eine geborene Warburg, ihr Vater Dr. Emanuel Wohlwill. Er war in Hamburg als Lehrer an der Stiftungsschule einer jüdischen Stiftung, die für Jungen aller Konfessionen gegründet worden war, tätig gewesen. Später wurde er Direktor der Jacobsen-Schule in Seesen im Harz. Er starb, als Anna Wohlwill sechs Jahre alt war. Die Mutter zog mit ihren Kindern nach Hamburg zurück und wohnte mit ihnen an der Alsterchaussee.
Anna Wohlwill besuchte zunächst die Privatschule von Herrn Kröger. Dann erhielt sie zusammen mit einigen anderen Altersgenossinnen zwei Jahre Unterricht in Geschichte, Deutsch und Literatur bei Dr. Anton Rée, dem Leiter der Stiftungsschule von 1815, und in Mathematik und Naturwissenschaften bei Otto Jessen, dem Gründer des Gewerbeschulwesens. Außerdem wurde sie auch von ihren Brüdern Emil und Adolf Wohlwill unterrichtet. Anna Wohlwill wollte viel lernen. Einer ihrer Leitsprüche lautete: „Wer nicht mehr selbst lernt, der lehrt nicht gut und hört auf, zu erziehen."
Da es zu ihrer Zeit in Hamburg noch keine Bildungsanstalten für Lehrerinnen gab, hospitierte sie regelmäßig in der Stiftungsschule von 1815 und unterrichtete gleichzeitig, ohne jemals eine Prüfung abgelegt zu haben, seit ihrem 15. Lebensjahr die Kinder in der Schule des Paulsenstifts (siehe dazu historischer Grabstein Hanna Glinzer). Es waren die Kinder der Armen, für die es damals noch keine staatlichen Schulen gab. Weil es für diese noch keine staatliche Schule gab, hatten Johanna Goldschmidt und Amalie Westendarp, die beiden Mitglieder des 1849 gegründeten Frauen-Vereins zur Unterstützung der Armenpflege, eine Armenschule gegründet, „(...) deren Elementarunterricht keine religiöse Unterweisung vorsah. Daran nahm die Regierung Anstoß und verbot vorübergehend die Schule, bis sie 1856 neu eröffnet werden und 1866 als offiziell anerkannte Mädchenschule in das neu gebaute Paulsenstift einziehen konnte.“ (Ursula Randt: Johanna Goldschmidt, in: Hamburgische Biografie, Personenlexikon. Hrsg. von Franklin Kopitzsch und Dirk Brietzke. Bd. 1. Hamburg 2000.)
Anna Wohlwill war erst 25 Jahre alt, als ihr am 3. November 1866 die Leitung der Schule des Paulsenstiftes anvertraut wurde, die zu diesem Zeitpunkt schon keine reine Armenschule mehr war - das macht auch die breite Palette an Unterrichtsfächern deutlich. Naturwissenschaftlicher Anschauungsunterricht und Englisch kamen hinzu, 1867 Gymnastikunterricht, 1868 Pflichtenlehre, 1869 Maschinennähen und 1870 Französisch. 1866 und 1867 waren die Lehrerinnenbücherei, die Zeitschriftensammlung und die Schülerinnenbücherei angelegt worden. Mit diesem reichen Angebot überbot die Schule des Paulsenstiftes bei weitem das der siebenstufigen Mädchenvolksschulen, die der Staat 1871 errichtete.
Die Resonanz auf die Schule des Paulsenstiftes war groß. 1880 hatte die Schule bereits acht Klassen mit 369 Kindern und erfüllte die Anforderungen der damaligen neunjährigen höheren Mädchenschule. 1881 trug die Oberschulbehörde dem Rechnung und nahm die Schule in die Sektion für höhere Schulen auf. Die endgültige Anerkennung als höhere Mädchenschule erhielt die Schule 1893, als sie aus Platzmangel in die Bülowstr. 20 auf ein staatliches Grundstück gezogen war. Mit der Anerkennung als höhere Mädchenschule wurde die Schule des Paulsenstiftes „halböffentlich" - und diente als Ersatz für eine fehlende staatliche höhere Mädchenschule.
Ostern 1894 war die Schule bereits eine neunstufige Anstalt mit 562 Schülerinnen in vierzehn Klassen; zwei Jahre später, 1896, hatte sie in siebzehn Klassen 760 Schülerinnen, und 1908 konnte das zehnte Schuljahr „eingeweiht werden".
Damit auch begabte Kinder aus ärmeren Familien diese Schule besuchen konnten, wurde eine Freistellenstiftung gegründet, die 1906 anlässlich des 40. Dienstjubiläums von Anna Wohlwill den Namen Anna-Wohlwill-Stiftung erhielt. Sie vergab 20 ganze und 50 halbe Freistellen, die aus Geschenken und Legaten von Freunden und Freundinnen der Schule finanziert wurden.
Auf gutes Benehmen ihrer Schülerinnen legte Anna Wohlwill sehr großen Wert. Die Klassenlehrerin wurde mit Handschlag und Knicks begrüßt. War der Unterricht beendet, führte die Lehrerin die Klasse geordnet zum Ausgang und gab jeder zum Abschied die Hand, wobei darauf geachtet wurde, dass die jungen Mädchen „ordentlich" aussahen. Strafarbeiten gab es nicht. Jede Arbeit wurde nachgesehen und verbessert, trotz der 50 Kinder in jeder Klasse. Die Schülerinnen lernten für Bedürftige zu sorgen und an andere zu denken. Großer Wert wurde darauf gelegt, den Eltern der Schülerinnen die Erziehungsmethoden der Schule nahezubringen. Dies geschah zum Schluss eines jeden Halbjahrs während einer Schulfeier.
Auch der Gesundheitszustand der Schülerinnen lag der Schule am Herzen. Zwischen 1866 und 1899 gab es den Fußzeugverein, der Kindern, die nur schlechtes Schuhzeug besaßen, mit Schuhen aushalf. Schülerinnen, die zu Hause nicht genügend zu essen bekamen, versorgte die 1868 gegründete Suppenanstalt. Und Schülerinnen, die arm und von schlechter Gesundheit waren, wurden zur Ferienerholung aufs Land geschickt. Deshalb wurde 1882 die Ferienstiftung der Schule des Paulsenstiftes gegründet, und 47 Schülerinnen fuhren nach vorheriger ärztlicher Untersuchung zur Erholung aufs Land. Da nicht jede Unterkunft bei einem Bauern den Vorstellungen der Schule entsprach, trug sich die Schule mit den Vorstellungen, ein eigenes Heim zu gründen. Am 7. Juni 1896 konnte dieser Plan realisiert werden, denn Frau Laura Beit hatte dem Paulsenstift ein Ferienerholungsheim am Timmendorfer Strand gestiftet. Es wurde Olgaheim genannt, nach der verstorbenen Tochter der Stifterin.
Als Anna Wohlwill 1906 ihr 50jähriges Lehrerinnenjubiläum beging, verlieh ihr der Senat als erster Frau eine goldene Denkmünze.
Am 1.4.1911 wurde Anna Wohlwill pensioniert und übergab die Leitung der Schule an Hanna Glinzer (historischer Grabstein im Garten der Frauen). In einer Laudatio hieß es: „Das Beste aber musste sie tun; und sie hat mit Treue und Freudigkeit 45 Jahre hindurch täglich ihre Pflicht erfüllt; mit Strenge gegen sich und, wo es nötig war, auch gegen andere, mit gütiger, in der Stille wirkender Liebe, mit klugem, klarem Verstande, der das Durchführbare sicher erfasste und es mit festem Willen auch durchführte. Keine Arbeit erschien ihr zu gering, wenn sie nur dem Zwecke des Ganzen diente, keine zu schwer und zu weit ausgreifend, wenn sie die Anstalt zu fördern berufen war. Hervorzutreten liebte sie nicht, sie hat die Öffentlichkeit so wenig wie irgend möglich beschäftigt; außerhalb ihrer Schule vermied sie auch, das Wort zu ergreifen, es sei denn, dass dies zum Besten des Ganzen nötig schien. Die große Einfachheit ihres Auftretens lässt es fast als eine Indiskretion erscheinen, an dieser Stelle über sie zu sprechen."
Obwohl Anna Wohlwill erblindete, blieb sie im Schulvorstand und erteilte weiterhin Unterricht in sozialer Hilfstätigkeit. Außerdem förderte sie die Waldschulidee und richtete mit ihrer Freundin Selly Agnes Wolffson in der ersten Woche nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges eine Kriegsküche im Keller des Schulhauses ein.
Anna Wohlwill, die in der Binderstraße 18 wohnte, musste sich im Alter zwei Staroperationen unterziehen und erlitt außerdem noch einen Oberschenkelhalsbruch.
Nach ihrem Tode wurde die an der Lehrerbildungsanstalt entlangführende Straße nach ihr benannt. Die nationalsozialistische Regierung benannte die Straße um und zog die Anna Wohlwill Medaille ein. Nach der Nazizeit, im Jahre 1948, wurde im Hamburger Stadtteil St. Pauli erneut eine Straße nach Anna Wohlwill benannt: die Wohlwillstraße.
Text: Rita Bake
Zitate:
vgl.: Inge Grolle: Die Schule des Paulsen-Stifts - ein Denkmal für Charlotte Paulsen - ein Erbe der Frauenbewegung. In: Charlotte Paulsen Gymnasium, Hamburg Wandsbek, 125 Jahre Schule des Paulsen-Stifts, 75 Jahre Lyzeum Wandsbek. Hamburg 1991.
Gretchen Wohlwill
Malerin der Hamburgischen Sezession


Wandmalerei an der Emilie-Wüstenfeld-Schule in Hamburg. Gretchen Wohlwill: kulturkarte.de/Schirmer

27.11.1878
Hamburg
–
17.5.1962
Hamburg
Hamburg
–
17.5.1962
Hamburg
Mehr erfahren
„Es zieht sich nicht eigentlich ein roter Faden durch mein Leben, sondern Episode reiht sich an Episode, und meine Erlebnisse hängen an den Personen, mit denen ich mehr oder weniger zufällig zusammengetroffen bin“ 1). „So ist mein Leben reich an Freundschaften gewesen, und dankbar muss ich sagen, ist es noch heute“1).
Diese beiden Sätze stehen am Anfang und Ende von Gretchen Wohlwills 1953 geschriebenen Lebenserinnerungen. Und so lesen sich ihre Aufzeichnungen auch wie eine Sammlung von Portraits. Aus Darstellungen von Familienmitgliedern, Kolleginnen aus der Schule, Malerfreundinnen und -freunden, Menschen, denen sie während ihrer Emigration in Portugal begegnete, setzt sich das Bild ihres Lebens quasi wie ein Mosaik zusammen.
Aber was nach den eingangs zitierten Worten fast spielerisch gelungen zu sein schien und durch die Freunde bestätigt wird, die Gretchen Wohlwill ausnahmslos als harmonische Persönlichkeit beschreiben – eine Wesensart, die sich auch in ihrem eher heiteren Werk zu spiegeln scheint -, war in Wahrheit mühsam abgerungen, geboren aus dem Bedürfnis nach unbedingter Nähe und Zusammenhang. Denn fährt man in der Lektüre der Lebenserinnerungen fort, so heißt es da: „Einen Ausspruch, der mir wahrscheinlich nur durch Erzählungen in der Erinnerung haftet, soll ich einmal getan haben, als Mutter mit uns Kindern in Niendorf an der Ostsee war, begleitet von unserer guten Kinderfrau Margarete Ording: ‚Süße Mutter und süße Deta, und alle beide mein’. Ich würde das nicht festhalten, wenn ich nicht meinte, dass es charakteristisch auch für mein späteres Leben wäre: Was ich liebte, wollte ich auch besitzen“ 1). Und zum Tode der Mutter formulierte sie: „Am 9. Mai ging der einzige Mensch dahin, den ich ganz besessen hatte“ 1).
Noch deutlicher wird diese Sehnsucht in einem undatierten Brief an Emmi Ruben (ihr Grabstein steht im Garten der Frauen) „Was Maetzel neulich sagte, war mir so aus der Seele gesprochen, dass nämlich, angenommen, die materielle Not sei eines Tages beseitigt oder gemildert, so bliebe doch immer die geistige Vereinsamung der Künstler u. ich möchte hinzufügen die seelische das Bedürfnis nach Verständnis u. Anteilnahme. Diejenigen deren Arbeiten scheinbar der Problematik entbehren, leiden unter solcher Vereinsamung ganz besonders. Solche Unproblematik ist ja auch nur scheinbar, der qualvolle Kampf um die Realisierung vollzieht sich mehr unter der Oberfläche als bei Anderen.“ Und in einem Brief an die Malerkollegin Alexandras Povorina heißt es: „...unendlich beglückend aber ist auch für mich das Erlebnis einer Seelenverwandtschaft. Alles wird mit in den einen Kreis hineinbezogen, da es aber eben ein irdischer ist, so sind wohl für mich viel mehr Schlacken, viel Qual und Unruhe dabei.“ (Brief vom 19. Juni 1927) 3).
Dass Gretchen Wohlwill ihre keineswegs glückliche Grundstimmung und ihr oft schweres äußeres Leben in einer Weise meisterte, dass sie jedermann als bezauberndes, ausgeglichenes Wesen erschien, ist wohl darauf zurückzuführen, dass sie sich den für sie wegweisenden Wahlspruch ihres bewunderten und verehrten Vaters zu eigen gemacht hatte: „Ich kenne nur Pflicht, Güte und Nächstenliebe“ 1)
Gretchen Wohlwill wurde als viertes Kind des Chemikers Emil Wohlwill und seiner Frau Luise geb. Nathan in Hamburg geboren. Der Vater, und durch seinen Einfluss auch die Mutter, wandten sich vom jüdischen Glauben ab und ließen auch in die Geburtsscheine ihrer Kinder „konfessionslos“ eintragen. Emil Wohlwill lehnte als Liberaler und Arbeiterfreund auch die so genannten Standesschulen ab, so dass Gretchen die Privatschule von Robert Meisner besuchte: „Es wurde nicht viel von uns verlangt, das Publikum war durchaus kleinbürgerlich und die Milieus keineswegs entsprechend meiner eigenen Häuslichkeit“ 1). Die eigene Häuslichkeit, das war eine sehr musikalische Mutter, die ihre Begabung an die Tochter Sophie, die Pianistin wurde, und an die Geige spielenden Söhne Heinrich und Friedrich weitergegeben hatte und die für das tägliche Leben und die Erziehung der Kinder zuständig war, und ein Vater, der für die Kinder „Festtag“ bedeutete. Die Besuche in seinem Labor zählte Gretchen zu den aufregendsten Erlebnissen ihrer Kindheit. Der Schatten, der über dieser Kindheit lag und der Gretchen noch über viele Jahre begleiten sollte, war die häufige Krankheit und Behinderung der ältesten Schwester Marie, die von den übrigen Familienmitgliedern permanente Rücksicht verlangte.
Dem Unterricht in der Meisnerschen Schule folgte dann aber doch eine ihrer Herkunft und ihren Anlagen entsprechende Ausbildung. Nach einem Jahr Selecta, wobei Gretchen von allen Fächern die Kunstgeschichte am meisten interessierte, erfüllte sich 1894 ihr größter Wunsch: Sie wurde an der Kunstschule von Valeska Röver angemeldet und bekam eine Ausbildung bei Ernst Eitner und Arthur Illies. 1904/5 ging sie zur Fortsetzung ihrer Studien nach Paris und besuchte die Privatakademien Stettler und Dannenberg bei Lucien Simon und Jacques Emile Blanche. Wirklichen Gewinn aber zog sie erst aus einem zweiten Parisaufenthalt 1909/10, und das nicht nur, weil sie in der Matisse-Schule arbeiten konnte, sondern auch, weil ihr „endlich die Augen aufgegangen waren für die Großen der Gegenwart und die Kunst vergangener Zeiten“ 1). Das stimmt allerdings nicht ganz – hatte sie doch schon früh gegenüber Alfred Lichtwark, dem damaligen Direktor der Kunsthalle, den Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckten Vermeer als ihren Lieblingsmaler genannt, eine Vorliebe, die viel über ihre künstlerische Auffassungsgabe und ihr Wesen aussagt. Auch dass sie auf seine zweite Frage, was sie denn malen wolle, antwortete „Menschliche Figuren in ihrer Umgebung und Tätigkeit“, zeigt ihrer frühe künstlerische Reise. So zollte ihr Lichtwark denn auch Respekt und Beifall.
Nach der Rückkehr von ihrem ersten Parisaufenthalt richtete Gretchen Wohlwill sich im elterlichen Haus in der Johnsallee 14 ein Atelier ein. Da sie, selbstkritisch wie sie ihre Leben lang blieb, überzeugt war, es nicht zu außerordentlichen Leistungen zu bringen und das Gelernte praktisch anwenden wollte, begann sie zu unterrichten und bereitete sich selbständig auf das Zeichenlehrerexamen vor, das sie 1909 in Berlin ablegte. In Hamburg hätte sie dafür ein dreijähriges Studium an der Gewerbeschule absolvieren müssen. Ihr Sinn fürs Praktische zeigt sich auch darin, dass sie 1897 ihre Malstudien ganz bewusst für ein halbes Jahr unterbrach, um eine Haushaltsschule zu besuchen.
1910 wurde Gretchen Wohlwill als Kunsterzieherin an der Emilie-Wüstenfeld-Schule eingestellt. Diese Tätigkeit schien ideal. Sie verschaffte ihr eine finanzielle Grundlage, die sie selbstbewusst und noch in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise einigermaßen unabhängig machte, und da sie nur vier Tage in der Woche unterrichtet, blieb ihr Zeit für das eigene Schaffen. Doch im Unterricht machte ihr nur die Arbeit mit den Begabten wirklich Freude, und die Reduktion ihrer künstlerischen Existenz auf eine Dreitagewoche und die Reisen während der Schulferien führten dazu, da sie sich ständig gehetzt fühlte: „Wie ich mich auf die Ferien freue, das kann niemand ahnen, der nicht weiß, wie es ist, seine besten Kräfte für eine Sache, die ihm so gleichgültig ist, hergeben zu müssen 3), schreibt sie am 19. Februar 1926 an die Malerfreundin Alexandra Povorina.
Kurz nach dem Tode des Vaters im Jahre 1912 wurde der Familie das Haus in der Johnsallee gekündigt, weil es verkauft werden sollte. Man erwarb das Haus Magdalenenstraße 12, wo Gretchen Wohlwill sich wiederum ein Atelier einrichtete, das sie auch nach dem aus wirtschaftlichen Gründen notwendigen Umzug in den MIttelweg nach dem Tod der Mutter behielt. Es wurde zum Treffpunkt junger Künstler. 1928 zogen Gretchen und Sophie aus der riesigen kalten Wohnung am Mittelweg in die Flemingstraße 3. „Musik im Erdgeschoß, die Malerei im Dach“ 3), charakterisierte Hans Stock, Freund und Senatsdirektor der Kulturbehörde nach 1945, das einträchtige Zusammenleben der beiden Schwestern.
1933 wurde Gretchen Wohlwill wie die meisten Beamten und Beamtinnen jüdischer Abstammung aus dem Schuldienst entlassen. Doch obwohl sie auf einer Italienreise im Jahre 1930 im täglichen Umgang mit den Italienern schon „mancherlei vom Wesen und von den Schrecken des Faschismus“ erfahren hatte und sich fragte, „ob es überhaupt möglich ist, dass Kunst gedeiht, in einem Lande, in dem in solchem Maße die persönliche Freiheit beschränkt ist“ 1), und obwohl sie 1933 aus der Hamburgischen Künstlerschaft ausgeschlossen wurde und miterlebt hatte, dass die Hamburgische Sezession sich auflöste, um ihre jüdischen Mitglieder nicht ausschließen zu müssen, blieb sie wie viele andere seltsam sorglos. Sie war mit ihrer Kündigung „nicht unzufrieden“ 1), konnte sie doch endlich ihrer eigentlichen Arbeit frei nachgehen. Eine Emigration zog sie zunächst nicht in Erwägung. Stattdessen fasste sie den Plan, sich auf der Fischer- und Bauerninsel Finkenwerder ein Haus neben dem des Malers Bargheer zu bauen, den sie 1926 kennengelernt hatte und mit dem sie seitdem eng befreundet war: „Von ihm könnte und müsste ich Bände voll schreiben. Seit nunmehr 25 Jahren verbindet mich mit ihm eine seltene Freundschaft, die auf mein Leben größten Einfluss gehabt hat“ 1), beginnt Gretchen Wohlwill in ihren Lebenserinnerungen ihre Hommage an den um 23 Jahre jüngeren Eduard Bargheer.
Eduard Bargheer lebte auf Finkenwerder, das – heute kaum noch vorstellbar – in den 20er Jahren mit seinem ländlichen Milieu, den Fischern und der Elbe viele Hamburger Künstler und Künstlerinnen anzog. Gretchen Wohlwill besuchte den Freund oft und baute sich bald einen Anbau an sein Atelier, um in den Ferien und am Wochenende hier zu leben und zu arbeiten: „Das Zusammensein mit Bargheer ist immer anregend, viele Klippen sind in unseren Beziehungen, aber jedes Mal, das eine überwunden ist, werden wir fester und sicherer. Er hat die Eigenart, irgendwie Selbstverständliches nicht auszusprechen; das macht es mir oft sehr schwer und ich leide sehr darunter. Wir haben sehr gearbeitet, aber auch manche schöne Segelfahrt gemacht und viel gebadet und geschwommen. Das Atelier ist fertig, und als Raum und Beleuchtung sehr schön geworden, nur ist es bei Sonnenschein sehr heiß, bei feuchtem Wetter eisig kalt. An dem Menschen Eduard Bargheer habe ich, je näher ich ihn kenne, keinen unlauteren Zug gefunden, er imponiert mir durch sein Zielbewusstsein, das ihn kleine Rücksichten nicht kennen lässt. Schwer ist im Verkehr mit ihm seine große Erregbarkeit. Er ist so gänzlich unbanal, darum ist mir Ihre ehemalige Auffassung so unbegreiflich. Glücklich in jeder Hinsicht macht er mich nicht, aber ich könnte mir mein Leben jetzt auch nicht mehr ohne ihn denken.“ (Brief an Alexandra Povorina vom 22. August 1928) 3).
Gemeinsam unternahmen die beiden Reisen nach Holland und Belgien (1928), England (1929) sowie Italien und Paris (Dezember 1930 bis Ostern 1931, Gretchen Wohlwill war von der Schulbehörde ein Studienaufenthalt und ein Zuschuss von 400 M zu ihrem Gehalt gewährt worden). 1933 fuhren sie erneut nach Paris, und 1936 mit dem Motorrad nach Dänemark. Sie besuchten auf ihren Reisen Museen, in denen sie auch zeichneten und kopierten, und quartierten sich an Orten ein, wo sie tagsüber in der Natur arbeiteten und abends über das Gemalte diskutierten, sich korrigierten und – keineswegs unwichtig – aßen und tranken: „Ach, wie sehr wusste Gretchen die Qualität einer guten Küche und eines guten Kellers zu schätzen! Was für eine glänzende Köchin war sie, die immer wieder sagte: Glaubst du, daß jemand ein richtiges Rot findet, dem es gleich ist, was er als Speise in den Mund nimmt? Ich hingegen, so sagte sie, bin überzeugt, dass die Trauerklöße, die nicht essen und nicht trinken mögen, auch keine guten Maler sein können. Sie hatte ein sehr strenges Pflichtbewusstsein vor sich selbst und schon ein schlechtes Gewissen, wenn mal Tage ohne Arbeit vergingen. Sie war ganz unbestechlich in ihrem Urteil, sei es im Menschlichen oder im Künstlerischen. Wir besuchten zusammen viele Museen Westeuropas und ich werde nie ihre treffenden Urteile vergessen“ 3), erinnert sich Eduard Bargheer an die gemeinsame Reise nach Holland.
Bis zum Frühjahr 1939, als das von der Stadt gepachtete Gelände, auf dem sie ihr Haus gebaut hatte, gekündigt wurde, weil dort eine Flugzeugwerft entstehen sollte, verbrachte Gretchen Wohlwill die Sommer auf Finkenwerder, malte und segelte mit Bargheer auf dem gemeinsamen Boot: „Das Boot war für mich ein ganz neues Erlebnis, ein Quell des Glücks aber auch mancher Quälerei, denn, nachdem Eduard die Familie T. kennengelernt hatte, zog er es öfter vor, diese auf seinen Fahrten mitzunehmen“ 1).
Der Freund Eduard Bargheer urteilte rückblickend: „Nach meinem Dafürhalten war ihre glücklichste Zeit die in Finkenwerder, als sie ihr kleines Haus gebaut hatte, in dem sie eine Reihe von Sommern ihrer Arbeit lebte. Daneben haben wir viel auf der Elbe gesegelt, was sie zur Arbeit anregte. Sie liebte das Milieu der Fischer, die sie alle schätzten und gern hatten“ 3).
Auf Dauer konnte sie jedoch nicht an den Tatsachen vorbeisehen. 1937 wurden vier ihrer Arbeiten als entartet beschlagnahmt, 1938 ihre 1931 im Auftrag Fritz Schumachers für die Emilie-Wüstenfeld-Schule gemalten Wandbilder mit Bildern im Stil der nationalsozialistischen Propaganda übermalt 4). Die Verordnungen der Nazis gegen die Juden machten das Leben „schwer und schwerer“, bis es „fast unerträglich geworden war“ 1). Sie begann mit der Schwester das Für und Wider der Auswanderung zu erörtern. Sophie konnte sich nicht entschließen. Sie wurde nach Theresienstand deportiert und starb dort, wie auch der Bruder Heinrich, ehemaliger Direktor der Norddeutschen Affinerie. Gretchen emigrierte, nachdem sie eine frühere Einreiseerlaubnis hatte verfallen lassen, quasi im letzten Moment im März 1940, im Alter von 61 Jahren nach Portugal. Auf Ischia und in Neapel verbrachte sie mit Bargheer „die letzten guten Tage ... danach begann wohl die schwerste Zeit meines Lebens, schwerer als die letzte Nazizeit in Hamburg“ 1). In Lissabon konnte sie bei der Familie ihres Bruders Fritz, Professor der Medizin, unterkommen, bis er in die USA weiterwanderte. Da sie so schnell wie möglich unabhängig werden wollte, versuchte sie, ihren Lebensunterhalt mit Stoffmalerei, Taschennähen und Sprach-, Literatur- und Malunterricht zu verdienen. Es war schweres Emigrantendasein in unheizbaren, primitiven Behausungen, voll Einsamkeit und Krankheit. Nach dem Krieg änderte sich das. Gretchen Wohlwill errang als Künstlerin nicht nur Anerkennung, sondern sogar Auszeichnungen: 1948 und 1952 erhielt sie den „Premio Francisco da Holanda“. Sie hatte eigene Ausstellungen und nahm an Gruppenausstellungen in Lissabon und Porto teil. Doch: „Die Sprache habe ich liebgewonnen, auch eine Reihe von Menschen. Das Land, Klima und die Stadt Lisboa sind mir immer fremd geblieben. Oft, plötzlich, habe ich mich an den Kopf gefasst: Wieso bist du hier, was willst du hier, das alles geht dich doch gar nichts an“ 1). Nach zwei Besuchen in Hamburg in den Jahren 1950 und 51 entschloss sie sich 1952 zur Rückkehr, wiederum sehr schwer und mit tiefem Zweifel: „Noch heute weiß ich nicht, ob es das Rechte war. ... Schwer genug ist mir die Entscheidung gefallen; dann plötzlich habe ich alles Nachdenken abgeschnitten und bin gefahren“ 1), schreibt sie ein halbes Jahr, nachdem sie wieder in Hamburg ist. Am Ende ihre Lebens bezeichnet sie diese Hamburger Jahre, in denen sie in den Grindelhochhäusern eine Wohnung hatte, jedoch als die schönsten ihres Lebens, weil die Politik sie nicht mehr direkt berührte.
Gretchen Wohlwill starb 1962 im Alter von 83 Jahren. „Kaum je in meinem Leben sah ich eine solche Vitalität, die trotz schmerzlicher körperlicher Behinderung, die mit dem Alter ständig zunahm, überall erschien, wo auch immer etwas zu sehen, zu hören war oder Menschen zu treffen waren, die sie interessierten. Ausstellungseröffnungen, Konzerte, Theater und Ballett; Gretchen fehlte nirgendwo. Ganz zu schweigen von all den abendlichen Einladungen, die sie nie absagte, wenn es ihr nur einigermaßen gut ging. Sie war stets zu allem aufgelegt und hatte einen unbändigen Lebenshunger, der sogar mit dem Alter eher zu- als abnahm. Apropos Alter: sie wollte nichts davon wissen und hatte ein Recht dazu, denn im Grunde hat es das für sie nie gegeben. Wie viele müde, sogenannte ‚Junge Leute’ könnten sich beglückwünschen, wenn sie nur ein Fünkchen hätten von Gretchens Lebendigkeit, Schärfe und Urteilskraft, welche sich bis zuletzt bewahrt hat.“ (Eduard Bargheer in der Rede zur Gedächtnisausstellung) 3).
Das Selbstgrüblerische ihrer Künstlerinnenkollegin Anita Rée war Gretchen Wohlwills Sache nicht, so dass von ihr auch nur ein einziges Selbstportrait – bezeichnenderweise aus der Zeit um 1933 – existiert. Ihre Sujets waren Landschaften, Stillleben, figürliche Kompositionen, Portraits: In Ausdrucksform und Farbgebung blieb sie ihren Lehrern Matisse und Cézanne verpflichtet. Sie war stets auf der Suche nach der von Cézanne formulierten Harmonie parallel zur Natur: „Obwohl ich es aufgegeben habe, ‚vor der Natur’ zu malen, so sind es doch immer Erlebnisse aus der Natur, die ich versuche, übersetzt, auszudrücken“ 5). In der abstrakten Malerei, wie sie nach 1945 im Umkreis von Willi Baumeister in Hamburg als zukunftsweisend betrachtet wurde, sah sie keine Lösung.
Wie Kritiken und Rezensionen zeigen, war Gretchen Wohlwill in den 20er und frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eine geschätzte Malerin und Graphikerin. Sie gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Hamburgischen Sezession und beteiligte sich an deren jährlichen Ausstellungen. Bis 1933 nahm sie an mindestens 15 Ausstellungen im In- und Ausland teil. Die Hamburger Kunsthalle und das Altonaer Museum kauften Bilder von ihr.
Heute existiert ihr Werk nur noch in Fragmenten. Vieles, was sie bei ihrer Auswanderung Freunden zur Aufbewahrung gegeben hatte, fiel den Bomben zum Opfer. Der Teil ihrer Arbeiten aber, den sie für den wesentlichsten hielt, ging aus dem Versandlift verloren, der nach Kriegsende nach Portugal geschickt werden sollte. Arbeiten von Gretchen Wohlwill befinden sich in der Kunsthalle, im Altonaer Museum und im Museum für Hamburgische Geschichte. Der im Staatsarchiv aufbewahrte Nachlass ist 1989 an die Familie zurückgegangen.
1990 wurde eine Gedenkplatte an der Emilie-Wüstenfeld-Schule Bundesstraße 9 in Erinnerung an die jüdischen Lehrerinnen der damaligen Deutschen Oberschule für Mädchen, heute Emilie-Wüstenfeld-Schule angebracht.
Text: Brita Reimers
Zitate:
[1] Gretchen Wohlwill: Lebenserinnerungen einer Hamburger Malerin. Bearbeitet von Hans-Dieter Loose. Hamburg 1984.
[2] Mappe „Nachlass Ruben“. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Handschriftenabteilung.
[3] Zitiert nach.: Maike Bruhns (Hrsg.): Gretchen Wohlwill eine jüdische Malerin der Hamburgischen Sezession. Hamburg 1989.
[4] Die Wandbilder wurden 1993 freigelegt und restauriert.
[5] Geschriebene Selbstportraits. In: Der Kreis. Zeitschrift für künstlerische Kultur. Hrsg. v. d. Hamburger Bühnen, Nr. 10. 1933.
Pflicht, Güte und Nächstenliebe war das Lebensmotto der Malerin Gretchen Wohlwill. Ihre Eltern, der Vater Chemiker, wandten sich vom jüdischen Glauben ab. In den Geburtsscheinen ihrer Kinder stand "konfessionslos". Nach ihrer Kunstausbildung machte sie das Zeichenlehrerinnenexamen, arbeitete ab 1910 als Kunsterzieherin an der Emilie-Wüstenfeld-Schule und gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Hamburgischen Sezession. 1933 wurde sie aus dem Schuldienst entlassen und aus der Hamburgischen Künstlerschaft ausgeschlossen. 1937 wurden vier ihrer Arbeiten als entartet beschlagnahmt, 1938 ihre für die Emilie-Wüstenfeld-Schule gemalten Wandbilder übermalt. 1940 emigrierte sie nach Portugal, kehrte 1952 nach Hamburg zurück und errang als Künstlerin Anerkennung und Auszeichnungen.
Henny Wolff
Konzert- und Oratoriensängerin, Gesangspädagogin


3.2.1896
Köln
–
29.1.1965
Hamburg
Köln
–
29.1.1965
Hamburg
Mehr erfahren
Eine Sechsjährige schreibt in ein Gästebuch „Henny Wolff, Sängerin“, und was nicht mehr als frommer Kinderwunsch scheint, entpuppt sich in der Folge als eine klar umrissene Vorstellung von einem zukünftigen Beruf. Sicherlich war dieser Wunsch beeinflusst, denn ihr Vater, Karl Wolff, war ein angesehener Musikkritiker, und die Mutter, Henriette Wolff-Dwillat, Konzertsängerin und Gesangspädagogin. Bei ihr hatte Henny Wolff, die schon als Kind schwerste Partien vom Blatt singen konnte, die ersten Gesangsstunden. Von 1906 bis 1912 erhielt sie Unterricht am Konservatorium in Köln, später bei Julius von Raatz-Brockmann. 1912 trat die 16jährige bei einem Kölner Gürzenich-Konzert erstmals öffentlich auf. Das war der Anfang einer glanzvollen Karriere im In- und Ausland. Als Bach und Händelinterpretin gelangte die Sopranistin zu Weltruhm. Häufig aber standen auch Lieder von Brahms und Werke der Moderne auf ihrem Programm. Gerne trug sie Lieder des Komponisten Hermann Reutter vor, der sie oft am Flügel begleitete. Sie trat zwar gelegentlich auch auf der Opernbühne auf, ihr eigentlicher Ort aber war der Konzertsaal.
Neben ihrer Tätigkeit als Sängerin wirkte Henny Wolff zeitlebens als Gesangspädagogin. Von 1914 bis 1916 lehrte sie am Konservatorium in Bonn, 1922 ging sie nach Berlin. Nachdem sie dort im Zweiten Weltkrieg alles verloren hatte, zog sie nach Hamburg und leitete von 1950 bis 1964 die Klasse für Sologesang an der Musikhochschule. 1958 ehrte die Hansestadt Hamburg Henny Wolff, die sich bis ins hohe Alter eine schöne und lebendige Stimme bewahrt hatte, für ihre Verdienste mit der Brahms-Medaille. Henny Wolff starb kurz vor Vollendung ihres 69. Lebensjahrs, am 29. Januar 1965, nach schwerer Krankheit.
In allen Nachrufen werden neben den künstlerischen ihre außergewöhnlichen menschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten hervorgehoben. Darum soll zum Schluss Ludwig Pollner zitiert werden, der anlässlich ihres 65. Geburtstages im „Hamburger Echo“ vom 3. Februar 1961 eine Hommage an die „große Liedgestalterin“ richtete, die einen Eindruck von ihrem Wesen gibt: „Ich würde mich über mich selbst ärgern, wenn ich, ihr gegenüber sitzend, objektiv bleiben könnte. Wer Henny Wolff wirklich kennt und nicht bei jeder neuen Begegnung von neuem beglückt ist, der muss entweder versteinert oder vertrottelt sein. Allerdings: Ich weiß selbst nicht recht, wofür ich sie mehr liebe. Wenn sie mit ihrer großen herrlichen Stimme und aus dem Überfluss ihrer Gestaltungskraft ihren Göttern Schubert, Schumann und Brahms dient, reißt es mich vom Stuhl hoch. Aber wenn sie in ihrer großen klaren Schrift in einem (sehr unromantischen) ‚Billett doux’ einlädt: ‚Wann kommen sie zum Fraße?’, dann reißt es mich erst recht vom Stuhl hoch. (Wir beide essen furchtbar gern.) Nur wenn sie anfängt Witze zu erzählen, liege ich alsbald unter eben diesem Stuhl, denn einer ist besser als der andere. Und eigentlich genügt schon die Einleitung: Kennen Sie den …“
Henny Wolff hat ein großes Geheimnis: Es ist das, was in Wahrheit ihre Erscheinung ausmacht. Wer nicht versteinert und nicht vertrottelt ist, mag es gar bald erraten, denn sie trägt ihr (sehr junges) Herz auf der Zunge: Es ist die völlige Einheit ihrer Persönlichkeit, der eine verschwenderische Natur alles gab, ein ganzer Mensch zu sein und Künstler von Geblüt dazu: Die lebenslang lebendige Fähigkeit selbstkritischer künstlerischer Arbeit, schöpferischen, klugen Verstand, ein großes und offenes Herz für das Wahre, und Charme, Witz und Esprit in jener köstlichen Dosierung, die nur Frauen so traumhaft sicher zu handhaben verstehen. Es ist ein Teil der Faszination, die von Henny Wolff ausgeht, gleichviel ob sie auf dem Podium steht, als souveräne Hausherrin in ihrem eigenwillig gestalteten Heim oder vor ihren Schülern. Auch vor ihnen ist sie vor allem ein Mensch. (Dass sie so ein herrlich lästerndes Biest sein kann, gehört auch zu ihr.) Es ist nicht die gewichtige ‚Frau Professor’ unserer Musikhochschule, und es ist nicht die große Sängerin, und es ist nicht einmal die glänzende Pädagogin, die ihre vielen Schüler zwingt, alles zu geben, was in ihnen steckt, um Henny Wolffs eiserne Forderungen zu erfüllen. Es ist einfach der Mensch Henny, der das bewirkt. Man könnte sie um ihr Sein beneiden. Man braucht es nicht: Man darf und muß sie verehren und lieben. Heute, zu Hennys 65. Geburtstag werden sie reihum aufmarschieren.“
Text: Brita Reimers
Hilde Wulff
Jugendwohlfahrtspflegerin



7.1.1898
Dortmund
–
23.7.1972
Hamburg
Dortmund
–
23.7.1972
Hamburg
Mehr erfahren
Hildegard Wulff zählt zu jenen Hamburger Persönlichkeiten, die Bereiche des öffentlichen Lebens maßgeblich beeinflusst und die Geschichte der Stadt entscheidend mitgeprägt haben. Trotz ihres beruflichen Engagements für behinderte Kinder und ihrer entschiedenen Ablehnung des NS-Regimes ist sie in der Öffentlichkeit jedoch nur einem kleineren Kreis bekannt.
Geboren wurde sie als Tochter eines begüterten Kaufmanns in Dortmund. Im Alter von zwei Jahren erkrankte Hildegard Wulff, die mit ihren Eltern und den zwei Schwestern nun in Düsseldorf wohnte, an Kinderlähmung, von der sie eine lebenslange Behinderung zurückbehielt. 1920 begann sie eine Ausbildung zur Heilpädagogin. Nach Abschluss der Ausbildung übernahm sie eine leitende Funktion in der von ihr und ihrem Vater ins Leben gerufenen Stiftung „Glückauf für Kinderfürsorge Düsseldorf“. Neben dieser Aufgabe wurde sie 1923 Mitglied im „Selbsthilfebund der Körperbehinderten“ in Düsseldorf und Berlin. Hildegard Wulff setzte sich stark für die Autonomie Behinderter ein. Außerdem belegte sie in dieser Zeit Vorlesungen in Psychologie und Pädagogik an den Universitäten Frankfurt a. M. und Hamburg.
Hildegard Wulff setzte sich in den 1920er Jahren zunächst in Düsseldorf und später in Berlin insbesondere für eine ordentliche Schulbildung körperbehinderter Kinder und für die gemeinsame Erziehung behinderter und so genannter gesunder Kinder ein. 1931 gründete sie die Krüppelhilfe und Wohlfahrt GmbH in Düsseldorf, die sie aus der Erbschaft ihres Vaters finanzierte. Hildegard Wulff war die alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin dieser Einrichtung, deren Ziel es war, „unentgeltliche Hilfe für Krüppel“ zu leisten. Von 1933 bis 1935 führte Hildegard Wulff ein Heim für körperbehinderte und sozial benachteiligte Kinder in Berlin. Charlottenburg. Dieses Heim bot Platz für zehn behinderte, erholungsbedürftige und sozial auffällige Kinder.
Nachdem 1935 der Mietvertrag für das Heim ausgelaufen war, zog sie mit diesen Kindern in die Klöppersche Villa nach Hamburg Volksdorf. Dieses Haus hatte sie bereits 1931 erworben, nachdem sie in Düsseldorf für ihre Krüppelhilfe und Wohlfahrt GmbH keine Baugenehmigung für einen Neubau erhalten hatte. Doch sie hatte das Haus wegen finanzieller Probleme zunächst noch nicht genutzt und es unentgeltlich der Hamburger Wohlfahrtsbehörde für die Kinder- und Jugendfürsorge überlassen. Nun aber, im Oktober 1935 bezog sie mit ihren Kindern die Villa in Volksdorf, der sie den Namen „Im Erlenbusch“ gab, wegen der die Villa umgebenden Landschaft.
Noch im selben Jahr erhielt Hildegard Wulff die staatliche Anerkennung als privat geführtes Kinderheim für Kinder und Jugendliche mit Behinderung.
1937 gründete Hildegard Wulff, in deren Heim rund 25 sowohl körperbehinderte als psychisch kranke sowie schwer erziehbare Kinder lebten, eine Heimschule und stellte dazu eine staatlich finanzierte Lehrerin ein.
Gemeinsam mit ihrer in unmittelbarer Nachbarschaft lebenden Freundin und Vertrauten Hermine Albers (1884-1955), die in der Hamburger Jugendhilfe arbeitete, leistete Hildegard Wulff Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Ihr Heim wurde Zufluchtsort für Kinder kommunistischer inhaftierter Eltern. Auch half Hildegard Wulff vielen jüdischen Emigrantinnen und Emigranten und kommunistischen Widerstandskämpfern.
1941 konnte sie durch hartnäckiges Verhandeln mit den Hamburger Behörden verhindern,, dass ihr Heim 1941 beschlagnahmt wurde.
1945, nach dem Ende des NS-Regimes übergab Hildegard Wulff die Schule an die Schulbehörde.
Ihr Volksdorfer Heim führte sie noch bis 1964 selbst und übergab es dann der Martha Stiftung, die ihre Lebensarbeit seitdem weiterführt.
Seit 2014 gibt es in jenfeld den Hilde-Wulff-Weg.
Dr. Rita Bake
Quelle:
Petra Fuchs: Hilde Wulff (1898-1972). Leben im Paradies der Geradheit. Münster 2003.
Inge Wulff
Malerin




14.2.1933
Hamburg
–
26.5.1997
Hamburg
Hamburg
–
26.5.1997
Hamburg
Mehr erfahren
Inge Wulff kam im Alter von 15 Jahren in die Alsterdorfer Anstalten. 1982 zog sie in das Stadthaus Schlump, eine Außenstelle der damaligen Alsterdorfer Anstalten (heute: Evangelische Stiftung Alsterdorf). Dort besuchte sie in ihrer Freizeit ab 1984 das von dem Hamburger Künstler Rolf Laute (1940 – 2013) gegründete Kelleratelier der „Schlumper“. Schnell zeigte sich Wulffs künstlerisches Talent und ihre Begeisterung für Malerei und Zeichnung. Hauptberuflich war Inge Wulff jedoch bis 1993 in der Montage- und Verpackungsabteilung der Elbewerkstätten tätig, da ihre Betreuer eine hauptberufliche Tätigkeit als Künstlerin für sie nicht befürworteten.
Die Ateliergemeinschaft „Die Schlumper“ entstand in den 1980er Jahren und fand 1983 einen festen Ort im Stadthaus Schlump in der Straße Beim Schlump in Hamburg. Künstler*innen mit unterschiedlichen Behinderungen trafen sich dort zum gemeinsamen Schaffen. Mit Hilfe des 1985 gegründeten Fördervereins ‚Freunde der Schlumper‘ und der Unterstützung der ‚Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Hamburg‘ gelang es 1993 das Arbeitsprojekt ‚Schlumper von Beruf‘ zu initiieren. So wurde die Möglichkeit für die Künstler*innen geschaffen, ihrer Tätigkeit hauptberuflich nachzugehen. Seit Anfang 2002 gehört das ehemalige Arbeitsprojekt mit sozialversicherten Künstlerarbeitsplätzen zur Ev. Stiftung Alsterdorfer, Bereich Alsterarbeit.“1) Inge Wulff wurde hauptberuflich Künstlerin und blieb dies bis zu ihrem Tod 1997. Ihre Bilder waren in zahlreichen Ausstellungen vertreten, u. a. auch in der Hamburger Kunsthalle 2005/2006.
Die Kunsthistorikerin Maike Bruhns schreibt über Inge Wulffs Kunst: „Hochbegabt, Kompositionen aus großen Formen teils in reiner Farbfeldmalerei, teils mit gegenständl. Elementen versehen, Strichmänner, Kinderzeichnungen.“2)
Günther Gercken äußerte über die Künstlerin Inge Wulff: „Sie besaß eine künstlerische Hochbegabung., Ihre Bilder komponierte sie aus großen Formen und bereicherte sie mit ihrer persönlichen Schrift oder figürlichen Einzelheiten. Sie hat Bilder geschaffen, die unsere Welt bereichern und weiter bestehen werden.“ Und im Ausstellungskatalog „Die Schlumper Kunst in Hamburg“ aus dem Jahr 2005 heißt es über Inge Wulffs Werke u. a. : „Ihre ausgewogenen Kompositionen fand sie unmittelbar im Malprozess. Die bildnerischen Entscheidungen, die uns wohlüberlegt erscheinen, wurden weitgehend vom Unbewussten gesteuert. Die großen Formen bereicherte sie mit kleinen Details und mit Schriftelementen. Sie vermied es, dass die Kombination der verschiedenen Bildelemente additiv wirkt; im Gegenteil verstand sie es, Kleinteiligkeit und Großformigkeit zu einer überzeugenden Gesamtkomposition zu vereinen. In dunklen Rahmenbildern füllte sie die weißen Flächen mit primitiven Figuren von Menschen und Tieren. Ihre Bilder, die zunächst abstrakt erscheinen, sind in Wirklichkeit gegenständlich. Wenn man sich in ihre eigenwillige Formensprache eingesehen hat, erkennt man, dass sie in ihren Bildern Gesehenes und Erlebtes schildert.“3)
Gruppenausstellungen (Auswahl): 1989 Hamburg, Kampnagelfabrik, 1991 Freiburg an der Elbe, Kehdinger Kunstverein, 1993 Berlin, KulturBrauerei, 1994 Meldorf, Landesmuseum, 1995 Ahrensburg, Marstall, 1996 Bonn, Bundesgesundheitsministerium, 1999 Bonn, Landesvertretung Hamburg, 2001 Lütjensee, Tymmo Kirche, 2001 Prag, Rathaus, 2002 Chicago, Cultural Center, 2002/2003 Rostock, Kunsthalle, 2003 Göttingen, Kunstverein, 2005/2006 Hamburg, Kunsthalle, 2008 San Gimignano, Galleria D´Arte Moderna e Contemporanea, 2009 Lübeck, Kulturforum Burgkloster
Quellen: 1) https://www.schlumper.de/atelier.html und: Seite „Die Schlumper“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Januar 2025, 17:05 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_Schlumper&oldid=252805108 (Abgerufen: 15. März 2025, 08:10 UTC)
2) Der Neue Rump. Lexikon der bildenden Künstler Hamburgs. Überarbeitete Neuauflage des Lexikons von Ernst Rump (1912). Hrsg. von Familie Rump, ergänzt, überarb. Und auf den heutigen Wissensstand gebracht von Maike Bruhns. 2. Aufl. Neumünster 2013, S. 525.
3) Die Schlumper. Kunst in Hamburg. Hrsg. von der Hamburger Kunsthalle anlässlich der Ausstellung „Die Schlumper Kunst in Hamburg“ vom 25. November 2005 bis 29. Januar 2006. Hamburg 2005, S. 30.
Grete Marie Zabe
(geb. Tischkowski)
Vorsitzende des Frauenaktionsausschusses der SPD, Mitglied (SPD) der Hamburgischen Bürgerschaft



18.3.1877
Danzig
–
1.12.1963
Hamburg
Danzig
–
1.12.1963
Hamburg
Mehr erfahren
Grete war fünf Jahre alt, als ihre Eltern, der Vater ein Schiffszimmergeselle, die Mutter ein Dienstmädchen, verstarben. Sie kam in ein Waisenhaus, später zu Pflegeeltern. Sie besuchte die Volksschule, wurde Dienstmädchen, später Arbeiterin in einer Zigarrenfabrik. Im Alter von 20 Jahren heiratete sie einen Malergehilfen. Ein Jahr später wurde das erste Kind, drei Jahre darauf das zweite und nach weiteren vier Jahren das dritte Kind geboren. Da das Gehalt ihres Mannes nicht für den Lebensunterhalt der Familie ausreichte, übernahm Grete Zabe zwischenzeitlich Aushilfsarbeiten.
Nachdem die Familie 1906/07 nach Hamburg
gezogen war, wurde Grete Zabe auf Anregung ihres Mannes, einem aktiven Sozialdemokraten und Gewerkschafter, Mitglied der SPD. Grete Zabe, die großes Redetalent besaß, machte Parteikarriere: 1913 wurde sie in den SPD-Distriktvorstand Hamburg-Uhlenhorst gewählt und leitete während des Ersten Weltkrieges die Kriegsküche dieses Stadtteils. Von 1919 bis 1933 war sie Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und im Ausschuss für Wohnungsfragen sowie in der Oberschulbehörde als einzige Frau in der Deputation für das Gefängniswesen tätig. Dort machte sie sich für eine Reform des Strafvollzuges stark. Zwischen 1922 und 1933 war sie Mitglied des SPD-Landesvorstandes und des SPD-Frauenaktionsausschusses. Im Letzeren hatte sie von 1922 bis 1927 den Vorsitz. Die zentralen Forderungen der SPD und des Frauenaktionsausschusses waren damals u. a.: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Verbesserung des Arbeits- und Mutterschutzes für erwerbstätige Frauen, gleiches Recht auf Erwerbstätigkeit für Mann und Frau und die Reform des Schwangerschaftsparagraphen 218.
1933 und 1944 wurde Grete Zabe von der Gestapo mehrere Tage inhaftiert.
Nach 1945 war Grete Zabe wieder für die SPD und die Arbeiterwohlfahrt aktiv.
